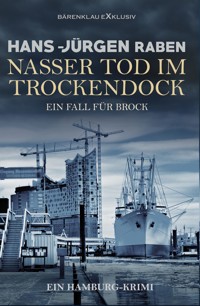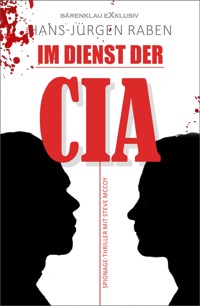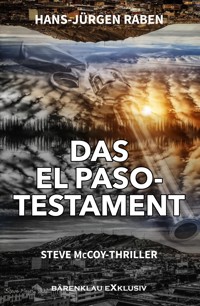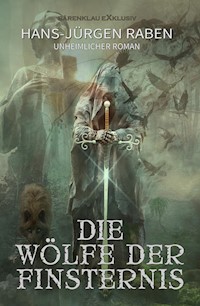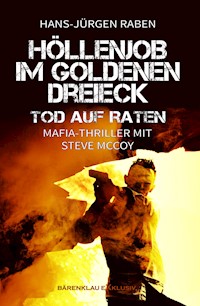
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Man sollte sich davor hüten Wünsche zu äußern, wenn man nicht bereit ist, die vollen Konsequenzen zu tragen, wenn sie in Erfüllung gehen …
Steve McCoy, der Einzelgänger und Geheimagent für besonders heikle Fälle, träumt davon, Urlaub in einer sonnigen Gegend zu machen – kurz darauf klingelt sein Telefon, und sein nächster Auftrag führt ihn in eine wirklich warme Gegend, die man »Goldenes Dreieck« nennt. Nur sollte es kein Urlaub, sondern der schlimmste Albtraum seines bisherigen Lebens werden.
Brian Kent ist Profikiller und weltweit einer der Besten in diesem Geschäft. In »Fachkreisen« gilt er als gradenloses Raubtier in den Dschungeln der Städte. Er hat den Ruf, dass er jeden tötet, der ihm gefährlich wird oder für dessen Tod er den Auftrag hat und diesmal heißt sein Ziel Steve McCoy. Doch er ist nicht der Einzige, der Jagd auf McCoy macht …
Dieser Band beinhaltet folgende Titel:
Teil 1 – Im Feuerhagel
Teil 2 – Todesfalle Grüne Hölle
Bonusgeschichte – Tod im Korallenmeer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hans-Jürgen Raben
Höllenjob im Goldenen Dreieck
– Tod auf Raten –
Gesamtband von »Tod im Goldenen Dreieck«
Ein Mafia-Thriller mit Steve McCoy
Mit der Bonusgeschichte »Tod im Korallenmeer«
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Kathrin Peschel, 2022
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Teil 1 – Im Feuerhagel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
Teil 2 – Todesfalle Grüne Hölle
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
– Bonusgeschichte –
Tod im Korallenmeer
Der Autor Hans-Jürgen Raben
Weitere Werke des Autors
Das Buch
Man sollte sich davor hüten Wünsche zu äußern, wenn man nicht bereit ist, die vollen Konsequenzen zu tragen, wenn sie in Erfüllung gehen …
Steve McCoy, der Einzelgänger und Geheimagent für besonders heikle Fälle, träumt davon, Urlaub in einer sonnigen Gegend zu machen – kurz darauf klingelt sein Telefon, und sein nächster Auftrag führt ihn in eine wirklich warme Gegend, die man »Goldenes Dreieck« nennt. Nur sollte es kein Urlaub, sondern der schlimmste Albtraum seines bisherigen Lebens werden.
Brian Kent ist Profikiller und weltweit einer der Besten in diesem Geschäft. In »Fachkreisen« gilt er als gradenloses Raubtier in den Dschungeln der Städte. Er hat den Ruf, dass er jeden tötet, der ihm gefährlich wird oder für dessen Tod er den Auftrag hat und diesmal heißt sein Ziel Steve McCoy. Doch er ist nicht der Einzige, der Jagd auf McCoy macht …
Dieser Band beinhaltet folgende Titel:
Teil 1 – Im Feuerhagel
Teil 2 – Todesfalle Grüne Hölle
Bonusgeschichte – Tod im Korallenmeer
***
Teil 1 – Im Feuerhagel
1. Kapitel
New York, John F. Kennedy Airport, Februar 1984
Den beiden Männern entging nichts. Sie glichen sich wie ein Ei dem anderen, obwohl sie keine Zwillinge waren. Aber sie gehörten dem gleichen Typ an. Sie waren hart und schnell.
Auf dem New Yorker John F. Kennedy-Flughafen herrschte der übliche Trubel, der nur in den Nachtstunden abflaute. Tausende von Passagieren hasteten durcheinander, hantierten mit ihren Gepäckstücken oder suchten nach dem Ticket. Sprachfetzen aus vieler Herren Länder schwirrten durch die Luft.
Einer der beiden Männer nahm langsam seine Sonnenbrille ab. Unauffällig nickte er zu einem Zollbeamten an der Sperre hinüber, der nur leicht das Gesicht verzog, zum Zeichen, dass er verstanden hatte.
Gleichzeitig wandte sich der Mann an seinen Begleiter, der unbeweglich die Menschen anstarrte, die sich durch die Zollschleuse drängten.
»Das ist unser Mann. Der dort drüben in dem braunen Anzug.«
»Er hat nur eine Reisetasche«, bemerkte der zweite Mann. »Reisen die Kuriere heutzutage mit so leichtem Gepäck?«
Der Erste verzog keine Miene. »Es ist unauffälliger. Eine Masse von Koffern erregt die Neugier von Zöllnern auf der ganzen Welt. Der Mann muss einige Kontrollen passieren, ehe er hier ankommt. Meist winkt man einen Passagier mit einer Reisetasche einfach durch. Was kann er schon mitgebracht haben?«
Der andere nickte. »Viel Platz nimmt das Zeug nicht weg. Und schon mit einem oder zwei Kilo lässt sich ein gewaltiger Profit herausholen.«
Inzwischen war der Mann im braunen Anzug in der Schlange ein ganzes Stück weiter gekommen. Nur noch eine Frau stand zwischen ihm und dem Zöllner. Sie musste gerade ihren Koffer öffnen, in den der Beamte neugierig hineinspähte.
Die beiden Männer setzten sich in Bewegung. Sie hatten die Hände in den Taschen vergraben und schlenderten wie Leute, die auf einen Ankömmling warteten, auf den Ausgang zu.
Der Mann im braunen Anzug hatte sie bereits registriert. Seine Lippen verzogen sich unmerklich. Er warf einen raschen Blick über die Schulter, aber er war in der Menge eingekeilt.
Die Frau hatte endlich ihren Koffer wieder geschlossen, schnappte sich ihr Gepäck und ging durch die Sperre. Jetzt war der Mann im braunen Anzug an der Reihe. Er wollte schon durchgehen, aber der Zöllner deutete auf seine Tasche, und mit einem schiefen Grinsen stellte der Mann sie auf den Tresen.
Der Zöllner begann mit einer sehr gründlichen Untersuchung. Er packte alles aus und drehte es hin und her. Aber seine Miene wurde immer länger, und er warf den beiden Männern vor der Sperre einen hilfesuchenden Blick zu. Die reagierten nicht, sondern starrten auf den Passagier im braunen Anzug, dessen Grinsen immer breiter wurde. Schließlich gab der Zöllner auf. Er zog den Reißverschluss der Tasche zu und winkte den Mann weiter.
Als er die Sperre verlassen hatte, stellten sich ihm die beiden anderen in den Weg. Einer zückte einen Ausweis. »Wir möchten Sie bitten, mit uns in unser Büro zu kommen.«
Der Mann im braunen Anzug umklammerte seine Reisetasche fest mit beiden Händen. »Warum? Ich bin gründlich durchsucht worden. Was wollen Sie denn noch von mir? Ich bin jetzt außerhalb des Zollbereichs.«
»Wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie eine größere Menge Rauschgift mit sich führen. Und wir sind sicher, dass wir es bei Ihnen finden werden. Also kommen Sie bitte mit.«
Die Augen des Mannes im braunen Anzug irrten hilfesuchend durch die Gegend. Dann ging plötzlich ein Ruck durch seine Gestalt: »Wie Sie wollen. Wo ist Ihr Büro?«
»Dort drüben.« Der Mann zeigte die Richtung.
Der Mann im braunen Anzug heftete seinen Blick auf eine bestimmte Stelle der riesigen Ankunftshalle. Seine Unsicherheit schien völlig verschwunden zu sein. Er schien sich überhaupt keine Sorgen um sein Schicksal zu machen, was nicht an seinem guten Gewissen lag.
Die Dreiergruppe hatte kaum zehn Schritte zurückgelegt, als es geschah. Von rechts näherte sich ein Mann, der einen hellen Mantel über dem Arm trug. Er ging sehr zielbewusst.
Mit einer plötzlichen Bewegung flog der Mantel zur Seite und rutschte auf den Boden. Der Mann trug eine kurzläufige Maschinenpistole über dem Arm. Er visierte kurz, und dann ratterte die Waffe los. Aus der kurzen Entfernung konnte es keine Fehlschüsse geben.
Die beiden Beamten hatten keine Zeit, nach ihren Waffen zu greifen, als sie schon durch die Einschläge der Geschosse zurückgeworfen wurden. Der neu angekommene Passagier im braunen Anzug streckte noch mit einer sinnlos abwehrenden Bewegung die Hände nach vorn, ehe ihn die Kugeln ebenfalls trafen. In seinen Augen lag ein Ausdruck ungläubigen Staunens, doch die Worte, die er noch sagen wollte, sollte niemand mehr hören.
Noch ehe die drei Männer vollends zu Boden gegangen waren, eilte ein weiterer Mann zu der angeschossenen Gruppe, schnappte sich die Reisetasche mit einem raschen Griff und rannte zum Ausgang.
Der Todesschütze hatte seine Waffe unter der Jacke verschwinden lassen und drängte sich durch die Menge, die noch gar nicht begriffen hatte, was geschehen war. Der Killer schien keine Eile zu haben.
Der ganze Zwischenfall hatte nur Sekunden gedauert. Erst jetzt gellten die ersten Schreie durch die Halle, und Menschen warfen sich zu Boden, während andere fassungslos auf die Getroffenen starrten.
Die Panik brach aus, als die Gangster bereits den Flughafen verlassen hatten.
2. Kapitel
Steve McCoy, erfolgreicher Geheimagent des Department of Social Research, die Tarnbezeichnung einer Organisation, die sich in Wahrheit dem Kampf gegen die organisierte Kriminalität widmete, hatte seine Füße auf die Schreibtischkante gelegt und blätterte in der Morgenzeitung.
Er schüttelte beim Lesen der Überschriften den Kopf. Wenn die Welt so blieb, wie sie war, würde er noch lange Zeit in seinem Beruf tätig sein können.
Steve blätterte weiter. Eine farbige Anzeige einer fernöstlichen Luftlinie weckte kurz sein Interesse, die behauptete, dass sie weich wie Seide sei. Er lächelte und dachte kurz daran, dass ein Urlaub in diesen sonnigen Gegenden auch nicht schlecht sei.
Es war gut, dass er in dieser Sekunde nicht wusste, wie rasch sein Wunsch erfüllt werden würde, nur mit einem kleinen Unterschied. – Es sollte kein Urlaub werden, sondern ein Albtraum.
Noch allerdings war es ein schöner Morgen in Washington. Er hatte gerade einen Fall abgeschlossen und rang noch mit sich, ob er diesen Tag freinehmen sollte. Es war Zeit, in seinem Haus in Brooklyn, das er von seinen Eltern geerbt hatte, nach dem Rechten zu sehen. Ein älteres Ehepaar aus der Nachbarschaft kümmerte sich zwar um das Haus, doch er war längere Zeit nicht mehr auf dem Brooklyner Friedhof gewesen, wo er seine Verlobte vor einigen Jahren an einem regnerischen Tag beerdigt hatte.
Jill war bei einer Auseinandersetzung zwischen Gangstern als Unbeteiligte in einem Restaurant erschossen worden, als Steve ihr gerade den Verlobungsring an den Finger stecken wollte. Seitdem spürte er einen tief sitzenden Hass auf die Kriminellen, die den Tod von Unschuldigen in Kauf nahmen. Ein gewisser Colonel Alec Greene hatte ihn damals aus seiner Verzweiflung gerissen und ihm einen Weg gewiesen, wie er seine Wut auf Verbrecher aller Art in die richtigen Bahnen lenken konnte. Seitdem war er Feldagent des Departments, das dem Justizministerium unterstand und immer noch von Alec Greene geleitet wurde.
Er seufzte. Arbeit im Büro gehörte nicht zu seinen Lieblingsbeschäftigungen, auch wenn er die Notwendigkeit einsah, die neuesten Akten und Erkenntnisse zu studieren, um auf dem Laufenden zu bleiben.
Er schlürfte seinen heißen Kaffee, als das Telefon klingelte.
Er starrte auf den Apparat, der ihn aus seinen Erinnerungen gerissen hatte und ließ ihn erst ein paar Mal klingeln, bevor er den Hörer abnahm und sich meldete.
Wenige Minuten später saß er in Colonel Greenes Büro und hörte sich an, was sein Boss und Mentor ihm zu sagen hatte.
»Steve, es ist Ihnen bestimmt nicht neu, dass in der Politik ein Geben und Nehmen unerlässlich ist. In unserer Position müssen wir häufig Gefallen einfordern, sei es vom Ministerium, vom FBI oder von anderen Diensten. Gelegentlich müssen wir diese Gefallen auch erwidern.«
Jetzt kommt etwas ungewöhnliches, dachte Steve. Mit diesen Anfangsworten hatte er noch nie einen Auftrag erhalten.
»Der Justizminister hat mich persönlich angerufen«, fuhr der Colonel fort. »Er hat einen guten Freund, dem er sehr verpflichtet ist.«
»Mit anderen Worten, der Mann hat für den Wahlkampf des Ministers reichlich gespendet.«
Greene war leicht ungehalten über die Unterbrechung, doch er ging auf die Bemerkung nicht weiter ein. »Der Mann heißt John C. Barwick, und er hat ein Problem, bei dem wir ihm helfen können. Der Minister will keine offizielle Ermittlung durch das FBI oder andere Organisationen, sondern dachte an uns, da wir unter dem Radar operieren können.«
»Welches Problem hat denn Mister Barwick?«
»Das wird er Ihnen selber sagen.« Colonel Greene schob einen Zettel über den Tisch. »Hier ist die Adresse. Setzen Sie sich mit ihm in Verbindung und helfen Sie ihm. Alle Informationen zu dem Fall laufen ausschließlich über mich. Die Sache hat absolute Priorität und Sie bekommen, was immer Sie benötigen.«
Als Steve wieder in seinem eigenen Büro war, dachte er angestrengt darüber nach, wo er den Namen Barwick schon einmal gehört oder gelesen hatte.
Dann wusste Steve plötzlich, wer John C. Barwick war. Ein vielfacher Multimillionär, der in der Politik und Wirtschaft des Landes eine beträchtliche Rolle spielte. Das heißt: gespielt hatte. Heute hatte er sich ziemlich zurückgezogen. Aber man wusste, wie das bei solchen Leuten war. Sie gingen nie wirklich in den Ruhestand.
Steve holte sich eines seiner Nachschlagewerke über bedeutende Persönlichkeiten aus dem Bücheregal und sah nach. Barwick stand drin, aber nur mit wenigen Zeilen, die praktisch nichts aussagten. Immerhin konnte man sein Alter entnehmen. Er war verwitwet und weit über sechzig. Und er hatte einen Sohn.
3. Kapitel
Das Büro war nicht so prächtig eingerichtet, wie Steve vermutet hatte. Der Millionär schien einen einfacheren Lebensstil vorzuziehen. Aber das konnte auch nur Tarnung sein.
Barwick hatte eisengraue Haare und dunkle Augen unter buschigen Brauen. Sein Blick strahlte eine seltsame Faszination aus, und an seinen ganzen Bewegungen merkte man, dass er es ein Leben lang gewohnt war, Befehle zu erteilen und Widerspruch nicht zu dulden.
»Setzen Sie sich!« Barwick deutete auf einen Sessel vor dem Schreibtisch.
Steve McCoy nickte und nahm Platz. Dann wartete er darauf, wie es weitergehen sollte.
Barwick öffnete einen Umschlag, zog ein Bild heraus und schob es über den Tisch. »Sehen Sie sich das Foto an.«
Steve studierte das Bild. Es zeigte einen männlichen Weißen von knapp dreißig Jahren, der offensichtlich tot war. Er trug einen braunen Anzug, in dem man deutlich mehrere Einschusslöcher erkennen konnte.
Steve gab das Bild zurück. »Ich habe den Mann noch nie gesehen, falls es das ist, was Sie wissen wollen.«
Barwick winkte ab. »Ich weiß, wer das ist.« In seinen Augen war ein merkwürdiger Ausdruck von Trauer. »Dieser Mann war als Kurier für eine Drogenlinie beschäftigt, und außerdem …«
Steve beugte sich vor. »Was außerdem?«
Barwick blickte zur Seite. »Er war mein Sohn«, sagte er leise.
»Wer hat ihn erschossen?«
»Vermutlich die Gangster, für die er arbeitete. Er hatte gegen die Killer keine Chance.«
Steve McCoy schwieg einen Moment. Er konnte gut nachfühlen, wie es dem Mann ergehen musste, der seinen Sohn verloren hatte. Die Erinnerung an die tote Jill stieg schmerzhaft in ihm hoch.
Barwick starrte auf die Tischplatte. Seine Augen glänzten feucht. Er schien jedoch genau zu wissen, dass sein Sohn gegen Gesetze verstoßen hatte.
»Erzählen Sie mir zunächst, was genau passiert ist«, sagte Steve.
Barwick sah Steve beim Sprechen nicht an. »Zwei Beamte der Drug Enforcement Administration haben meinen Sohn am Flughafen erwartet. Es hieß, dass er ein bis zwei Kilo Heroin bei sich haben sollte. Als die Männer meinen Sohn in ihr Büro bringen wollten, tauchte plötzlich wie aus dem Nichts ein Mann auf und schoss alle drei mit einer Maschinenpistole zusammen. Ein zweiter Gangster nahm die Reisetasche an sich, die mein Sohn bei sich hatte. Die Angreifer konnten unbehelligt entkommen.«
»Was ist mit den beiden Beamten geschehen?«
»Einer ist so schwer verletzt, dass die Ärzte keine Hoffnung mehr haben. Der andere muss noch ein paar Wochen im Krankenhaus liegen. Von ihm kommen die wichtigsten Informationen. Vor allen Dingen eine: Er hat uns ein Phantombild des Schützen geliefert.«
»Uns?«, fragte Steve scharf.
Barwick lächelte schwach. »Ich meine natürlich die Polizei. Aber Sie können davon ausgehen, dass ich eine Menge Freunde bei den einschlägigen Behörden habe. Sie schlagen mir selten einen Wunsch ab – und sie haben Verständnis dafür, dass ich den Tod meines Sohnes aufklären will.«
Steve McCoy nickte. »Ich verstehe.« Bei den Verbindungen des Millionärs war es in der Tat kein Problem, an die notwendigen Informationen heranzukommen.
»Wer war der Schütze?«
Barwick schob ein zweites Bild über den Tisch. Es war ziemlich unscharf und zeigte ein verschwommenes Gesicht hinter einer Sonnenbrille. Der Mann mochte knapp über dreißig sein. Sein Mund wirkte wie ein schmaler Strich, und die hochstehenden Wangenknochen gaben ihm ein slawisches Aussehen. »Ich konnte nur dieses Bild bekommen. In den Archiven der Polizei und des FBI gibt es kein besseres Bild dieses Mannes, der nach dem Phantombild identifiziert wurde.«
»Wer ist der Mann?«
»Sein Name ist Brian Kent. Er ist Engländer und Profikiller. Er gilt in Fachkreisen als Spezialist für schwierige Sachen. Er ist sehr teuer, aber auch sehr erfolgreich, wenn man bei dieser Arbeit von Erfolg sprechen kann. Die Polizeidienststellen verschiedener Länder haben dicke Akten über ihn angelegt, können ihn aber nicht überführen. Kent arbeitet international. Man macht ihn für eine ganze Reihe von Morden verantwortlich, hat aber keine Beweise. Er hat den Ruf, dass er jeden tötet, der ihm gefährlich wird. Vielleicht war dies auch ein Grund, der ihn der Mafia sympathisch machte. Meine Verbindungsleute bei den Behörden sind ziemlich sicher, dass er für diese Verbrecherorganisation arbeitet, und zwar für eine New Yorker Familie, einen gewissen Robert Lucas, der zurzeit allerdings in Untersuchungshaft sitzt.«
Steve McCoy nickte. »Das wäre also die erste Spur. Und nun erzählen Sie mir etwas über Ihren Sohn.«
Barwicks Gesicht verfinsterte sich. Er sprach leise. »Ich habe mich zu wenig um den Jungen gekümmert. Meine Frau ist vor vielen Jahren gestorben, und ich habe mich in die Geschäfte gestürzt. Als ich merkte, wie weit ich mich von meinem Sohn entfernt hatte, war es schon zu spät. Er hatte sich anderen Kreisen angeschlossen. Er bekam von mir Geld – nicht allzu viel, aber ausreichend. Ich habe ihm außerdem eine Wohnung finanziert und einen Wagen. Jahrelang dachte ich, dass dies ausreichend sei, und ich glaubte ihm, dass er sich künstlerisch verwirklichen wolle. Ich fragte ihn nie, wie weit er gekommen ist. Vielleicht habe ich geglaubt, dass er genauso sei wie ich, und dass er seinen Weg schon machen würde.«
»Aber dann geriet er in schlechte Gesellschaft«, unterbrach Steve McCoy, der ähnliche Schicksale zur Genüge kannte.
»Ja. Er wurde rauschgiftsüchtig. Auch das habe ich zu spät bemerkt. Wir haben uns nicht sehr häufig gesehen. Lange Zeit dachte ich, es sei harmlos. Aber es wurde immer schlimmer. Die Gangster machten meinen Sohn bewusst süchtig, um ihn abhängig zu machen.«
»Ich kenne solche Fälle. Wie ging es weiter?«
»Irgendwann übernahm mein Sohn Kurierdienste für die Gangster. Heute weiß ich, dass es für die Organisation dieses New Yorker Mafiabosses war, doch leider fehlen die Beweise. Mein Sohn hatte offensichtlich die Route Bangkok–New York. Er nahm unterschiedliche Flugverbindungen, meistens die östliche Route über Hongkong nach San Francisco, seltener die westliche Verbindung über London nach New York. Die Fluggesellschaften waren unterschiedlich. Offenbar wurde er von den Gangstern überwacht, und als sie am Schluss der letzten Reise merkten, dass mein Sohn von den Beamten angehalten wurde, haben sie ihn einfach umgelegt.«
»Wer hat der Behörde den Tipp gegeben, dass Ihr Sohn Rauschgift schmuggelt?«
Barwick erstickte fast an seinen Worten. »Ich. Ich war es! Ich wollte nur, dass er mit diesem Job aufhört. Ich bin damit auch schuld an seinem Tod, und ich will jetzt wenigstens versuchen, die Gangster zu stellen, die meinen Sohn auf dem Gewissen haben. Ich kann es nicht selbst, dazu bin ich zu alt. Aber Sie können es! Und deswegen müssen Sie diesen Auftrag auch übernehmen. Ihr Boss hat mir versichert, dass Sie dafür der beste Mann sind.«
»Wenn Ihr Sohn aus Bangkok kam, stammt das Heroin vermutlich aus dem Goldenen Dreieck.«
Barwick nickte. »Das Grenzgebiet zwischen Burma, Laos und Thailand ist das größte Opiumanbaugebiet der Welt, und niemand konnte bisher etwas gegen den stetigen Strom von Drogen tun, die in unser Land geschmuggelt werden. Gehen Sie hin und versuchen Sie, diesen Zustand zu ändern!«
Steve lächelte. »Nicht gerade eine leichte Aufgabe.«
»Denken Sie an die Mädchen in Thailand. Man hört in dieser Beziehung doch einiges!«
Steve schüttelte den Kopf. »Wo ich hingehe, wird es keine Mädchen geben, sondern nur Schlangen, Moskitos, Staub, Hitze und feindliche Bergstämme.«
Barwick sah Steve McCoy an. »Wahrscheinlich stoßen Sie auch noch auf ein paar vertraute Gestalten aus der amerikanischen Unterwelt. Sie werden sich rasch heimisch fühlen.«
»Entzückende Aussichten«, sagte Steve. »Gibt es sonst noch etwas, was ich wissen müsste?«
»Denken Sie an Brian Kent, den englischen Killer. Meine Informanten sind der Ansicht, dass er sich ebenfalls in den Fernen Osten begeben wird. Sobald ich Näheres erfahre, werden Sie es wissen.«
»Wie halten wir Verbindung miteinander?«, fragte Steve McCoy.
»Meine Sekretärin hat alles vorbereitet. Sie werden nachher einen dicken Umschlag erhalten, in dem alles drin ist: Geld, Flugtickets, Hotelreservierungen, bekannte Adressen und so weiter.«
Steve blickte den Millionär fest an. »Sie waren sich wohl sicher, Mister Barwick, dass nur eine Zusage in Frage kommen würde?«
Sein neuer Auftraggeber nickte ungerührt. »Ja. Im Übrigen habe ich noch etwas für Sie, nämlich eine Unterstützung. In Chiang Mai, das ist eine Stadt im nördlichen Thailand, werden Sie einen Kontaktmann treffen, den mir meine Freunde vom Geheimdienst empfohlen haben. Der Mann heißt Kamol Songgram und hat einen Motorradverleih in der Changklan Road. Er kennt sich im Rauschgiftgeschäft bestens aus und kann Ihnen sicher helfen. Bezahlen Sie ihn gut.«
»Mal sehen, ob ich ihn brauche.«
Barwick ging darüber hinweg. »Ohne die Unterstützung korrupter Politiker und Militärs ist der ausgedehnte Rauschgifthandel nicht möglich. Achten Sie also darauf, dass Sie keinem hohen Tier auf die Zehen treten. Auch die Bergstämme werden nicht glücklich sein, wenn sich jemand um ihre Geschäfte kümmert. Sie leben vom Opium. Und dann gibt es noch die Chinesen.«
»Rotchina ist weit weg. Ich habe nicht die Absicht, mich in die Nähe dieser Grenze zu begeben.«
»Ich rede nicht von den Rotchinesen«, sagte Barwick leise.
Steve sah ihn fragend an, dann dämmerte eine Erinnerung. »Wollen Sie behaupten, dass die ehemaligen Kuomintang-Gruppen immer noch im Goldenen Dreieck sitzen und den Opiumhandel kontrollieren?«
»Bisher hat sie niemand dort vertrieben. Sie sind gut organisiert und hervorragend bewaffnet. Die alten Soldaten haben die neue Generation gut erzogen. Sie sitzen in ihren Dörfern und beherrschen das ganze Gebiet. Ohne ihre Erlaubnis kommt niemand hinein.«
»Sehr tröstliche Aussichten«, bemerkte Steve sarkastisch. »Unter all diesen netten Menschen soll ich die herausfinden, die den Tod Ihres Sohnes auf dem Gewissen haben.«
Barwick ballte die Hände zu Fäusten. »Mehr als das. Sie sollen diesen Gangstern das Handwerk legen. Zerstören Sie die ganze Organisation. Machen Sie den Kerlen das Geschäft kaputt!«
»Bisschen viel für einen einzelnen Menschen.«
Barwick starrte ihn an. »Sie müssen es schaffen«, flüsterte er. »Ich weiß auch, dass niemand meinen Sohn zurückholen kann, aber ich will verhindern, dass es noch mehr Väter gibt, die ihre Söhne unter solchen Umständen verlieren. Ich möchte mein restliches Leben diesem Kampf widmen. Dafür lohnt es sich, mein Geld auszugeben.«
4. Kapitel
Der kleine dunkelhäutige Mann hatte ein mongolisches Aussehen. Er sprach gebrochen englisch, und er gehörte dem Stamm der Akhas an, die im nördlichen Grenzgebiet Thailands lebten.
Er zupfte den Amerikaner am Ärmel, der ihm brummend folgte. Die Hitze war drückend. Schwärme von Moskitos umschwirrten den Amerikaner, dem der Schweiß in breiten Bahnen über den Körper rann.
»Ich zeige Ihnen!«, rief der kleine Mann und lief leichtfüßig durch den Dschungel. Mit einer Machete hieb er ab und zu einen Bambusstamm zur Seite, damit der Amerikaner ihm folgen konnte.
Die Augen des Amerikaners musterten misstrauisch die Umgebung. Nicht, dass er einen Feind fürchtete. Aber er hatte Angst vor Schlangen, und er wusste, dass es hier welche gab.
Manchmal fragte sich der Amerikaner, was er in diesem gottverdammten Dschungel eigentlich zu suchen hatte, aber dann besänftigte ihn jedes Mal die Aussicht auf die hohe Bezahlung. Er wusste, dass seine Arbeitgeber Gangster waren, aber das störte ihn nicht sonderlich.
Sie hatten ihn ausgesucht, weil er sich hier auskannte. Er beherrschte sogar ein paar Brocken der örtlichen Dialekte. Als es den Krieg in Vietnam noch gab, war er ein wichtiger Mann gewesen. Sondereinsätze nannte man die Aufträge, die ihn weit hinter die feindlichen Linien geführt hatten. Die Bergstämme sollte er aufwiegeln, sie ausrüsten und an modernen Waffen ausbilden.
Damals war die Agency sein Auftraggeber gewesen. Sie hatten geglaubt, mit diesen Methoden den Krieg zu gewinnen. Der Amerikaner machte ein bitteres Gesicht. Sie hatten es nur geschafft, ihn zugrunde zu richten. Ihn und die anderen Verlorenen, die irgendwo im Dschungel hockten und um die sich keiner mehr kümmerte, als alles in die Brüche ging.
Er hatte überlebt! Das war das Wichtigste. Seitdem wusste er das Opium zu schätzen. Die Einheimischen rauchten es wie Zigaretten. Zehn Pfeifen schon zum Frühstück waren keine Seltenheit.
Er war zum Spezialisten für Opium geworden. Es hatte sich rasch bis zu ihm herumgesprochen, dass man eines Tages einen solchen Spezialisten brauchte, der keine überflüssigen Fragen stellte. Er hatte seine Kontakte bis nach Bangkok ausgedehnt, seitdem er sich nach Thailand zurückgezogen hatte. Meistens lebte er im Dschungel. Zwei- oder dreimal im Monat fuhr er nach Chiang Mai, nahm sich ein Mädchen und besoff sich ausgiebig.
Es war nicht gerade das Leben, das er sich vorgestellt hatte, als er noch in Wisconsin auf die Schule ging. Aber andererseits lag diese Zeit so lange zurück, dass er sich kaum noch daran erinnern konnte. Es fiel ihm schon schwer, seinen Namen zu behalten, nachdem er jahrelang nur unter Decknamen gelebt hatte.
Hier nannten ihn alle nur Charlie. So hatten sie früher den Vietcong genannt. Er wusste nicht, ob es deshalb war.
Sein eigentlicher Name lautete Ronald Meade, aber das spielte eigentlich keine Rolle. Es ging auch niemanden was an.
Der Dschungel wurde lichter. Charlie blinzelte nach oben in den Himmel. Zwischen den hoch aufragenden Teakholzstämmen mit ihren riesigen Blättern wurde immer mehr Blau sichtbar. Banyanbäume mit ihren zahllosen Luftwurzeln spendeten unter ihrem dichten Blätterdach Schatten.
Eine große Eidechse huschte über den Weg, und für einen winzigen Augenblick erschrak er. Der Eingeborene drehte sich um und winkte ihm. »Wir gleich da«, gab er bekannt.
Der Amerikaner nickte nur müde. Er wusste, dass Zeit- und Ortsangaben hier nicht so genau zu nehmen waren. Gleich – das konnte alles Mögliche bedeuten. Eine Stunde oder zwei – oder nur hundert Meter. Man musste Geduld haben. Es war auch sinnlos, sich aufzuregen.
Der Weg senkte sich abwärts. Der Amerikaner erkannte tatsächlich weiter vorn den Rand des Dschungels.
Sekunden später trat er zögernd ins Freie. Vor seinen Augen wiegten sich Mohnpflanzen in endloser Reihe. Ein ganzes Tal voller Mohn. Drüben, auf der anderen Seite, begann wieder der übliche Dschungel. Ein unbekannter Vogel schrie.
Der Amerikaner hob den Kopf. Über dem dunklen Waldrand wuchsen dunstige Berghänge empor. Sie mussten bereits auf burmesischem Gebiet liegen. Egal – Grenzen besaßen für diese Leute hier keine Bedeutung.
Der Amerikaner schlug nach einem Moskito, der sich auf seinem Arm niedergelassen hatte, und blickte zu dem Akha, der jetzt ein spezielles Messer aus dem Gürtel zog. Es besaß drei kleine, parallel verlaufende Klingen. Er nahm eine Mohnkapsel in die linke Hand, setzte das Messer an und schnitt die Kapsel mit einer oft geübten Bewegung auf.
Fast augenblicklich quoll eine weiße, zähe Flüssigkeit aus der Kapsel. Der Eingeborene prüfte sie mit dem Finger. »Morgen«, sagte er. »Morgen ist Ernte. Gute Ernte.«
Der Amerikaner nickte gleichgültig.
Der Akha prüfte eine weitere Kapsel und deutete dann mit einer ausholenden Bewegung über das Mohnfeld. »Viel Opium«, sagte er.
Der Amerikaner nickte. »Okay, wir kaufen das Zeug. Gehen wir ins Dorf zurück, damit wir die Einzelheiten besprechen können. Über den Preis gibt es noch ein paar Worte zu sagen.«
»Guter Preis«, meinte der Eingeborene.
Charlie grinste. »Bringt erst mal die Ernte ein, ehe ihr sie verkauft.«
5. Kapitel
Robert Lucas genoss im Untersuchungsgefängnis eine ganze Reihe von Vorrechten. Die anderen Häftlinge wussten, wer er war, und sie wussten auch, dass man sich besser nicht mit ihm anlegte. Ein Mafiaboss war auch als Gefangener gefährlich. Seine Verbindungen reichten immer noch weit, und er besaß genügend Macht, über Tod und Leben zu entscheiden.
Auch die Wächter behandelten Robert Lucas höflich und zuvorkommend. Man konnte nie wissen, wozu es gut war.
Lucas’ Zellentür war nur nachts verschlossen. Ansonsten herrschte bei ihm ein reges Kommen und Gehen. Er hörte sich Klagen und Beschwerden von Häftlingen an, die er anschließend schlichtete, denn er war hier die größte Autorität. Er erließ seine Anweisungen und konnte sich darauf verlassen, dass sie auch nach draußen gelangten. Seine Geschäfte liefen weiter wie eh und je.
Sein wichtigster Kontaktmann war sein Anwalt, der schon lange in den Diensten der Familie stand. Er war nicht nur Rechtsberater, sondern erfüllte noch eine Reihe weiterer Funktionen, wie es dem sogenannten »Consigliere« einer Familie zustand.
Lucas vertraute ihm. Wenn er es recht überlegte, war dies der einzige Mensch, dem er vertraute. Aber das störte ihn nicht weiter, denn mit dieser Methode war er bisher gut gefahren. Es war besser, sich nicht in anderer Leute Hand zu begeben.
Sie saßen im Besucherraum, wo sie ungestört waren. Noch nicht einmal ein Wächter hielt sich hier auf. Lucas galt schließlich nicht als Ausbrecherkandidat, und was er mit seinem Anwalt zu besprechen hatte, ging niemanden etwas an.
Robert Lucas nahm einen tiefen Zug aus der Zigarre und blies den blauen Rauch in die Luft. »Wie ist die Lage?«
Luigi Belloni, sein Anwalt, lächelte leicht. Er nahm seine Brille ab und polierte die Gläser. »Die Staatsanwaltschaft bereitet immer noch die Anklageschrift vor, aber wir haben gute Chancen, einige der Punkte auszuräumen. Es wird nicht sehr viel übrig bleiben. Unglücklicherweise hat damals die Gegenseite einige Beweisstücke in die Hand bekommen, die nur schwer zu entkräften sind.«
Belloni zuckte die Schultern. »Jammern hilft uns da nichts. Wir müssen uns mit der Justiz auseinandersetzen. Wir werden sicher einige Zeugen herbeischaffen können, die Sie entlasten, trotzdem wird einiges hängen bleiben. Ein paar Jährchen können es schon werden.«
Robert Lucas lief rot an. »Wozu bezahle ich dich eigentlich, Luigi? Du sollst dafür sorgen, dass ich bald hier rauskomme!«
Belloni machte ein unglückliches Gesicht. »Ich würde mir nichts anderes wünschen, doch so einfach wird es nicht gehen. Die andere Seite hat zu viel in der Hand. Es sind schriftliche Beweise, keine Zeugen, die wir möglicherweise beeinflussen könnten.«
»Na schön«, beruhigte sich Robert Lucas. »Reden wir von den Geschäften, wenn es in dieser Beziehung nichts Erfreulicheres gibt.«
Bellonis Gesicht hellte sich auf. »Die Geschäfte laufen gut. Ich habe Nachrichten aus Fernost bekommen, wonach jetzt eine größere Lieferung vorbereitet wird. Unsere Kontaktleute in Bangkok warten auf die neue Ernte im Norden. Wir haben einen guten Mann vor Ort, der sich mit den Bergstämmen gut auskennt. Er spricht sogar ihren Dialekt. Er wird dafür sorgen, dass es bei den Lieferanten keine Probleme gibt.«
»Und was machen die Chinesen?«, warf Robert Lucas ein.
»Sie werden gut bezahlt. Sie leben schließlich vom Verkauf des Opiums. Sie erhalten ihre Prozente und geben uns dafür sogar einen gewissen Schutz, zumindest solange das Zeug in ihrem Bereich ist. Sobald sich die Ladung auf dem Fluss befindet, sind wir selbst dafür verantwortlich.«
Robert Lucas legte die dicken Fingerspitzen gegeneinander. »Wer könnte uns dann noch Schwierigkeiten machen?«
»Die Regierung natürlich, oder das Militär. Wir haben unsere Verbindungen. Die entsprechenden Leute werden gut geschmiert, sodass sie nichts hören oder sehen werden. Korruption hat eine lange Tradition in diesem Land. Es kostet nicht allzu viel.«
Robert Lucas nickte. »Wo wird der Stoff verarbeitet?«
»Es gibt Dschungellabors, aber ihre Qualität ist nicht besonders, und es kommt schon mal vor, dass ein solches Labor in die Luft fliegt. Wir haben uns entschlossen, die Verarbeitung in einer größeren Stadt durchzuführen. Es ist einfacher und leichter zu kontrollieren.«
»Gut. Wie kommt der Stoff dann in die Staaten?«
Belloni blickte zu Boden. »Das hat bisher immer gut funktioniert. Wir hatten einen Kurier, der zwischen Bangkok und New York oder San Francisco hin und her pendelte. Beim letzten Mal haben die Bullen auf unseren Mann gewartet. Glücklicherweise hatten wir noch eine letzte Sicherung eingebaut. Wir konnten ihn ausschalten und den Stoff sicherstellen.«
Robert Lucas runzelte die Stirn. »Ist er tot?«
»Ja, und die beiden Sicherheitsbeamten hat es auch erwischt. Unsere Leute konnten unerkannt entkommen, nachdem sie sich die Tasche mit dem Stoff geschnappt hatten. Die Gegenseite hat also immer noch keine Ahnung. Sie haben weder Informationen noch den Stoff.«
Robert Lucas erhob sich von dem harten Gefängnisstuhl und wanderte mit auf dem Rücken verschränkten Armen durch den Raum. »Das gefällt mir alles nicht besonders. Durch diesen Zwischenfall haben wir die Gegenseite erst recht aufmerksam gemacht. Sie wissen jetzt, dass sie es mit einer größeren Organisation zu tun haben. Sie werden den Fall nicht auf sich beruhen lassen. Und wenn wir großes Pech haben, setzen sie auch noch weitere Leute auf uns an.«
»Wir haben einen guten Mann im Einsatz«, wandte Belloni ein. »Sie wissen schon, dieser Engländer. Er hat auch den Kurier erledigt, bevor er das Maul aufmachen konnte.«
Robert Lucas nickte. »Brian Kent. Ich habe ihn selbst engagiert. Er ist ein guter Mann, aber nicht gerade billig. Und ich weiß nicht, wie zuverlässig er im Notfall ist. Schließlich ist er nichts anderes als ein Söldner, der sich an den Meistbietenden verkauft. Er darf nicht zu viel über unsere Organisation erfahren. Gebt ihm fest umrissene Aufträge und achtet darauf, dass er sie auch erfüllt.«
»Ich habe daran gedacht, ihn nach Thailand zu schicken, damit er dort nach dem Rechten sehen kann. Wir haben drüben eigentlich keinen Mann unseres vollen Vertrauens. Kent wäre genau der Richtige. Außerdem ziehen wir ihn hier aus der Schusslinie, falls es doch einen Verdacht gegen ihn geben sollte.«
»Das ist eine gute Idee. Er soll sich bald auf den Weg machen. Wie hast du dir nach dem Ausfall des Kuriers den Transport über den großen Teich vorgestellt?