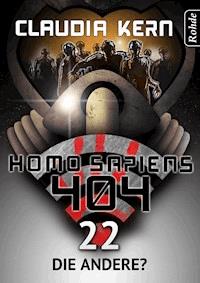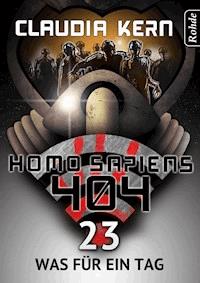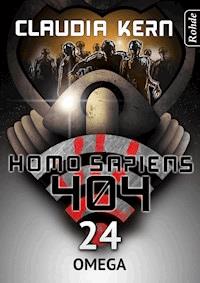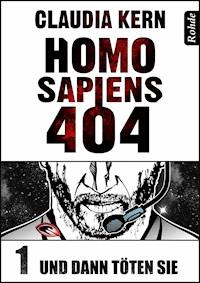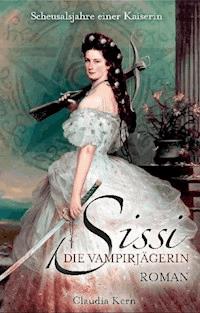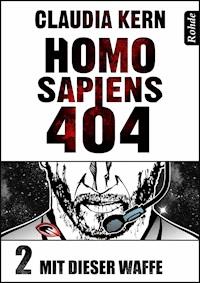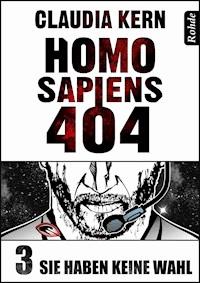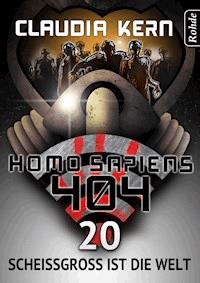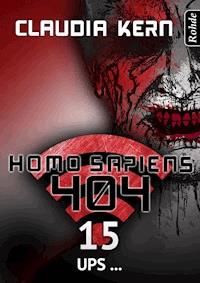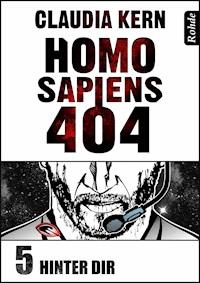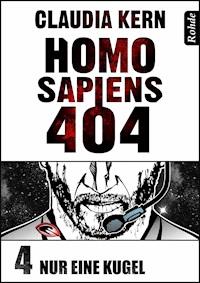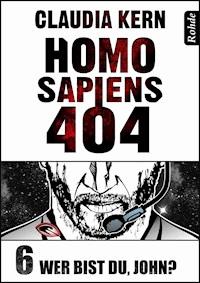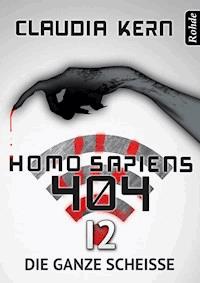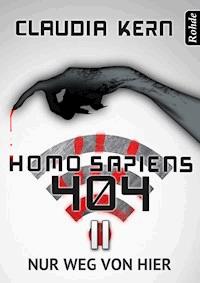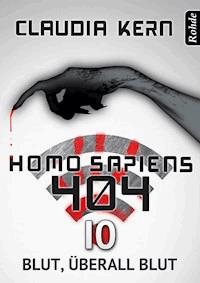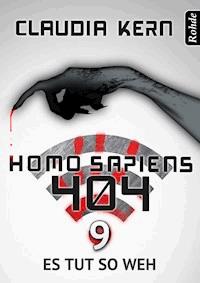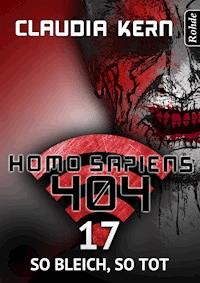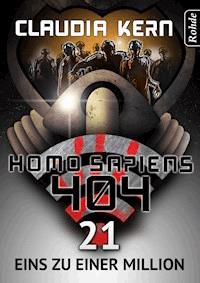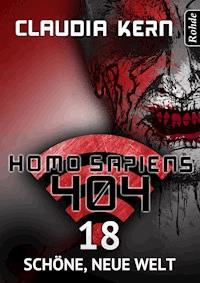
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rohde, Markus
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Homo Sapiens 404
- Sprache: Deutsch
Dies ist die 18. Episode der Romanserie "Homo Sapiens 404". Internet! Zum ersten Mal seit der Landung auf der Erde können Kipling und Ama'Ru Kontakt zur Welt jenseits der kleinen Kolonie aufnehmen. Doch was sie dabei erfahren, schockiert sie. Rin und Arnest versuchen währenddessen, mit der schwierigen, neuen Lage irgendwie klarzukommen. Und in den Tiefen des Alls, auf einer Station namens Scania, kommt es zu einer dramatischen Konfrontation. Über die Serie: Einige Jahrzehnte in der Zukunft: Dank außerirdischer Technologie hat die Menschheit den Sprung zu den Sternen geschafft und das Sonnensystem kolonisiert. Doch die Reise endet in einer Katastrophe. Auf der Erde bricht ein Virus aus, der Menschen in mordgierige Zombies verwandelt. Daraufhin riegeln die Außerirdischen das Sonnensystem ab und überlassen die Menschen dort ihrem Schicksal. Die, die entkommen konnten, werden zu Nomaden in einem ihnen fremden Universum, verachtet und gedemütigt von den Außerirdischen, ohne Ziel, ohne Hoffnung. Neue Folgen der dritten Staffel erscheinen vierwöchentlich als E-Book. Dies ist die letzte Episode der dritten Staffel (13-18). Weiter geht es am 19.1.2015.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Episode 18
Schöne neue Welt
Claudia Kern
Digitale Originalausgabe
Homo Sapiens 404 wird herausgegeben vom Rohde Verlag
Rohde Verlag, Uhlandstr. 35a, 53757 Sankt Augustin
Verleger & Redaktion: Markus Rohde
Autorin: Claudia Kern
Lektorat: Katrin Aust
Covermotiv & -gestaltung: Sebastian Lorenz
Copyright © 2014 by Rohde Verlag
ISBN 978-3-95662-030-0
www.claudia-kern.com
www.helden-in-serie.de
www.rohde-verlag.de
Inhalt
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Die Autorin
Lesetipps des Verlags
»Wie fühlt es sich an, ein Jockey zu sein? Ich weiß, dass ich die Frage schon mal gestellt habe, aber sie lässt mich nicht los. Ist das Tier unter dem Jockey ein eigenständiges Lebewesen, das von ihm unterdrückt wird? Fährt er in das Tier wie der Teufel aus Der Exorzist in Linda Blair (nur ohne das Herumgeschreie und Gekotze)? Oder ist das Tier nur ein Fortsatz seiner selbst mit ebenso wenig Bewusstsein wie eine Zehe oder ein Ellenbogen? Ich kann jeden verstehen, dem diese Fragen egal sind, aber für mich sind sie essentiell, denn sie definieren die Kultur der Jockeys. Basiert sie auf Unterdrückung oder auf friedlicher Koexistenz? Und wenn die Antwort Unterdrückung lauten sollte, wie könnten wir dann erwarten, von ihnen mit Respekt behandelt zu werden? Ihre gesamte Existenz würde auf der Versklavung anderer basieren. Sie wären tatsächlich und zutiefst böse. Und wir würden einen Exorzisten brauchen, der uns rettet.«
– Nerdprediger Dan, ASCII-Zeichen für die Ewigkeit
Was bisher geschah
»Barbie hat versucht, mir einzureden, dass der Albaner schwach sei und ich ihn töten sollte, so lange es noch geht. Aber er hat sich fast vollständig von seiner Verletzung erholt und ist verrückter denn je. Ich weiß nicht, weshalb sie wollte, dass ich ihn angreife. Nur eines ist klar: Die zweite Generation ist nicht so naiv, wie ich dachte. Zumindest Barbie versteckt hinter ihrem scheinbar blinden Gehorsam eigene Pläne, wie auch immer diese aussehen mögen. Ach ja, das Internet funktioniert wieder, leider auf den alten Geheimfrequenzen von Better Life Solutions. Das bedeutet, der Albaner braucht mich nicht mehr, um Brown zu kontaktieren. Das könnte sich negativ auf meine Lebenserwartung auswirken.«
– Auckland
»Der Jockey, der Lanzo übernommen hat, heißt Jho’tol ne Thrigne, aber wir nennen ihn Joe. Er glaubt, dass er Lanzo vollkommen beherrscht, bemerkt jedoch nicht, dass er ab und zu die Kontrolle verliert. Dann kann Lanzo frei handeln, wenn auch nur kurz. Wir haben beide zu Bob Swanson und Daniel Messner auf die Destination Moon gebracht. Und jetzt sitzen wir dort fest. Wir brauchen Ama’Rus Hilfe, doch der Komplex, in dem sie und Kipling zusammen mit Gonzales und ihren Anhängern untergebracht sind, wird schwer bewacht. Wir denken darüber nach, mit einem kleinen Schiff in der Nähe zu landen.«
– Rin
»Okay, ich habe einen Menschen umgebracht. Zum ersten Mal. Und zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich wollte einen Zombie unten im geheimen Stockwerk des BLS-Gebäudes erschießen und wusste nicht, dass er nicht allein war. Aber ja, das ist so, als würde ich sagen: ›Hey, ich wollte doch nur den USB-Stick formatieren. Keine Ahnung, wieso deine Festplatte leer ist‹. Ich hab Scheiße gebaut und dafür musste jemand mit dem Leben bezahlen. Wenigstens haben wir jetzt Internet. #kleinertrost«
– Kipling
Kapitel Eins
Sie nannten ihn Joe. Jho’tol ne Thrigne hasste den Namen, aber er ließ sie gewähren. Den primitiven Schläger schien es zu amüsieren, ihn mit »Joe« anzusprechen, und Jho’tol hatte längst erkannt, dass sein eigenes Wohlbefinden unmittelbar von Arnests Laune abhing.
Er trat an die Gitterstäbe seiner Zelle und blickte in den Gang. Die Menschen hatten ihn hierhergebracht, um ungestört reden zu können. Er vermutete, dass sich die Unterhaltung hauptsächlich um ihn drehen würde.
Und um die Frage, wie sie den, den sie an mich verloren haben, retten können. Jho’tol legte seine großen Hände um die Metallstäbe. Er kannte die Fähigkeiten seines Körpers noch nicht und auch nicht dessen Grenzen. Zu kurz erst waren sie vereint. Doch er spürte, wie der Hunger ihn schwächte, wie die Klarheit seiner Gedanken darunter litt und er sich kaum noch auf etwas anderes als die schmerzende Leere in seinem Magen konzentrieren konnte.
Warum esse ich nicht? Die Antwort auf diese Frage verschloss sich ihm. Er erwog den Gedanken, dass die Menschen ihm absichtlich Nahrung angeboten hatten, die unverdaulich war. Vielleicht wollten sie ihn verhungern lassen, in der Hoffnung, dass der alte Teil seines Körpers zuerst sterben und den neuen freigeben würde. Sie wissen nichts über uns.
Die Tür zum Zellentrakt öffnete sich. Jho’tol hörte Schritte und einen Moment später tauchte die menschliche Frau – Rin? Es war so schwer, sich Menschennamen zu merken – auf. Sie hielt ein abgedecktes Tablett in den Händen. Als er den Essensgeruch wahrnahm, sog er tief die Luft ein. Speichel sammelte sich in seinem Mund und er musste mehrfach schlucken, um nicht zu sabbern. Noch nie in seinem Leben war er so hungrig gewesen.
»Geh zum Bett und setz dich hin«, sagte Rin.
Jho’tol blieb stehen. »Warum?« Er konnte den Blick kaum von dem Tablett abwenden, das Rin nun auf einer Hand balancierte, während sie die zweite auf das Touchpad neben der Tür legte.
»Willst du essen oder nicht?«
Er zögerte, doch dann drehte er sich um, setzte sich steif aufs Bett und legte die Hände auf die Oberschenkel. Es erstaunte ihn immer noch, wie warm sein Körper war – und wie behaart. Die kleinen Haare auf seinen Handrücken und Unterarmen kitzelten, wenn die Brise der Klimaanlage sie streifte. Er hatte noch nie Haare gehabt und war sich nicht sicher, ob ihm die Veränderung gefiel.
Rin öffnete die Zellentür, stellte das Tablett auf den Boden und schloss sie von außen wieder. Die ganze Zeit über ließ sie Jho’tol nicht aus den Augen.
»Hast du Angst vor mir?« Er lächelte nicht. Lächeln war eine menschliche Geste, keine seines Volks. Sieger übernahmen nicht die Kultur der Verlierer. Gelegentlich ertappte er sich dabei, wie er seine eigene Regel brach, doch im Allgemeinen hielt er sich daran.
Rin hob die Schultern. »Ich weiß, zu was Lanzo in der Lage ist, du vielleicht nicht. Du sitzt noch nicht lange auf ihm, oder?«
Jho’tol antwortete nicht. Er stand auf, um Rins Erlaubnis zuvorzukommen, und nahm das Tablett. Es war schwer. Der Geruch, der davon aufstieg, raubte ihm fast den Verstand.
Er setzte sich aufs Bett und entfernte die Abdeckung mit zitternden Fingern. Darunter sah er einen Teller, auf dem ein großes, dunkel gebratenes Stück Fleisch lag, irgendwelche gelbbräunlichen Scheiben und grüne Pflanzenstängel.
Am liebsten hätte er sich alles mit bloßen Händen in den Mund gestopft, aber er riss sich zusammen. »Was ist das?«
»Wahrscheinlich eines der letzten Rindersteaks im Universum, aus Bob Swansons persönlicher Tiefkühltruhe, Bratkartoffeln mit Zwiebeln und grüne Bohnen, beides aus den Gärten der Moon. Iss, bevor alles kalt wird.«
»Das ist Nahrung für Menschen?«
»Wenn wir sie kriegen können.«
Jho’tol wollte nach Messer und Gabel greifen. Seine Hände bewegten sich nicht. Er versuchte es noch einmal und sah, wie sich seine Finger in die Oberschenkel krallten, bis es schmerzte. Der Anblick war unheimlich und fremd. Auf einmal fühlte er sich in seinem Körper gefangen.
»Du musst etwas essen, Lanzo«, sagte Rin. »Du kannst ihn nicht töten, ohne selbst zu sterben.«
»Du redest mit etwas, das nicht mehr existiert.« Mit einer gewaltigen Anstrengung öffnete Jho’tol seine Finger. Einen Zentimeter hob er seine Hände, dann zwei. Er sah die Schweißabdrücke, die sie auf seiner grauen Hose hinterlassen hatten. Ich kämpfe gegen mich selbst.
»Wie kannst du das behaupten?«, fragte Rin. Sie klang eher verwirrt als verärgert. »Du siehst doch, dass er sich gegen dich wehrt.«
»Ich sehe einen Körper, der noch nicht fest mit seinem Geist verbunden ist. Wie du diese Tatsache interpretierst, hat nichts mit der Realität zu tun.«
Jho’tol glaubte selbst nicht so ganz an seine Worte. Er hatte viele Neugeborene vervollständigt, wie man bei seinem Volk sagte, doch eine solche Verweigerung hatte er noch nie erlebt. Seine Hände fielen auf die Oberschenkel zurück. Er hätte vor Frustration beinahe geschrien.
»Lanzo«, sagte Rin. »Bitte hör auf mich. Dein Bruder und ich tun, was wir können. Wir werden Ama’Ru finden und sie wird dir helfen. Bis dahin musst du überleben, egal, wie schwer es dir fällt. Du musst essen.«
»Du machst dich lächerlich.« Jho’tol zwang sich, den Blick vom Teller zu nehmen und Rin anzusehen. »Redest du auch so mit deinem Fuß? In diesem Körper ist kein anderes Bewusstsein außer meinem. Also stell diese Unhöflichkeit ein und rede mit mir, so wie man es dir beigebracht–«
Er war satt. Auf seiner Zunge lag ein angenehm scharfer, feuriger Geschmack. Er stand vor dem Waschbecken auf der anderen Seite der Zelle und trank mit seiner behaarten Hand Wasser aus einem Plastikbecher.
»Wir reden später weiter«, sagte Rin. Sie schien sich nicht bewegt zu haben, doch nun hielt sie ein Tablett mit einem leeren Teller in der Hand. Sie lächelte. »Wir werden das gemeinsam durchstehen, das verspreche ich dir.«
Ihr Blick streifte Jho’tol kurz, dann drehte sie sich um und verließ den Zellentrakt. Er hörte, wie sich die Tür hinter ihr schloss.
Es ist also wieder geschehen, dachte er. Es war das mindestens dritte Mal, dass er die Kontrolle über seinen Körper verloren hatte. Für ihn war keine Zeit vergangen, in der Realität jedoch fehlte ihm die Erinnerung an die letzten zwanzig Minuten, vielleicht auch mehr.
Er stellte den Plastikbecher ab. Seine Hand zitterte und er war müde. Jho’tol setzte sich auf das Bett, seine Hände ruhten auf den Oberschenkeln. Er durfte sich vor dem Offensichtlichen nicht länger verschließen. Er war nicht allein in seinem Körper. Etwas lauerte dort, in Tiefen, die ihm verschlossen blieben. Und es kämpfte mit aller Macht gegen ihn an.
»Ich bin Jho’tol ne Thrigne«, flüsterte er. »Du bist ein Nichts. Du wirst mich nicht besiegen.«
Er holte mit seinen kleinen Fäusten aus und schlug sie gegen seinen behaarten Kopf. Schmerz durchfuhr ihn, aber er hörte nicht auf.
»Du bist ein Nichts. Du wirst mich nicht besiegen. Du wirst mich nicht besiegen.«
Seine behaarten, fremden Hände lagen ruhig auf den Oberschenkeln.
Kapitel Zwei
»Sprung in Normalraum erfolgt. Selbstdiagnose abgeschlossen. Alle Systeme arbeiten einwandfrei.«
Die Computerstimme benutzte Englisch, die einzige Sprache, die alle auf der Brücke verstanden. Sie zu hören, machte Mak’Uryl wütend. Das war jedoch nichts Besonderes, es gab in letzter Zeit nur wenig, was ihn nicht wütend machte.
Er ging langsam auf und ab. Der weiche Boden federte unter seinen Tentakeln. Es war warm und feucht auf seiner kleinen Privatjacht. Nur wenige wussten von dem Schiff und genau aus diesem Grund hatte er es gewählt. Außer ihm waren noch vier andere an Bord, alles Haie, die in kleinen Alkoven standen und ihre Konsolen bedienten. Sie bildeten einen Kreis um den kugelförmigen holographischen Bildschirm, der vor ihnen in der Mitte der Brücke schwebte. Alle arbeiteten ruhig und konzentriert. Viele Haie hatten sich Mak’Uryl untergeordnet und standen loyal zu ihm. Dafür verachtete und schätzte er sie gleichermaßen.
Haie