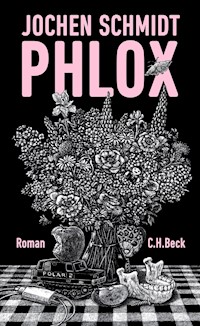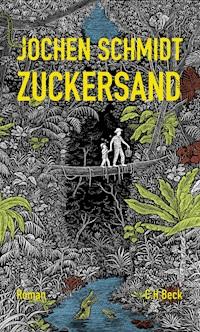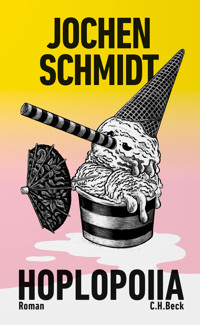
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Richard Sparka ist der Stadtneurotiker des 21. Jahrhunderts! Mit «Hoplopoiia» zeichnet Jochen Schmidt ein pointiertes Gesellschaftsporträt, das die Überforderung und Vereinzelung des Menschen in unserer rasanten Gegenwart zeigt und dabei immer wieder mit gnadenloser Komik auf seinen glücklosen Helden Sparka blickt.
Während sich alles viel zu schnell verändert, kann Richard Sparka den Ereignissen nur erstaunt und resigniert hinterherblicken. Seine Beziehung mit Klara ist zu Ende, die Kinder werden groß, die Eltern alt. Auch das Leben in der Stadt, in der er geboren wurde und die seit jeher sein Zuhause ist, kommt ihm immer unmöglicher vor. Der Zeitungsstand im Spätkauf seines Vertrauens musste einem Chipsregal weichen – für Richard nicht weniger als eine Katastrophe. Und der hippe neue Eisladen um die Ecke wird sein Viertel verändern, bis die Mieten unbezahlbar sind, davon ist Richard überzeugt. Wie schaffen es andere nur, angesichts dieser drastischen Entwicklungen, den Kopf über Wasser zu halten? Richard geht auf Spurensuche in seiner Kindheit in der DDR. Hat seine Lebensunfähigkeit mit dem Aufwachsen in einer Diktatur zu tun? Wäre sein Blick in die Zukunft optimistischer, wenn er damals die Chance ergriffen hätte, Mathematiker zu werden? «Hoplopoiia» ist eine kluge, tiefsinnige und urkomische Weltbetrachtung eines meisterhaften Zweiflers, der die Suche nach dem richtigen Leben noch lange nicht aufgegeben hat
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
JOCHEN SCHMIDT
HOPLOPOIIA
Roman
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Motto
1. VATERUNSER
2. GESETZ VON DER VERDICKUNG DES ENDES
3. DR. RAK
4. BEZIRKSSPEZIALISTENLAGER
5. FAZ
6. GEISTER
7. ARCHIV FÜR ARCHIVWESEN
8. CHAOS IST EINGESPERRTE EXPLOSION
9. NEURODIVERS
10. PARAKLAUSITHYRON
11. STUDIE ÜBER DIE SCHÖNHEIT
12. SO NIMM DENN MEINE HÄNDE
NACHWEIS VIGNETTEN
Zum Buch
Vita
Impressum
Motto
Manchmal blieb ich sogar stehen und sah mir Mülleimer mit einer Genauigkeit an, für die ich keinerlei Verwendung hatte.
Wilhelm Genazino
1. VATERUNSER
Neuerdings murmele ich manchmal, während Klara in ihrem Zimmer meditiert und dabei einer männlichen Stimme lauscht, die minutenlang «Es ist okay …» sagt, das Vaterunser, um mich durch die von so weit herkommenden Worte zu trösten oder wenigstens weinen zu können, wobei ich darauf achte, nicht aus Verzweiflung zu weinen, sondern aus Trauer, denn das hat mir Dr. Rak ans Herz gelegt. Ich glaube leider nicht an Gott, und schon gar nicht an einen männlichen, aber wenn ich das Vaterunser spreche, verbindet mich das mit dem Kind, das, während mein Vater im Wohnzimmer «Das hast du nicht gesagt!» brüllte und meine Mutter ihm immer dann noch einmal widersprach, wenn er sich fast beruhigt hatte, im Bett gelegen und gebetet hat, mit schlechtem Gewissen, weil man so selten Lust dazu hatte, was sich vor jemandem wie Gott schwer verbergen ließ, auch wenn man jetzt kein Ende fand. Dass mein Zuhörer in dieser Zeit nicht Gott war, sondern ich selbst, allerdings aus einem Abstand von mehr als vierzig Jahren, konnte ich damals nicht ahnen und auch nicht, dass meine Ratlosigkeit inzwischen vollkommen sein würde und ich dem kleinen Betenden als Beistand nur die Warnung mitgeben könnte, rechtzeitig mit aller Kraft zu versuchen, nicht ich zu werden.
In der Kirche war mir das laute Beten des Vaterunsers peinlich, beim Aufstehen wurde mir schwindlig, ich musste mich an der Lehne der Bank vor mir abstützen. Ich umfasste mit dem linken Daumen und Zeigefinger den rechten Daumen, weil das Falten der Hände mir zu demütig vorkam, brummte wie ein Bauchredner durch die Zähne und hoffte, von den Nachbarn in meiner Bank nicht gehört zu werden, aber immerhin laut genug, damit es nicht wirkte, als wolle ich mich dem Ritual entziehen, weil ich womöglich eine schwarze Seele hatte. Es war mir unangenehm, die Stimme eines mir vertrauten Erwachsenen die vorformulierten Worte sprechen zu hören, so folgsam zeigten wir uns sonst nicht voreinander. Ich selbst sprach gar nicht den Text, sondern brummte nur im Rhythmus der Gemeinde leise mit, und meist überkam mich ausgerechnet in diesem Moment der heftige Drang zu gähnen, ein Impuls, der sich wie Gotteslästerung anfühlte, denn Gott hatte, nach allem, was ich von ihm wusste, eine zarte Seele (so wie es mich verletzt, wenn Klara am Telefon im Gespräch mit mir gähnt, wann hat sie damit angefangen?). Meine Mutter macht sich Vorwürfe, dass sie uns Kindern das Beten nicht rechtzeitig angewöhnt hat, was ihr allerdings schon mit dem Zähneputzen nicht gelungen ist. Dass Menschen, die bis dahin nicht an Gott geglaubt hätten, bei einem Flugzeugabsturz zum Glauben fänden (was sie von irgendwoher zu wissen meint), ist für sie ein Beweis für die Existenz Gottes. Sie sagte das einmal, als ich ihr drucksend mitgeteilt hatte, dass ich aus der Kirche ausgetreten war, was sie bekümmerte, denn die Kirche hätte «so viel für uns getan», uns also im Sozialismus beigestanden, als wir von allen Seiten bedrängt wurden. Inzwischen überlege ich, ob ich trotz der Kosten, die das mit sich brächte, wieder eintreten soll, um diese Institution bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, die Menschen davon abzuhalten, sich in Bestien zurückzuverwandeln. Ich bin mir aber nicht sicher, was die Kirche dafür neben dem Läuten der Glocken eigentlich tut und ob sie nicht vielleicht sogar eine Mitschuld an unserer Verkommenheit trifft, man müsste sich besser informieren. Ich habe das Bedürfnis, mit einem klugen, philosophisch beschlagenen und mit menschlichen Abgründen vertrauten, hartnäckig mit Gott ringenden Geistlichen, der entschlossen ist, um meine Seele zu kämpfen, Streitgespräche über den Glauben zu führen, wobei ich Angst hätte, ihn mit meinen Zweifeln anzustecken. Es kommt aber nicht dazu, ich fühle mich nur im Vorbeigehen an roten Backsteinkirchen heimisch, und es zieht mich in diese kühlen Räume, wo ich als Kind aus Langeweile die Schiebezahlen der Liedertafel auswendig gelernt und meine Finger an den richtigen Stellen als Lesezeichen ins Gesangbuch geschoben habe, während die Behinderten, die in ihren Fahrzeugen in absurden Verrenkungen festgezurrt in der ersten Reihe abgestellt wurden, Klagelaute ausstießen, die wir als Christen natürlich gütig tolerierten, auch wenn der Pfarrer sich insgeheim vielleicht doch gestört fühlte, wenn er seinen Gedankengang, an dem er eine Woche gefeilt hatte, für die Einwürfe dieser Unglücklichen unterbrechen musste, denen ich mich heute als fernes Echo anschließen möchte.
Klara sagt, ich solle mir eine «Ressourcenkiste» anlegen, in der ich in Momenten des Verzagens kramen kann:
Schach
Latein
Die Kinder
Laufen
Dr. Rak
Mathematik
(Gott?)
Meine «Studie über die Schönheit»
Humor
Georges Perec
Gartenarbeit
Tonleitern
Gottfried Keller
Cousine Sine
Die FAZ
Comics
Bienen
Unsere Paartherapeuten, die inzwischen unsere Trennungscoachs sind, wären zufrieden mit dieser ersten Zusammenstellung, «Sie bringen ’ne Menge Ressourcen mit», hat Dr. Dorf einmal zu mir gesagt, als ich wie gewöhnlich in Tränen aufgelöst war. Aber ich traue so einer Kiste nicht zu, das übermächtige Gefühl von Verzweiflung zu vertreiben, das mich befällt, wenn ich an meine Zukunft denke, was ich, sofern ich nicht in die Vergangenheit versunken bin, ununterbrochen tue. Die Kinder werden aus dem Haus und nur noch in Gestalt ihrer Geburtsdaten präsent sein, die ich als Code für verschiedene Zahlenschlösser und Bankaccounts verwende. Wenn ich sie im Wohnzimmer reden höre und sie sich meiner Tür nähern, fürchte ich, dass sie reinplatzen, um mir vorzuführen, wie sie sich in Klaras Yogamatte eingerollt und «als Sushi» verkleidet haben, und wenn sie es nicht tun, bin ich enttäuscht, dass sie mich so allein hier verrotten lassen. Bis die Kinder ausziehen, werde ich noch so sehr von meiner Familie gebraucht werden, dass der einzige Freiraum der abendliche Gang zu den Mülltonnen im Hof bleibt, danach wird sie mich auswürgen wie eine Schlange das Gewölle einer im Ganzen verschluckten Maus nach dem Verdauungsprozess. Wir werden auseinanderziehen, Klara mit einem Seufzer der Erleichterung, den sie schon jetzt manchmal ausstößt, wenn sie einem Gespräch mit mir entkommen kann und die Tür zu ihrem Zimmer schließt, das sie bewohnt, seit wir uns zu einer Beziehungspause mit «In-house-Lösung» durchgerungen haben, ich mit schwerem Herzen, weil ich gegen jede Veränderung bin, selbst gegen solche zum Besseren. Meine Angehörigen werden bei jedem unvermeidbaren Treffen froh sein, wenn ich durch gewisse Signale zu erkennen gebe, dass ich mich wenigstens noch bemühe, nicht zu vertrotteln, sondern ein aktives Leben zu führen, indem ich zum Beispiel eine teure Outdoorjacke mit vielen Reißverschlüssen und in einer Farbe trage, mit der man als Lawinenopfer leichter gefunden werden kann. Klara behauptet, das alles werde sich von selbst ergeben, wenn ich erst gelernt hätte, mich «mit mir zu verbinden». Aber ich mache mir Sorgen, dass ich es verpasse, mir, solange ich noch laufen kann, eine Co-Rentnerin zu sichern, zumal ich ihr bei Mathematik, Latein, beim Lösen von Schachaufgaben und sicher auch meiner FAZ-Lektüre kaum begegnen werde. Ich habe ja eigentlich gar keine Zeit dazu, einsam zu sein, trotzdem bin ich es, wenn ich an meine Zukunft denke, und natürlich auch wenn ich an meine Vergangenheit denke, dann noch viel mehr, meinem vergangenen Ich möchte ich, wenn ich es in Gedanken besuche, zurufen, dass hinter ihm der Teufel steht, aber genau wie der Kasper im Puppentheater dreht es sich immer zu spät um. Es ist eine beängstigende Vorstellung, dass ich mich von meinem Kopf, der an allem die Schuld trägt, nie werde trennen können, das müssten schon andere für mich übernehmen.
Ich liege auf dem Bett, falte die Hände über der Brust und versuche, mich an das Gefühl, glücklich zu sein, zu erinnern, das, wie ich finde, gut zu mir passen würde, das ich aber nun schon so lange nicht mehr gespürt habe. Im Moment setzen mir Gewissensbisse zu, weil ich bei Rewe einen Magneten von der Ankündigungstafel gestohlen habe, um ihn Ricarda zu schenken, die damit ihren Stundenplan in ihrem Schulspind aufgehängt hat. Ich kann den Zwang kaum niederringen, meinem Chef, Herrn Dobrowolski, diesen Diebstahl zu beichten, der Gedanke verfolgt mich hartnäckig, und wenn ich Herrn Dobrowolski gegenüberstehe, bekomme ich Hitzewallungen und muss mir buchstäblich auf die Zunge beißen, irgendwann werde ich sie mir abschneiden müssen.
Klara erkundigt sich, ob ich den Kindern die Zähne geputzt habe, obwohl es «mein» Morgen ist, sie vertraut mir nicht und gibt mir das Gefühl, ihr nur zuzuarbeiten, andererseits bemängelt sie mein fehlendes Engagement. Ich weiß, dass ich diese Dynamik nicht ansprechen sollte, weil Klara das als Vorwurf auffassen würde, aber ich wünsche mir, dass sie meine Gefühle versteht, um mich gerechter beurteilen zu können und mir vielleicht noch einmal eine Chance zu geben. Sie möchte meine Gefühle aber gar nicht beschrieben bekommen, ich solle sie «bei mir lassen», sie sei nicht mehr bereit, sich «in diese negative Spirale mit reinziehen» zu lassen. Weil sie sich dem Gespräch verweigert, werde ich immer eindringlicher und sie immer passiver, schließlich lässt sie mich stehen und warnt mich, «diese Grenze zu respektieren», und es ist klar, dass ich wieder einen Tag in nervlichem Aufruhr verbringen werde, zunächst wütend und verzweifelt über die Ungerechtigkeit, später bedrückt und kraftlos. Diese Situation habe ich so oft erlebt, dass ich mich sogar schon einmal so gefühlt habe und, als ich mir unseren Streit vom Morgen ins Gedächtnis rufen wollte, feststellen musste, dass wir uns an diesem Tag gar nicht gestritten hatten!
Ich fahre die Kinder mit unserem Lastenfahrrad in die Schule, manchmal lächeln uns Passanten zu, weil sie sich freuen, dass ein Vater sich so fürsorglich um seinen Nachwuchs bemüht, oder weil sie gern selbst noch einmal ein Kind wären oder weil ihre Kinder schon zu alt sind, um noch herumgefahren zu werden. Vielleicht ist es auch Rührung darüber, dass wir uns mit Muskelkraft bewegen und den scheinbaren Rückschritt als Fortschritt zelebrieren, und mein Anblick macht ihnen Hoffnung, dass die Menschheit das Ruder noch einmal rumreißen kann. Manchmal denke ich aber auch, es sind Nervenärzte, die sich wundern, warum mich der Pförtner der Klinik durchgelassen hat, obwohl sie es im Prinzip gutheißen, dass ich mir solch einen Ausflug zutraue. Als ich an einer Kreuzung halte, an der es ein «Blume 2000»-Geschäft gibt, sagt Ricarda: «Ich dachte früher immer, dass das ‹Blumenzoo› heißt.» Ich vergewissere mich, dass das nächste Auto weit genug entfernt ist, und fahre schnell bei Rot über die Straße. Der Autofahrer lässt den Motor aufheulen, schließt zu mir auf, beugt sich im Fahren über den Beifahrersitz, um die Scheibe herunterzukurbeln, und belehrt mich, wie «unverantwortlich» das sei, was ich da mache: «War Rot, du Fotze! Mann, Mann, Mann!» Ich suche nach dem schneidigen Schimpfwort, das ich mir für solche Fälle zurechtgelegt habe, aber ich scheue mich, es vor meinen Kindern auszusprechen, und verzichte auch darauf, durch die geöffnete Scheibe zu spucken. Andererseits habe ich das Bedürfnis, diesem Faschisten Paroli zu bieten, um mich nicht wie ein beim Rauchen ertappter Schüler zu fühlen. Ich könnte sagen: «Das einzige Unverantwortliche hier ist, angesichts der Erderwärmung weiterhin allein im Auto durch die Stadt zu gondeln», oder etwas schärfer: «Das einzige Unverantwortliche hier ist, dass deine Eltern dich nicht abgetrieben haben!» Aber er ist schon außer Hörweite, und außerdem lässt sich die Tatsache, dass ich bei Rot gefahren bin, nicht leugnen, auch wenn ich niemanden gefährdet habe, ich habe diesem glatzköpfigen Finsterling durch mein Fehlverhalten eine willkommene Gelegenheit verschafft, seinem Ärger über Lastenfahrräder und damit eine Lebensweise, von der er sich bedroht fühlt, Ausdruck zu verschaffen, und zu allem Unglück auch noch seinen Ärger in mein Herz gelassen. Im Grunde kann ich ihn ja verstehen, so wie den Mann mit dem WACKEN-T-Shirt, den ich einmal dabei beobachtet habe, wie er einen Elektroroller, der vor der Einfahrt seines Hauses stehen gelassen worden war, was möglicherweise öfter passierte, hochhob, zur Straße trug und der Menschheit dieses Werkzeug seiner Unterdrückung mit einem Krachen vor die Füße warf. Wenn ich den Autofahrer, der genau wie ich darunter leidet, dass die Welt sich schneller verändert als er, durch eine geistesgegenwärtige Reaktion im Innersten treffen würde, wäre damit nichts gewonnen, er würde zu Hause seine Frau und seine Kinder schlagen oder im Internet Menschen herabwürdigen oder (was er möglicherweise ohnehin tut) eine Partei wählen, die verspricht, die Verkehrsprobleme zu lösen, indem man alle Radfahrer erschießen lässt («DIESEN STAU KANN MAN ABWÄHLEN!»). Es ist besser, von Zeit zu Zeit einen Autofahrer vorzulassen, auch wenn man eigentlich Vorfahrt hat, vor allem, wenn er ein sperriges Vehikel steuert und im Auftrag der Allgemeinheit unterwegs ist, Frau Malakoff wäre stolz auf mich. Die Sache beschäftigt meine Nerven noch Stunden (und irgendwann werden Vorwürfe gegen Klara daraus, da sie darauf bestanden hat, dass wir die Kinder in eine Schule schicken, die nicht zu Fuß zu erreichen ist, wie die ihnen eigentlich zugeteilte Schule in der Nachbarschaft, nachdem sie am Tag der Offenen Tür in der «Schulfreischule» so begeistert von den Eltern gewesen ist, die für ihre Schule warben). Es ist aber genauso, wenn mir die Vorfahrt genommen wird und ich hinter einem Auto herjage, um an der nächsten Kreuzung wenigstens vorwurfsvoll durch die Scheibe zu gucken, manchmal guckt der Fahrer ganz betreten zurück und zieht eine Stan-Laurel-Grimasse, weil er sich seines Fehlers bewusst ist. Dann tut es mir leid, mich so aufgespielt zu haben, und ich entschuldige mich, trage aber noch lange ein unangenehmes Gefühl in der Brust mit mir herum. Kaum begibt man sich unter Menschen, zieht man Ärger auf sich! Ich bin immer ganz irritiert, wenn ein Verkäufer, ein Handwerker oder ein Lieferant freundlich zu mir ist, allen voran der Schornsteinfeger, vielleicht wird es angemessen bezahlt, Schornsteine zu reinigen. Der Normalfall ist aber, dass ich ins Stottern gerate, wenn ich mich verständlich, die knappe Zeit meines Gegenübers respektierend und sein Fachvokabular möglichst korrekt, aber ohne meinen Laienstatus zu verhehlen, einsetzend, ausdrücken will. Ich freue mich darauf, endlich eindeutig alt zu sein (immerhin werden meine Brusthaare schon grau), als Greis wird man hoffentlich nicht mehr beschimpft. «Ihr werdet noch alle an meinem Grab weinen», hat meine Mutter immer gemurmelt, vielleicht hätte ich das zu dem Glatzkopf sagen sollen.
Ich gehe in Gedanken durch, wer von den Eltern an unserer Schule schon getrennt ist, den Nachzüglern wünsche ich, dass es sie auch endlich erwischt, warum halten sie so störrisch aneinander fest? Wem wollen sie damit etwas beweisen? Die getrennten Väter erkennt man daran, dass sie besonders engagiert mit den Kindern scherzen, auch mit fremden, während die anderen ihr Kind hinter sich herziehen wie einen störrischen Staubsauger. Wir kommen wieder zu spät (Ricarda: «Wir müssen los, sonst kriegt Mama ein’ Nervenausfall»), aber das macht bei unserer Schule nichts, der Direktor (den es hier gar nicht gibt) steht nicht mit einer Stoppuhr am Eingang und schreibt die Bummler auf. In meiner Kindheit bildeten sich, wenn es geklingelt hatte, blitzschnell Paare, denn es wurde am Eingang von der Aufsicht darauf geachtet, dass man immer zwei und zwei an ihr vorbeiging, man musste sich sogar an der Hand nehmen. Manchmal hatte ich niemanden von meinen Freunden abbekommen, sie hatten mich einfach stehen gelassen und waren verschwunden, und ich musste fremde Schüler ansprechen: «Wollen wir zusammen rein?» Meist hatte ich kein Glück, und ein Mädchen konnte ich natürlich nicht fragen, auch keinen Älteren. Es tröpfelten schon nur noch Nachzügler heran, Schüler, mit denen ich unter normalen Umständen nie geredet hätte, mit Warzen an den Fingern, und die jetzt meine Rettung sein sollten, weil ich nicht ins Gebäude durfte und einen «Strich» im Klassenbuch bekommen würde. Wenn ich doch durch die Zeit reisen und mich selbst an der Hand nehmen könnte!
Karl und Ricarda verstauen ihre Sachen in ihren schmalen Spinden, umarmen mich hastig («Papa, der Schulrekord im Schoko-Bon-Papier-Langziehen ist 47 Zentimeter!») und rennen auf Socken die Treppen hoch, weil sie nichts verpassen wollen. Auch ich muss im Gebäude meine Schuhe ausziehen und laufe auf Socken, wenigstens wird dadurch der Boden sauberer, den die Schüler zwar am Nachmittag fegen, aber so gelangweilt und ungeschickt – manche klemmen sich den Besenstiel vor die Brust und laufen auf diese Weise mit den Händen in den Taschen kreuz und quer durch den Raum –, dass man ihnen den Besen aus der Hand reißen möchte, um rasch selbst durchzufegen, vor allem, wenn es mittags zum Nachtisch Streuselkuchen gegeben hat.
Am Eingang hängt ein «Mood board», auf dem man mit Smileys seine Stimmung festhalten darf. Auf den Mülleimern steht «Ressourcen». Auf einem Plakat wird dafür geworben, «als Klimaschutzpat*in klimafreundliche Impulse» zu geben. Am Geländer der Empore ist ein handbeschriebenes Laken befestigt: «FRIEDEN!» Aus von Eltern gespendeten alten Sofas hat sich eine Sofalandschaft entwickelt. Ein paar Mädchen sitzen an Tischen im Foyer und malen Cheeseburger, wahrscheinlich weil sie keine essen dürfen. Auf dem Klavier spielt immer irgendein Kind den Flohwalzer, was nicht ohne Ironie ist, da hier ständig Kinder Läuse haben und die Eltern schon eine Läuse-Task-Force gegründet haben (für mich ist es immer ein Fest, wenn wir betroffen sind, weil Klara dann nach Läusen in meinen Haaren sucht und sich die seltene Berührung durch ihre Hände noch schöner anfühlt als beim Friseur, wo ich wegen meines Haarausfalls sowieso bald nicht mehr hingehen kann). Meine Französischlehrerin an der Euler-Schule hat mich einmal gefragt, ob ich Klavier spielen würde, ich hatte bei der «Meldung» am Beginn der Stunde, während der man stehen musste, nervös mit den Fingern auf meiner Bank getrommelt. Ich fühlte mich geschmeichelt, für einen Klavierspieler gehalten zu werden, auch wenn ich nie Klavier gespielt hatte, aber dass diese Lehrerin, die zu den wenigen an Bildung interessierten Pädagogen an unserer Schule gehörte (sie spielte uns einmal Lieder von Víctor Jara vor), es sich vorstellen konnte, sprach in meinen Augen für ihre Menschenkenntnis und öffnete mein Herz für ihr an unserer Schule eigentlich als überflüssig betrachtetes Fach. (Womöglich habe ich deshalb später so intensiv Französisch gelernt, um ihr, der ich allerdings nie wiederbegegnet bin, eine Freude zu machen.)
Heute ist Schulversammlung, ich setze mich auf ein Sofa neben dem Kickergerät und höre zu. Einer der «Potentialentfaltenden», wie die früher «Lernbegleiter» und noch davor «Teamer» genannten Lehrer inzwischen heißen, sagt ins Mikrofon: «Als Nächstes steht hier das Thema ‹Chillraum›, wir haben das Thema auf der Liste, weil sich zur Zeit immer wieder einige Mädchen lange auf dem Klo aufhalten, Lena?»
«Zum Thema Klo wollten wir was sagen: Die Binden dort sind zu klein, das ist blöd, wenn man seine Periode hat.»
«Gibt es eine Mehrheit dafür, dass wir das Thema Binden jetzt mit in die Diskussion nehmen? Hebt mal bitte den Arm. Dafür? Dagegen? Enthaltungen?»
Ich gehe lieber, bevor mich wieder ein Kind fragt, von wem ich der Opa sei. Auf dem Hof höre ich ein Mädchen sagen: «Ich werd’ nächste Woche sechzehn, ich hab jetzt schon genug von meiner Jugend …»
Ich würde gern wieder in die Schule gehen, inzwischen würde ich mich sogar vorbereiten und mir meine Schulbücher am Anfang des Jahres durchlesen, wie es meine Mutter als Kind getan hat, weil sie kaum Bücher besaß und sich auf die Schulbücher freute, auch mich interessiert inzwischen alles, während mir das als Schüler nicht möglich war. Die Schule ist an die Schüler verschenkt, man sollte mit sechzig in die erste Klasse kommen. Auf dem Weg allein zurück mit dem leeren Lastenfahrrad ärgere ich mich über meine Gereiztheit am Morgen und denke wehmütig daran, wie lange ich die Kinder noch fahren werde. Was soll aus mir werden, wenn sie mich nicht mehr brauchen? Andererseits belastet es mich, dass ich für sie da sein muss, wenigstens als stille Reserve, und dass ich gar nicht das Recht habe, mich aus dem Leben zu stehlen wie beim heimlichen Verschwinden von einer Party, die sich als Fehler herausgestellt hat. Meine Mutter schlurfte manchmal von Migräne gepeinigt vom Schlafzimmer zum Klo, um sich dort zu übergeben, und murmelte: «Bis ihr achtzehn seid, muss ich noch durchhalten …» Einmal kaufte ich in der Kaufhalle unseres Neubaugebiets, der sogenannten «Käferkaufhalle», von der man im Mehl Käfer nach Hause brachte, die in der Heizperiode schlüpften, ein Ginseng-Präparat für meine Mutter, vielleicht half es gegen Kopfschmerzen? Wem, wenn nicht den Chinesen, war es zuzutrauen, der Natur ein Mittel gegen Migräne abgerungen zu haben? Bei den Gesprächen über die Zahl der Tabletten, die sie schon genommen hatten (zwei Ergoffin und dann noch eine Copyrkal!), wirkten meine Eltern verbunden wie sonst nur, wenn im Westfernsehen Filme wie «Barfuß im Park» oder «High Society» liefen, die sie schon vor unserer Geburt gesehen hatten (die Überraschung war immer gelungen, wenn die Ansagerin gegen Abend das weitere Programm ankündigte, von dem wir, da es in unseren Zeitungen nicht abgedruckt wurde, in der Regel wenig wussten, man guckte immer auf Verdacht und musste sich beim Wachestehen ablösen, um nichts zu verpassen). Ein Hängeschrank in der Küche quoll über vor Tablettenschächtelchen, ich hatte deshalb immer Angst, meine Eltern seien tablettensüchtig, und stecke mir meine eigenen Tabletten nur heimlich in den Mund, damit die Kinder es nicht bemerken.
Weil ich den Fehler mache, spontan zur «Akut-Sprechstunde» meiner Hausärztin zu gehen, muss ich drei Stunden im Warteraum sitzen und Broschüren über Zeckenbisse, «Diagnose: Gürtelrose» und Reisekrankheit studieren. Selbst das DDR-Linoleum mit vorgetäuschtem Parkettmuster, das wir auch in unserer Neubauwohnung hatten, kann mich diesmal nicht aufheitern. Ich ahne auch schon, dass es wieder ein zerklüftetes Gespräch werden wird. Ich fühle mich hilflos, weil ich mich der Ärztin nicht verständlich machen kann, während sie, als sei ich unzurechnungsfähig, herauszuhören versucht, was ich ihr eigentlich mitteilen will, denn was ich sage, scheint ihr nicht weiterzuhelfen, weshalb sie mich ständig unterbricht. Während sie mich befragt, stelle ich, um wenigstens so zu tun, als sehe ich sie an, meine Augen auf unscharf und fixiere ihre Nasenwurzel, wobei ich staune, wie selbstverständlich sie Begriffe wie «Stuhlsäule» oder «ausgeformter Stuhl» verwendet. Ich habe das Gefühl, als schwierig empfunden zu werden, dabei will ich nur keine Umstände machen. Ich soll ihr beschreiben, wie heute morgen das Blut in meinem Stuhl aussah, das mich hergeführt hat, oder befand es sich etwa nicht «im», sondern «am» Stuhl? (Natürlich muss ich die ganze Zeit denken: «Ruckediguh, Blut ist im Stuhl!») Nachdem ich ihr erklärt habe, dass ich seit drei Tagen unter starken Bauchschmerzen leide, sagt sie: «Wir reden hier über völlig verschiedene Sachverhalte.»
«Kann das denn miteinander zu tun haben?»
«Sie können eine Spiegelung machen.»
«Aber ist das denn nötig?»
«Wenn Sie in dieser Richtung beunruhigt sind.»
«Sollte ich denn beunruhigt sein? Also sind Sie beunruhigt?»
«Ich kann nur versuchen, mir aus Ihren Angaben ein Bild zu machen. Sie sind ja hier, weil sie Beschwerden haben.»
«Ich bin hier, weil es immer heißt, Männer gingen nicht zum Arzt.»
Ich fühle mich schuldig, dass ich am Morgen meinen Stuhl nicht genauer betrachtet habe und deshalb keine Angaben machen kann, die uns weiterhelfen, wie ein Zeuge, der sich nicht an die Kleidung des Täters erinnern kann, eigentlich würde ich ihr auch lieber von Klara erzählen, vielleicht weiß sie, wie ich sie zurückgewinnen kann, sie ist doch auch eine Frau. Ich würde meinen Stuhl an sich nicht ungern genauer betrachten, aber das ist in unserer Kultur negativ besetzt, Interesse für den eigenen Stuhl gilt als egozentrisch, fast so sehr wie das Betrachten des Bauchnabels, der in Wirklichkeit viel weniger bietet. Ob es helfen würde, sich zum Ausgleich auch für fremden Stuhl zu interessieren, um sich vom Verdacht, ein narzisstisch gestörter Eigenstuhl-Gucker zu sein, freizumachen? Mir fällt ein Mann ein, von dem mir einmal erzählt worden ist, nach seinem Tod hätten sich in seinen Taschenkalendern Eintragungen gefunden, in denen er täglich die Beschaffenheit seines Stuhls vermerkt hatte, andere Aufzeichnungen hatte er nicht gemacht. Das scheint auf den ersten Blick eine zweifelhafte Hinterlassenschaft zu sein, aber wenn wir ehrlich sind, spricht auch nichts dagegen, solch ein Protokoll zu führen, es ist ganz willkürlich, dass man von der Konvention daran gehindert wird, sich mehr für seinen Stuhl zu interessieren als für seine Mitmenschen. Ich könnte der Ärztin versichern, dass sie zu meinem Stuhl gerne «Scheiße» sagen dürfe, und versprechen, in Zukunft genauer hinzusehen, auch wenn es für dieses Mal leider zu spät sei, das Kind sei ins Bad gefallen. Doch gerade weil ich drei Stunden gewartet habe, will ich für die Patienten nach mir die Wartezeit nicht unnötig verlängern und bin verzweifelt, dass ich mich ihr nicht mitteilen kann, ohne dass sie mich missversteht, ich verkompliziere die Situation mit jedem Satz und meine schon zu bemerken, dass sie ungeduldig wird und ich sie gegen mich aufgebracht habe. Soll ich ihr verraten, dass ich vor einer Krebsdiagnose keine Angst hätte, weil ich mir ausmale, was ich dann alles leichten Herzens absagen könnte? Wem ich aus dem Weg gehen könnte beziehungsweise nicht mehr aus dem Weg gehen müsste? Vor allem natürlich Herrn Dobrowolski! (Und würde Klara mich dann immer noch verlassen? Einen todkranken Mann?) Aber vielleicht würde ich, so schwer erkrankt, auch eine neue, mir im Moment gar nicht vorstellbare Stufe der Verzweiflung erreichen? Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich keine Angst vor Darmkrebs habe, viel mehr fürchte ich eine Vorladung vor Gericht wegen irgendeines Verbrechens, das ich, ohne es zu wollen, begangen habe.
Ich fahre bei meinen Eltern vorbei, weil ich jetzt schon ahne, wie sehr ich sie einmal vermissen werde. Im Hausflur atme ich tief durch und stelle mich darauf ein, wie alt sie sind, um nicht zu erschrecken. Neuerdings stützt meine Mutter sich im Stehen mit den Händen auf Möbelstücken ab. Wie schlimm muss es sein, wenn das erwachsene Kind so trostbedürftig ist und man nichts tun kann, als ihm etwas zu essen aufzuwärmen? (Ich sehe aber lieber den Kühlschrank durch, um abgelaufene oder verschimmelte Lebensmittel wegzuwerfen, danach kontrolliere ich die Teppichkanten, ob sich irgendwo Stolperfallen gebildet haben.) Zum Glück ist immer mindestens ein Fernsehapparat an, durch unsere verschiedenen Fernseher brauchten wir früher nicht einmal Alkohol, um es miteinander auszuhalten. Ich würde mir wünschen, dass wir uns an den Tisch setzen, in die Augen sehen und ich gefragt werde, wie es mir geht und was es Neues über meine Kinder zu erzählen gibt. Aber meine Mutter drückt mir, bevor ich überhaupt die Jacke ausgezogen habe, Zeitungsartikel, aussortierte Bücher und Mappen mit meinen Kinderzeichnungen in die Hand, dazu ein Buch, das mein Vater gelesen und mit Anstreichungen versehen hat und das er ihrer Meinung nach nicht vermissen wird: «Da guckt er doch nie wieder rein!» Ist das ein Grund, es abzuschaffen? Ich habe mich immer der Vorstellung hingegeben, dass nach meinem Tod eine Gruppe Gelehrter meine Wohnung erforschen würde, auf der Suche nach Fragmenten meiner «Studie über die Schönheit», und wenn sie auf die Anstreichungen in meinen Büchern stießen, würden sie als Wissenschaftler hocherfreut sein über diesen Fund, als fühlende Wesen aber schockiert, wie fleißig ich über all die Jahre gewesen bin, das Mindeste, was ich mir erhoffe, ist, dass sie sich dann erst einmal setzen müssen, um sich zu fassen, bevor sie weitermachen können.
Um der Familie zu entkommen, sieht mein Vater, wie sein ganzes Leben lang schon, fern, nur dass er dabei nicht mehr arbeitet oder liest und meine Mutter ihm inzwischen unterstellt, gar nicht darauf zu achten, was er da sieht (von der FAZ, die sie abonniert haben, bekomme ich die letzten Ausgaben ungelesen mit), früher habe er doch so gerne gemalt! Sie hat ihm eine Staffelei und einen Farbkasten gekauft, aber das interessiere ihn alles nicht mehr, seit er nicht mehr in seinem Beruf tätig ist. Er hat sein Leben dem Archiv für Archivwesen gewidmet, das die Wende knapp überlebt hat, dann aber ein Opfer der Digitalisierung geworden ist, aus einem wissenschaftlich kuratierten, über Generationen vorangetriebenen, nationalen Großprojekt wurde ein Internet-Service, der die Nutzer in der Vorstellung bestärkt, die abgerufenen Informationen müssten kostenlos sein. Nun sehe er «niveaulose» Sendungen, wie früher seine Schwiegermutter, wofür er diese immer kritisiert hatte, das empört meine Mutter am meisten. Wenn wir ihm zu laut reden, dreht er den Ton hoch. Meine Mutter hatte sich beim Umzug dagegen gewehrt, das Sofa in die Wohnküche zu stellen, angeblich passte es nämlich nicht ganz hinein, wenige Zentimeter würden fehlen. Die Konsequenz des Sofas war der Fernseher, wodurch eine Fernsehecke entstanden ist und sie beim Kochen in der Küche kein Radio hören kann, weil das meinen Vater stören würde. Denn natürlich hält er sich so gut wie nie in seinem Arbeitszimmer auf, obwohl nur er eines hat, dort sitzt er nur verloren und wartet, wenn die moldawische Putzfrau ihre Arbeit macht, deren Kinder so fleißig, wohlerzogen und anspruchslos sind, dass meine Mutter aus dem Schwärmen nicht herauskommt, zumal sie nebenbei noch täglich Eiskunstlauf trainieren. (Es ist bei meinen Eltern allerdings schmutziger als bei mir, vielleicht ein Zeichen, dass ich erwachsen werde.)
Sobald das Essen auf dem Tisch steht, beginnt meine Mutter mit Abwaschen, es hält sie nie lange auf einem Stuhl. Sie geht erfolgreiche Filme, avantgardistische Operninszenierungen, neue Romane über Nazivorfahren durch, um sich abwertend dazu zu äußern, sie würde so etwas nie lesen oder ansehen und sie versteht nicht, warum Millionen andere es tun, womit sie mich vermutlich trösten will, während ich müde und überfordert: «Das interessiert mich überhaupt nicht …» sage. Als ich ihr von unserer «Beziehungspause» erzähle, reagiert sie nicht. «Ich hab dir gerade gesagt, dass wir uns vielleicht trennen werden!»
«Was soll ich da sagen? Ich hab das schon kommen sehen, das sind die Frauen heute, dann soll sie mal sehen, wie sie das alleine schafft. Der Sohn von Schreckeisens hat jetzt im Internet eine sehr nette Asiatin gefunden. Die ist eigentlich viel zu hübsch für ihn.»
«Ich bin aber nicht der Sohn von Schreckeisens.»
«Ja, was soll ich denn sagen, ich weiß doch auch nicht, der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen …»
«Du sollst gar nichts sagen, nur zuhören und mitschwingen.»
«Mir haben meine Eltern auch nicht zugehört, dafür hatten die gar keine Zeit im Krieg. Mein Vater hat sich zum ersten Mal für uns interessiert, als er drei Monate arbeitslos war, und meine Briefe vom Studium, die eigentlich als Tagebuch gedacht waren, haben sie als Kohlenanzünder benutzt.»
«Deshalb versuche ich ja, es anders zu machen.»
«Na, deine Kinder werden genauso reden bei dir.»
«Das werden sie hoffentlich nicht.»
«Du wirst dich wundern.»
«Ich könnte nach Tadschikistan gehen, da werden heute noch Frauen geraubt und zum Heiraten gezwungen.»
«Das ist nicht das Schlechteste, die große Liebe ist nach einem Jahr vorbei, dann kommt es darauf an, im Alltag zusammenzupassen.»
«Ich hätte als Schüler Vertrauen gebraucht, ich habe nie eine Entscheidung aus mir heraus getroffen und nie gelernt, meine Impulse wahrzunehmen, weil das bei uns im Land gar nicht erwünscht war. Dadurch weiß ich bis heute nicht, was ich will oder was ich denke, und schließe mich immer der Meinung meines Vorredners an. Vielleicht ist das auch eine Folge deiner Fluchterfahrung, das nennt sich transgenerationelle Traumaübertragung.»
«Aber die Entscheidung, Mathematik nicht zu Ende zu studieren, hast du doch selbst getroffen.»
«Ich hätte viel früher rebellieren müssen, das wäre gesund gewesen. Ich wusste mit achtzehn nicht, dass man sich in der DDReine Arbeit suchen konnte und dass die meisten Betriebe jeden mit Kusshand nahmen, der kein Alkoholiker und noch nicht im Knast gewesen war. Mir blieb gar nichts übrig, als zu studieren, nachdem mich die Schule einfach alleingelassen hat, als wäre ich nie dort gewesen. Im Grunde mache ich alles, was ich tue, um meine früheren Lehrer zu beeindrucken, dabei sind die meisten wohl längst tot. Inzwischen wäre ich sogar in Sport und in Russisch der Beste.»
«Aber du hast doch zu lernen gelernt.»
«Es war bestenfalls Zeitverschwendung.»
«Sei froh, dass du so gesunde Kinder hast, die könnten auch Glasknochen haben oder künstliche Beatmung brauchen.»
«Ich frage mich, an welchem Punkt mein Leben schiefgelaufen ist.»
«Du warst so ein fröhliches Kind, bei dir dachte ich immer, ich muss mir keine Sorgen machen.»
«Frau Knoch hat mich gemobbt, ich habe immer noch Albträume von ihr.»
«Wir haben dich doch unterstützt.»
«Du bist ganz aufgeregt vom Elternabend gekommen und hast Papa im Wohnzimmer erzählt, dass von mir berichtet worden sei, dass ich bei der Apfelernte mit Äpfeln jongliert hatte, in der Hofpause heimlich zum Bäcker gegangen bin und vergessen habe, dass wir von der Pause früher hochkommen sollten, um die Russischsendung im Fernsehen zu sehen, während die doppelten Lottchen gelobt wurden, weil sie freiwillig die Beete vor der Schule geharkt hatten.»
«Das weiß ich gar nicht mehr.»
«Du hast immer gesagt, als Christen müssten wir doppelt so gut sein wie die anderen, als seien wir schuld daran, dass wir unterdrückt wurden.»
«Du warst so ein fröhliches Kind.»
«Ich weiß noch, dass du mir mal, da muss ich gerade sechs gewesen sein, erklärt hast, warum die Menschen in dem Film, den wir sahen, gestreifte Kleidung anhatten und dass die Wachleute von der SS einfach auf sie schießen durften, wenn ihnen danach war.»
«Das schadet gar nichts, wenn Kinder etwas von der Welt mitkriegen.»
«Klara bricht unsere Diskussionen immer ab, wenn ein Kind dazukommt.»
«Die können ruhig erleben, dass Erwachsene sich streiten.»
«Ich fand es schrecklich, wie viel ihr euch gestritten habt.»
«Daran kann ich mich gar nicht erinnern.»
«Es verfolgt mich bis heute.»
«Jetzt hat neulich ein antiautoritär erzogener Junge seinen Vater so geärgert, dass er ihn erstochen hat.»
«Und du meinst natürlich, der Sohn ist schuld?»
«Ja, natürlich! Die Mutter hatte ihn auch nur antiautoritär erziehen wollen, aber die hat sich schon umgebracht. Zu den Großeltern war er ja nett.»
«Ich weiß nicht, was das mit unserem Thema zu tun hat.»
«Meine Oma hatte zehn Kinder, die hätte gar nicht alle lieben können.»
Meine Mutter ruft meinem Vater zu, dass er seine Gläser mit Wasser austrinken soll, die sie immer auf eines der vielen Beistelltischchen neben ihm stellt, er ist schwerhörig und der Fernseher zu laut, sodass er verärgert etwas zurückruft, was sie wiederum nicht versteht. Er war sein Leben lang gereizt, und Klara unterstellt mir, genauso zu sein. Ich würde meiner Mutter gerne zureden, sich nicht auch noch in ihren letzten Lebensjahren meinem Vater unterzuordnen und diese Zeit damit zu verbringen, ihn zu bedienen. Gestern sei er plötzlich verzweifelt gewesen und habe geweint, weil ihm wohl klar geworden sei, was mit ihm vorgeht. Ich beneide die Italiener, die keine Hemmungen haben, ihre Mütter lautstark anzuhimmeln, sie zu umarmen und zu küssen.
Meine Mutter gibt mir einen Becher mit Urin von meinem Vater mit, denn der Geruch gefällt ihr nicht, sie will vom Arzt wissen, ob er schon wieder Antibiotika bräuchte. Ich muss mit der Probe zum Urologen fahren. Einmal hat sie ein Marmeladenglas benutzt und es nicht richtig zugeschraubt, alles ist in der Tüte ausgelaufen, was ich erst am Schalter der Praxis merkte, als ich das Glas übergeben wollte. Mit etwas Wehmut denke ich daran, dass an meinem Urin einmal niemand riechen wird. Es nieselt, und meine Jacke weicht durch, als ich mit dem Fahrrad weiterfahre. Ich werde von Lastwagen nass gespritzt, aber ich bin ganz einverstanden damit, in Situationen zu geraten, die meiner Gefühlslage entsprechen. Manchmal stelle ich es mir sogar entlastend vor, zusammengeschlagen zu werden.
Ich stehe in der Warteschlange des Urologen und betrachte den in eine Säule eingelassenen Bildschirm mit einem Kaminfeuer, der mir vielleicht sagen soll, dass die Geschäfte gut laufen. Die Praxis ist modern eingerichtet und sieht sauberer aus als meine Wohnung, dadurch fühle ich mich in meiner Kleidung wie ein Obdachloser. Die Schwester will die Telefonnummer des vor mir Stehenden nachtragen, und er sagt sie ihr laut an. Ich rüttle mit einem Finger in meinem Ohr, um wenigstens eine Ziffer nicht zu verstehen, weil ich schon weiß, dass ich mir die Nummer sonst merken werde, vielleicht jahrelang, und mich zwingen müsste, sie nicht zu wählen, einfach, weil ich sie im Kopf habe und nicht wählen will.
Dr. Rak sagt, es sei doch für mich gar nichts anders geworden durch die «Beziehungspause», wir hätten ohnehin seit Jahren wie getrennt gelebt. Ich habe dem immer widersprochen, woher sollte ich wissen, wie sich eine glückliche Beziehung anfühlen müsste? Ich kenne kein Beispiel von Menschen, die es ohne seelische Deformationen, die jedem außer ihnen selbst sofort ins Auge springen, ein Leben lang miteinander ausgehalten hätten, geschweige denn glücklich gewesen sind, man hört immer nur davon, wie viele Paare Angst haben, sich nicht mehr zu begehren. Ich hätte Dr. Rak gern die Freude gemacht, wieder Sex gehabt zu haben, statt mich im Sommer mit einem Bier ans Küchenfenster zu setzen, um der Frau aus dem Hinterhaus zu lauschen, die im Bett mit ihrem Liebhaber, der zum Glück selbst nicht zu hören ist (oder sind es mehrere?), so leidenschaftliche Geräusche macht, manchmal in Schüben einen ganzen Abend lang, bis unsere lesbische Nachbarin rausruft: «Du nervst!», womit sie zum Glück nicht mich meint, aber ich zucke trotzdem schuldbewusst zusammen. Klara hat sich mir immer mehr entzogen, und aus Verzweiflung darüber habe ich schon wegen Kleinigkeiten Wut empfunden und Streit provoziert, der Klara darin bestätigt hat, wie aussichtslos es mit uns sei, weil wir immer «in die alten Muster» verfallen würden. Wenn ich ihr beschreiben will, wie es mir wegen der Magnetgeschichte geht, sagt sie: «Das zieht mich immer noch tiefer, ich brauche was Nährendes.» Ich bin dann traurig darüber, für sie nichts Nährendes zu sein. Klara sagt, ich hätte es in der Hand, mein Leben jederzeit zu ändern, das hat sie von «Gerburg» gelernt, ihrer Heiltherapeutin, die angeblich Mathematik studiert hat.
Ich habe mich umzuhören begonnen, um Auslöser von Ärger, der sich zwischen Partnern anstaut, zu sammeln:
Er schneidet die Aufkleber vom Brotlaib und lässt sie liegen.
Sie schält das Gemüse über der Spüle und sammelt die Schalen nicht raus.
Er sagt zu oft «fatal».
Sie zerbeißt Zuckerwürfel mit den Zähnen.
Er geht zu langsam.
Sie geht zu langsam.
Ich kaufe mir die FAZ, um sie am Abend zu lesen und dabei nach Fehlern zu durchsuchen. Wenn ich genug Belege zusammenhabe, will ich mich damit als Korrektor bewerben. Neben der FAZ, die mein Feigenblatt ist, kaufe ich im Spätverkauf eine Flasche Wein und finde das ein bisschen peinlich, schon weil es gar nicht spät ist. Ich zögere deshalb einen Moment vor dem Regal, bevor ich mich für eine Flasche entscheide, als käme es mir auf die Sorte an, während ich doch einfach abwechselnd Merlot, Dornfelder und Cabernet kaufe. Vielleicht bin ich schon Alkoholiker, das hätte ich nie gedacht, ich war doch so ein fröhliches Kind.
In den kleinen Parterrewohnungen auf unserem Hof leben Männer, denen manchmal am Wochenende von ihren Ex-Frauen ihre Kinder zugeschoben werden, die, wenn sie Pech haben, den Vätern ähnlich sehen. Im Hausflur treffe ich Sven, der, obwohl er im Parterre wohnt, nicht getrennt ist, er war schon immer allein. Er wohnt in der Wohnung unter uns und sieht manchmal bis in den frühen Morgen fern, so laut, dass ich es nicht schaffe, mich auf «die Stille zwischen den Geräuschen» zu konzentrieren und «zu beobachten, wie sie wächst». Der Tod vor dem Fernseher ist ein Phänomen der Moderne und seltsamerweise mit Scham besetzt, dabei sollte vonseiten der im Fernsehen Beschäftigten viel offener mit der Tatsache umgegangen werden, dass sie Sterbebegleiter sind. Ich hoffe, ich bin, wenn es für mich so weit ist, wenigstens so geistesgegenwärtig, noch schnell auf Arte umzuschalten. Sven öffnet gerade seinen Briefkasten und sagt stotternd: «Keine Nach… richten … sind … gute … Nach… richten.» Leider sagt er das jedes Mal, wenn man ihn hier trifft. Er sieht immer aufgedunsener aus. Er hat mir einmal angeboten, mir den Dachbodenschlüssel zu borgen, den er als Einziger im Haus besitzt, er hat schon vor allen anderen hier gewohnt. Jetzt wird das Dachgeschoss ausgebaut, und die Tür ist ausgetauscht worden, der Schlüssel ist nichts mehr wert, etwas von Svens, natürlich nur von ihm selbst empfundener, privilegierter Stellung im Haus ist wegrenoviert worden. Klara möchte, dass wir in die Dachgeschosswohnung ziehen, unsere Paartherapeuten, die uns als «Hochkonflikteltern» bezeichnen, stimmen ihr zu, wir sollten uns «entzerren». Aber die Miete wird so hoch sein, dass es mich würgt, wenn ich nachts daran denke, jede weitere Mieterhöhung würde uns das Genick brechen. Außerdem könnte ich den anderen Hausbewohnern dann nicht mehr in die Augen sehen, woher sollen sie wissen, dass ich von hier stamme und mich auf ehrliche Art von Kohleofen und Außenklo zum Dachgeschoss hochgearbeitet habe? Klara hat den Verdacht, dass Sven an seiner Wohnungstür lauscht, um immer, wenn sie mit den Kindern nach Hause kommt, in den Hausflur zu treten. Vielleicht stellt er ja den Fernseher so laut, weil es sich für ihn dann so anfühlt, als gucke er mit uns zusammen?
Ich gehe die Treppe hoch und denke daran, wie oft ich Karl diesen Weg getragen habe, wenn er im Kinderwagen eingeschlafen war. Beim Ablegen im Bett, wenn ich den Reißverschluss seiner Jacke öffnete und ihm die Schuhe abstreifte, vorsichtig, wie ein Experte vom Munitionsdienst den Zünder einer Weltkriegsbombe herausschraubt, wachte er meist auf, und ich war verzweifelt, weil ich gehofft hatte, selbst ein wenig schlafen zu können. Warum war ich damals nicht glücklich? Warum bin ich jetzt nicht glücklich? Werde ich irgendwann glücklich sein? («Das wird wahrscheinlich auf Ihrem Grabstein stehen», hat Dr. Rak gesagt.) Der Schlüssel dreht sich zweimal im Schloss, einerseits bin ich erleichtert, andererseits fühle ich mich allein, denn Klara ist arbeiten. Im Flur der Wohnung stehen ihre Hausschuhe nebeneinander und scheinen geduldig auf sie zu warten, und ich weiß nicht, ob ich mir mehr leidtue oder ihre Schuhe. Was auch immer zwischen uns vorgefallen ist, ihre Schuhe können nichts dafür.