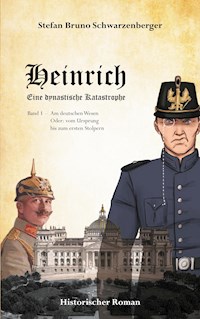Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
»Horrorjahre - Kindheit und Jugend in Moll« ist die Geschichte eines kleinen Jungen, dessen Lebensweg bis zum Ende der Pubertät mit vielen Fallgruben und Stolpersteinen gepflastert war, von physischer und psychischer Gewalt geprägt. Es ist die Geschichte einer Familie, in der sich ein von Misstrauen und Minderwertigkeitskomplexen durchdrungener Vater selbstgerecht in der Rolle des gerecht strafenden Patriarchen gefiel und sein familiäres Umfeld immer wieder tyrannisierte. Es ist die Geschichte einer Mutter, die entgegen aller Vernunft mit eisernem Willen viel zu lang an ihrem Wunschtraum einer glücklichen Familie festhielt und sich selbst verleugnete, um weitaus größere Katastrophen zu verhindern. In jener Zeit durchlebte der kleine Junge mit den großen Problemen, der über viele Jahre beinahe durchgängig an den Anforderungen der Schule und seiner Umwelt zu scheitern drohte, ein Klima massiver Angst und regelmäßiger Übergriffe seines psychotischen Vaters. Der kleine Junge zerbrach daran nicht, da er dennoch in vielen Momenten Lebensfreude und Bestätigung fand und sich mit Zähigkeit und Willensstärke seinen inneren Kern bewahrte. Dieser kleine Junge war ich. »Horrorjahre« ist der Versuch einer Aufarbeitung meiner Kindheit und Jugend.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dankbarer Erinnerung an
Luise
(17.04.1936 – 24.03.2001)
Weil du ein Drittel deines Lebens
und deine gesamte Gesundheit gabst,
um deine Söhne zu schützen.
Lieselotte
(16.03.1924 – 06.02.2003)
Weil du immer mehr gesehen hast,
als andere sehen wollten.
Für Jasmin
Einfach, weil es dich gibt
und du so bist, wie du bist.
Bleib so, denn du bist gut so.
Für Ede
Weil wir uns
trotz mancher Zwistigkeit
immer aufeinander verlassen konnten.
Kapitel
Erinnerungen, Widmungen, Foto des Autors
Kapitel- und Inhaltsverzeichnis
Über dieses Buch
Der Autor über sich
1Prolog – Vorspiel eines Dramas
2Werden und Vergehen 43
3Kein Applaus im Dunkeln
4Der Ernst und das Leben
5Keine Nilpferde
6Gleitzins, Beton, Olympia und Blitz
7Ein Traum nimmt Gestalt an
8Kohoutek, Als Odde und Wingst
9Meine neue Welt
10Bruchlandung
11Hitparade, Sport und Rantum
12Seltsamer Dress und Blechnadeln
13Zeig, was du kannst!
14Echte Erfolge und echte Jeans
15Brodenbach und Boxberg
16Ziel aufgefasst
17Lebensabschnittsabschlüsse und Neuanfang
18Epilog
Nachlese I
Nachlese II
Für alle Spätzünder
Fotoanhang – 1964 bis heute
Über dieses Buch
»Horrorjahre« ist kein einfaches Buch, es ist eher eins, das nicht vor dem Schlafengehen gelesen werden sollte. Es wird betroffen machen, nachdenklich, vielleicht sogar zornig. Es wird Fragen aufwerfen, es wird emotional aufwühlen, in Teilen vielleicht erschüttern – und es ist keine Fiktion. Es ist ein Versuch der Annäherung an einen wesentlichen Teil meiner eigenen Lebensgeschichte, die Autobiografie meiner frühen Jahre.
Alle darin enthaltenen Handlungskomplexe sind in Gänze und im Detail wie beschrieben vorgefallen, nichts wurde übertrieben oder geschönt. Einige Begebenheiten habe ich jedoch bewusst ausgeklammert, das war und ist zum Schutz betroffener Dritter ebenso notwendig wie hinsichtlich eventueller juristischer Belange zu meinem eigenen.
Meine Mutter Luise schrieb alle wesentlichen Ereignisse ihres Lebens chronologisch in mehreren Oktavheften nieder, somit können auch die Begebenheiten vor meiner Geburt und vor dem Einsetzen meiner aktiven Erinnerung ausnahmslos als hinreichend belegt gelten. Inhaltlich habe ich mich in direkter und indirekter Rede so eng wie möglich an ihren Aufzeichnungen orientiert, das war mir jedoch nicht vollständig möglich, da Luise ihre Einträge nicht durchgängig als Klartext notierte. In Momenten der Eile schrieb sie in »Steno«, internationaler Kurzschrift. Die Entzifferung ihrer Stenografie war eine »harte Nuss«. Selbst die Passagen, deren Übersetzung mir gelang, kosteten mich mehrere Monate, denn es ist mittlerweile mehr als 45 Jahre her, dass Mutter mir die Grundzüge der Kurzschrift vermittelte. Zudem hatte sie bereits in jungen Jahren viele eigene Kürzel entwickelt, an denen ich trotz konzentrierter Versuche und externer Hilfe kläglich scheiterte.
Hintergrundbeschreibungen aus Luises Notizen habe ich in der Schilderung bezüglich Wortwahl und Schreibstil der Gesamtheit meines Buches angepasst, um allzu große stilistische Brüche zu vermeiden. Geschehnisse, bei denen ich nicht anwesend war, die aber dennoch wichtig für das Gesamtverständnis sind, habe ich inhaltlich von Personen übernommen, die das Beschriebene bezeugen konnten oder noch können. Bezüglich der Vorfälle, bei denen ich zugegen war und die mich selbst emotional betrafen, konnte und kann ich mich auf mein Gedächtnis verlassen.
Verbal habe ich mich bei der Wiedergabe von mündlicher direkter Rede im Schriftverlauf insgesamt dem Idiom der jeweils sprechenden Personen angenähert und bewusst nicht einer (hyper-)korrekten Schreibweise, Grammatik oder Syntax unterworfen. So ist beispielsweise die Verkürzung vieler Worte ohne den Vokal »e« im Auslaut umgangssprachlich gängige Praxis, folglich habe ich Hilfsverben wie »haben«, »werden« oder Verben wie »gehen« im gesprochenen Wort zu »hab«, »werd« oder »geh« reduziert. Niederdeutsche Sprache (»Plattdütsch«) schreibe ich ebenso bewusst ihrem regionalen und lokalen Lautbild entsprechend, alles andere würde sich unnatürlich anhören, gestelzt und hölzern klingen. Es ist mir diesbezüglich auch herzlich gleichgültig, ob sich eventuell irgendwelche studierten Besserwisser oder »Experten« daran stören.
Vornamen und Spitznamen werden genannt, Nachnamen von Personen, die ich mir gegenüber in negativer Weise auffällig empfand, maximal mit dem ersten Buchstaben abgekürzt. Das ist wie die bereits zuvor erwähnte Ausklammerung einiger Vorfälle gleichfalls der Juristerei geschuldet. Betreffende Personen werden sich aufgrund Inhalt und Ablauf der Geschehnisse sicherlich dennoch wiedererkennen – das ist gewollt und notwendig. Damals erwachsene Personen, die ich als positiv empfand, werden teilweise mit vollem Nachnamen genannt. Eltern, Bruder, andere Verwandte und Freunde nenne ich aufgrund familiärer oder freundschaftlicher Nähe nur beim Vornamen, bei Namensgleichheit verwende ich zweite Vornamen, Ortsangaben oder andere Details zur Differenzierung.
Meinen biologischen Vater, in Kinderjahren oft mein Held und Leitbild, nenne ich in eben jenen frühen Jahren überwiegend »Papa« – so, wie es sich für diese Zeit gehört. Im weiteren Verlauf ändert sich seine Benennung über seinen Rufnamen »Edwin« hin zu »der Alte«, später dann zu »Erzeuger« und »Psychopath«. Das hat seine Gründe, die jedem recht bald offenbar werden.
Der Autor über sich
Der Autor über sich Die ersten eineinhalb Dekaden meines Lebens waren recht durchwachsen. Es war nicht nur permanenter Dauerregen, nicht nur die Sonnenseite, eher von allem etwas, wobei im Hintergrund immer die Gefahr einer neuen Katastrophe lauerte. Besser, selbstbestimmter und freier wurde mein Leben erst nach der Scheidung meiner Eltern und meinem Eintritt in die Lehre. So richtig zwanglos war es danach zwar auch nicht, es gab Jahre, in denen aus Geldmangel von Februar bis November nur kalt geduscht wurde, aber dieser unsägliche Druck, den mein Erzeuger ständig und überall aufbaute, entfiel nach seinem Rausschmiss.
Mich charakterlich dauerhaft prägend waren meine absoluten Tiefpunkte, in denen ich schon mal meinen inneren Halt zu verlieren begann und alles verfluchte. Es gab Momente, in denen ich mir allen Ernstes nichts sehnlichster als eine AK-47 nebst ausreichender Munition wünschte, C4-Nitropenta oder zumindest eine Machete, doch schaffte ich es in jeder meiner Krisen, nicht ins psychische oder soziale »Aus« abzurutschen. Diese Tiefpunkte, es waren nicht wenige, blieben mir bis heute sehr gut und dezidiert im Gedächtnis. Trotz aller Nackenschläge und Misslichkeiten gab mir das Leben dennoch verlässlich neue Kraft und neue Zuversicht, schaute ich ab Lehrbeginn eher nach vorn als zurück. Ursächlich dafür war primär die Restfamilie sowie gleichermaßen und in nur marginaler Distanz mein in den jeweiligen Zeitabschnitten bestehender Freundeskreis. »Vorwärts immer, rückwärts nimmer!« kommt mir dabei in den Sinn, und ein Schmunzeln findet seinen Weg auf meine Lippen. Wie meine Mutter Luise belege auch ich gern alle möglichen und unmöglichen Situationen mit bekannten Zitaten oder wandle diese in sarkastischer Weise ab.
Dass das Leben kein »Ponyhof« ist, wurde mir sehr früh und sehr nachhaltig aufgezeigt, doch überwogen insgesamt die positiven Aspekte, die mich immer wieder aufbauten. So ist es bis heute.
Diese von Grund auf optimistische Betrachtungsweise meines Lebens und des Lebens an sich gehört eindeutig zum charakterlichen Erbe mütterlicherseits, sie wurde mir von einigen meiner Zeitgenossen zuweilen als Zwanghaftigkeit ausgelegt, als zu belächelnder, leicht neurotischer Wesenszug. Manche meiner Sozialkontakte attestierten mir diesbezüglich sogar eine oft nur schwer erträgliche Obsessivität, eine veritable Macke, doch das stimmt so nicht. Ich kann in meiner Ehrlichkeit verletzend bis vernichtend sein, scharf analytisch, zynisch und wirklich boshaft, wenn mir jemand zu sehr auf die Füße tritt, doch das kommt glücklicherweise nicht mehr allzu häufig vor. Heute bin ich insgesamt deutlich gelassener, zudem war mir meine innere Zuversicht in schwärzesten Momenten stets ein verlässlicher Schutz, ein Panzer, der mich befähigte, ein Vielfaches dessen einstecken zu können, was negativ auf mich einwirkte – oder von dem, was ich austeilte.
Ab einem gewissen Alter wollte ich nicht so werden, wie mein Erzeuger war, und ich bin mir sicher, dies erreicht zu haben. Ja, sicherlich, auch mein Erzeuger hatte als Kriegsund Flüchtlingskind, geboren am 28. Januar 1940 in Ostpreußen eine Kindheit, die dieser Bezeichnung nicht gerecht wurde. Er verlor seinen Vater im Januar 1941, als er noch nicht einmal wusste, was ein Vater ist oder zu sein hat. Er verlor seine Mutter kurz vor Kriegsende und erlebte seine kleine, bereits damals schon in Trümmern liegende Welt als Anhängsel seiner Tante, seiner Cousinen und Cousins. Die Flucht mit seiner Ersatzfamilie vor der Roten Armee war kein Abenteuer, es muss der blanke Horror gewesen sein. Dies bestätigten mir vor vielen Jahren seine Cousins Bruno Boto Kaebert und Erhard Kaebert.
Doch all diese Erlebnisse als Entschuldigung für die fiese Boshaftigkeit und psychotisch-aggressiven Anfälle meines Erzeugers heranzuziehen, ist bei weitem zu kurz gesprungen. Es ist genau jene Art der Verharmlosung, die mich seit frühesten Jahren anwidert und tiefen Zorn in mir erzeugt. Nur, weil einem das Leben Steine in den Weg legt, muss man nicht zum braunen Ring mutieren.
Jeder Mensch hat die Möglichkeit und nach meinem Verständnis auch die Pflicht, sich zu einem halbwegs sozialverträglichen Wesen zu entwickeln. Das ist meines Erachtens die wichtigste Aufgabe im Leben. Die zweitwichtigste Aufgabe ist es meiner Einstellung nach, sich seinen Möglichkeiten entsprechend bestens zu bilden und letztlich zu lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen und verantwortlich zu handeln. Alles weitere ist Lametta, schmückendes Beiwerk. Gleichwohl gibt es Menschen, die für ihr eigenes Fehlverhalten oder Scheitern stets und ständig andere verantwortlich machen. Zu denen gehörte mein Erzeuger.
In schulischer Hinsicht hatte ich erhebliche und umfassende Anlaufschwierigkeiten, die sich bei näherer Betrachtung bis zum Ende der 9. Realschulklasse hinzogen, somit eher die Bezeichnung »Dauerzustand« verdienten. Ursächlich dafür war einerseits der seit frühester Kindheit permanent vorhandene psychische Druck meines Erzeugers, der mich in Kinderjahren immer wieder zwischen begründeten Angstzuständen und hilfloser Resignation taumeln ließ, ab beginnender Pubertät dann in unbändigen, manchmal überbordenden Zorn und maßlose Wut umschlug. In gleicher Intensität für mein ständiges schulisches Stolpern ausschlaggebend war andererseits die Funktionsweise meines Kopfes, die leider grundsätzlich nicht mit den hamburgischen Lehrmethoden der frühen 1970er Jahre harmonierte.
Die Themen »Ganzwortmethode« und »Mengenlehre«, die mich zuweilen bis zum Stillstand ausbremsten, werden sowohl in den einzelnen Kapiteln als auch in der Nachlese abgehandelt. Dass ich später überhaupt ein grundlegendes Vertrauen in die eigene Auffassungsgabe und Intelligenz fassen konnte, verdanke ich hauptsächlich meiner Mutter Luise. Sie trieb mich immer wieder an, nicht aufzugeben, weiterzumachen, und kommentierte meine häufigen Zweifel an mir selbst und der Welt recht pragmatisch: »Lass den dummen Rest doch sabbeln!“ oder „Lerne, begreife und mach deinen Weg.«
Seit etwa drei Jahrzehnten, ergo mein halbes Leben, bin ich mittlerweile als Bauingenieur tätig und scheine trotz meiner damaligen, insgesamt erheblichen Lernprobleme in der Welt der technischen Mathematik hinreichend angekommen zu sein. Als verantwortlicher Projekt- und Bauleiter ist das Erstellen von Instandsetzungskonzepten für Stahlbeton-, Spannbeton- und Stahlbauwerke seit langem ebenso mein tägliches Brot wie die dazu notwendige Bewertung statischer und dynamischer Berechnungen. Die Ausführungsüberwachung unter Beachtung und Einhaltung rechtlicher und normativer Bestimmungen gehört wie auch die projektbezogene Kostenkontrolle gleichfalls zu meinen Aufgaben.
Meine gutachterlichen Schriftsätze im Sonderbau des konstruktiven Ingenieurbaus sind seit langer Zeit orthografisch halbwegs fehlerfrei, sowohl Rechtschreibals auch Rechenschwäche meiner frühen Jahre gehören der Vergangenheit an. Okay, das eine oder andere Komma fehlt vielleicht oder verirrt sich weiterhin an falscher Position, jedoch wird die Kommasetzung mittlerweile auch als Stilmittel genutzt.
Mein beruflicher Werdegang begann mit einer Tischlerlehre, dieser Beruf war schon sehr früh eines meiner favorisierten Ziele. Die spätere Entwicklung verlief in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich, war manchmal indifferent, zuweilen ein kurzzeitig heftiges Schlingern der Interessen, doch nach jeder getroffenen Entscheidung war und bin ich äußerst konsequent, manchmal mir selbst etwas zu konservativ und zu geradlinig. Es ist zweifellos die Art meiner Mutter, das Arbeitsleben so zu gestalten, wie ich es tat, doch brachte mich diese Art dafür weiter, als ich es mir lange Zeit auch nur zu erträumen wagte.
Emotional hat sich im Laufe der Jahre ebenfalls einiges geändert. Heute, mit knapp 60 Jahren und somit in der letzten Kurve vor der Zielgeraden meines Weges, kann ich vielen vieles nachsehen, ebenso vieles einigen jedoch nicht. Im Grunde meines Herzens bin ich kein nachtragender Mensch, doch habe ich ein sehr (!) gutes Gedächtnis. Das ist das einzig brauchbare Erbe meines Erzeugers, auch wenn ich diese Gegebenheit über viele Jahre vehement in Abrede stellte. Mein Gedächtnis leistet mir seit meiner Kindheit stets sehr gute Dienste, navigierte mich verlässlich durch meine Ausbildungen, die Fachhochschulreife und mein Studium. Einmal gesehenes oder gelesenes hat bis heute eine außergewöhnlich hohe Haftkraft, ebenso emotional berührendes – all dies jedoch nur, wenn mein Kopf es als wichtig oder interessant einordnet. Leider war in frühen Jahren der notwendige Filter mitunter unzuverlässig oder ungenau justiert, sodass sich ungeheuer viel nutzloses Beiwerk mit gleicher Wertigkeit ebenfalls fest in meinem Kopf verankerte, ich mich daher oft verzettelte. Im Nachhinein betrachtet birgt jedoch genau dieses nutzlose Beiwerk häufig die Würze des Lebens, aus der man Querverbindungen ziehen kann, um vollends artfremde Sachverhalte zu verstehen. Zudem sind es die kleinen Banalitäten und Unzulänglichkeiten, aus denen ich bis heute meinen Humor schöpfe. Ein kleines »Hoppla« entfaltet oft mehr Schubkraft als salbungsvolle Reden. Hinsichtlich ihrer Schubkraft gleichermaßen verlässlich wie mein Gedächtnis waren zudem die vier stets präsenten und mich prägenden Aussprüche meiner Mutter Luise:
»Mach was aus dir und zeig, was du kannst!«,
»Lass den dummen Rest doch sabbeln!«,
»Lerne, begreife und mach deinen Weg!« und
»Neid ist die höchste Form der Anerkennung.«
Ich habe ihr leider nie genug dafür danken können.
Stefan Bruno Schwarzenberger, im April 2024
Prolog – Vorspiel eines Dramas
Hamburg war die Geburtsstadt und Heimat meiner Mutter. Geboren am 17. April 1936, hatte sie im Krieg die Kinderlandverschickung erlebt sowie die Bombennächte und die Zeit des Hungers überlebt. Ihre zwölf Jahre ältere Schwester Lieselotte war im Krieg OP-Schwester an der Ostfront. Deren beider Vater Paul Emil Martin starb am 08. Februar 1948, Lieselotte zog im November 1954 mit ihrem ersten Mann nach Billstedt, damals »weit ab vom Schuss« am östlichen Stadtrand.
Luise absolvierte eine Kaufmannslehre und baute sich ihr Leben auf. Sie hatte sehr früh außerordentlich gut verdient, war sparsam, fleißig, patent und in der Welt schon weit herumgekommen. Bereits mit 22 Jahren war sie aufgrund ihrer Fähigkeiten in mittlerer Leitungsebene in einer der bekannteren Kaffeeröstereien Hamburgs tätig, die eigenständig aus Übersee importierte. Die Kaffeebörse am Sandtorkai war ihr vertraut. Man vertraute ihrer Urteilsfähigkeit indes nicht nur in ihrem eigentlichen Aufgabengebiet, dem Rechnungswesen, der Prüfung und Bilanzierung, sondern darüber hinaus auch in vielen Belangen der Kaffeequalität.
»Fräulein Luise, unser feines Näschen« nannte sie der Geschäftsführer schon mal wohlwollend und nahm sie mit auf Geschäftsreisen. 1958 flog sie als Teil einer größeren Entourage zur Beurteilung von Roh-Kaffee in einer Lockheed Super-Constellation von Hamburg nach Rio de Janeiro und São Paulo, damals noch mit jeweils einem Zwischenstopp in Ponto Delgada auf den Azoren und dem venezolanischen Caracas. Der Flieger hatte nur etwa 6.400 km Reichweite, musste folglich zweimal aufgetankt werden. Luise war aufgeregt, sehr aufgeregt und stolz, dabei sein zu dürfen. Besonders stolz war sie auf die ihr danach erteilte Teil-Prokura.
Kurze Zeit später wurde Luise nach Hannover abgeworben und leitete in einer international tätigen Papierfabrik die Gesamtbuchhaltung sowie den Einkauf. Trotzdem hatte sie über die Zeit immer den Kontakt zu allen Teilen ihrer Familie gehalten, sowohl nach Hamburg als auch nach dem mecklenburgischen Zwenzow. Die Ostzone hatte noch keine richtige Grenze, in Zwenzow lernte sie Edwin kennen, ihren »Göttergatten«, wie sie ihn später in misslichen Momenten oft nannte. Nach dem Tod ihrer Mutter Frieda am 30. Juli 1959 kehrte Luise nach Hamburg zurück. Sie zahlte ihre Schwester Lieselotte dem Erbe nach aus, die Etagenwohnung im Reyesweg 16 gehörte ihr ab diesem Zeitpunkt allein.
Mein Vater Edwin Dieter hatte seit frühester Kindheit ebenfalls einen sehr turbulenten Lebensweg. Mit einem Großteil seiner Familie war er aus dem an der litauischen Grenze gelegenen, ostpreußischen Eydtkuhnen (Eydtkau) geflüchtet und mitten in Mecklenburg hängengeblieben. Sein Vater Adolph Kasper war einen Tag nach Edwins erstem Geburtstag gefallen, seine Mutter Charlotte Maria Schwarzenberger, na ja, über die schwiegen sich die lieben Verwandten lieber aus. Charlottes Welt war die Bühne, ihre Darbietungen konnte man auf Schellack hören, während des Krieges sang sie im Osten für Soldaten.
Nach der Flucht aus Ostpreußen wuchs Edwin bei seiner Tante Meta nebst Cousinen und Cousins auf. Er besuchte in der mecklenburgischen Provinz die Dorfschule, in der die unteren vier Jahrgänge aufgrund der singulären Anzahl der Lehrkräfte gemeinsam in einem Raum unterrichtet wurden. Für die kleinen Eleven gab es neben dem Lernpensum noch andere, wichtige Pflichten. Stand zum Beispiel die Obsternte bei hohen Persönlichkeiten wie Parteifunktionären oder Ratsmitgliedern an, fiel der Unterricht aus. Der Lernerfolg blieb dadurch insgesamt zweifelhaft, doch verfolgten die hohen Herren der Politik im Osten Deutschlands nach Kriegsende ohnehin höhere, aus deren Sicht weitaus wertvollere Pläne.
Nicht jeder wollte diesen Plänen folgen. Edwins Cousin Bruno Boto Kaebert hatte in Zwenzow die junge Eve- Marie Martin kennengelernt, in Hamburg lebend, aber gebürtig und mit familiären Wurzeln in Zwenzow. Evi besuchte regelmäßig zusammen mit ihrer jüngeren Cousine, meiner Mutter Luise, die mecklenburgische Verwandtschaft, so lernten sich dort ebenfalls Luise und Edwin kennen. War Evi wieder zurück in Hamburg, wurde Bruno das Herz recht eng, gleichermaßen erging es Edwin in Bezug auf seine Herzdame. Bruno ging dann relativ zeitnah in den Westen, denn Zwenzow, Userin und Umgebung waren eher trostlos. Ein dortiger Verbleib verhieß eine bleierne, gefestigte Perspektivlosigkeit. Bruno hatte niemanden in seine Pläne eingeweiht, nicht einmal seine Mutter Meta. Am Tag vor seiner Flucht war er wie üblich zur Arbeit auf der Useriner Mühle erschienen, am Nachmittag hatte er sich noch mit Freunden getroffen. Er gab sich kränklich, würde wohl einen Tag zuhause bleiben und am darauffolgenden erst später zur Arbeit kommen. Die Zonengrenze war noch offen, Bruno Boto kam ohne Schwierigkeiten in den Westen, er und Eve-Marie heirateten.
Durch seinen Weggang aus der ländlichen Einöde hatte Bruno in Edwin einen großen Drang nach Freiheit geweckt. Eigentlich sollte Edwin in Wismar eine Lehre als Schiffsbauer antreten, doch ersann er sich ebenfalls eine freiere Lebensgestaltung. Die Zonengrenze war nicht mehr gänzlich offen, jedoch noch hinreichend löchrig, also organisierte er sich kurzerhand ein Ruderboot und flüchtete in spektakulärer Weise aus der Ostzone. Wind und Strömung trieben seine undichte Nussschale weit hinaus auf See, elf Tage später wurde er in der nördlichen Lübecker Bucht knapp drei Seemeilen vor Großenbrode von einem kleinen Fischkutter aufgenommen.
Eine familiäre Anlaufstelle hatte Edwin in Hamburg, sein Cousin Bruno lebte seit seiner eigenen Flucht im Haus der Schwiegereltern in der Ernst-Thälmann-Straße 52 (später in »Budapester Straße« umbenannt) im Stadtteil St. Pauli. Frisch im Westen angekommen durfte Edwin zunächst bei Evi und Bruno zur Untermiete wohnen, dort traf er sich mit Luise nun regelmäßig, vorerst jedoch nicht allein. Evi und Bruno behielten die beiden im Auge, dass nicht etwas Unvorhergesehenes passierte. Edwins Mietkosten beglich Luise in der ersten Zeit.
Arbeitsmöglichkeiten gab es in Hamburg reichlich. Bruno arbeitete in Wechselschicht bei Blohm & Voss auf der Werft, durch seine Kontakte vermittelte er Edwin den ersten Job auf einem Stückgut-Frachter. Edwin bereiste als Seemann anfangs die halbe Welt, unter anderem bis nach Fort Lauderdale und Alligator Point in Florida. An Bord kam es zu mehreren Reibereien, in deren Folge er schließlich einen seiner Widersacher im Jähzorn mit einem armlangen, metallenen Marlspieker (Spleiß-Dorn) fast erschlug. Er verlor seinen Job, blieb an Land.
Zurück in Hamburg schob Edwin bei der städtischen Müllabfuhr Tonnen im Akkord, doch auch dort kam es zu verschiedentlichen Ärgernissen. Nach einem von ihm provozierten Streit rammte ihm ein cholerischer Kollege italienischer Herkunft ein Messer in den Bauch. Er war dem »Spaghetti« noch hinterhergelaufen, brach jedoch nach etwa zwei Dutzend Metern blutend zusammen. In einer Notoperation wurde sein Gedärm geflickt, Edwin überlebte. Dass er selbst ein gewisses Maß an Mitschuld an diesem Vorfall hatte, nein, so ein absurder Gedanke kam ihm trotz der ihm ausgesprochenen Kündigung nicht in den Sinn, war vollends abwegig. Luise glaubte ihm seine Version des Hergangs, denn sein Arbeitszeugnis war im Ganzen sehr wohlwollend gehalten.
Im Anschluss verpflichtete sich Edwin auf zwei Jahre bei der Bundeswehr, die bot ein gesichertes Einkommen nebst freier Verpflegung und damit das Gefühl, endlich für sich selbst sorgen zu können. Seine Kaserne in Munster lag recht idyllisch mitten in der Lüneburger Heide und somit weit weg von seiner Herzdame, doch die beiden schrieben sich zwei bis drei Briefe pro Woche. Irritiert von den ersten schriftlichen Liebesbekundungen war Luise schon, denn die Fehlerquote in Grammatik, Wort und Ausdruck darin lag bei knapp über fünfzig Prozent. Luise wollte weder herablassend, ehrenrührig oder gar ungebührlich sein, doch wollte sie ebenfalls Edwin hilfreich unter die Arme greifen. Also schlug sie vor, dass sie ihm seine Briefe korrigiert zurückschicken werde und er damit seine mangelnden Kenntnisse nachholen könne. Edwin ließ sich einerseits willig darauf ein, denn seine Zeit in der Dorfschule hatte außer massiven Lücken nichts hinterlassen, andererseits war es ihm unangenehm und peinlich, sich wie ein Schuljunge verbessern lassen zu müssen. Eine Alternative gab es nicht, denn korrektes Schreiben war unablässig für das Bestehen seiner Prüfung zur Unteroffizierslaufbahn. Er verfehlte die Prüfung im dritten Anlauf nur um Haaresbreite mit achtunddreißig von einhundert Punkten. Einundfünfzig hätte er benötigt. Dieser unwiderruflich vergeigte Auftakt beendete seine Militärkarriere, ein positiver Aspekt war jedoch, dass er die Führerscheine der Klassen eins bis drei bestanden hatte.
Nach seiner Militärzeit wurde Edwin beim damals zweitgrößten Mineralölhändler Hamburgs als Kraftfahrer anstellig, die Überschreibung seiner Führerscheine auf zivile Gültigkeit sowie die Schulung zur Beförderung von Gefahrgütern bezahlte sein Arbeitgeber in Vorauslage. Edwin war ein außergewöhnlich guter Fahrer, seinen Hängerzug beherrschte er in Perfektion und bekam manchmal sogar ein joviales Schulterklopfen für seine Fähigkeiten. Ihm vertraute man recht schnell die vertracktesten Touren an.
Edwins sozialen Defizite hatten sich hingegen seit seiner Kindheit derart verfestigt, dass auch sein neuer Kollegenkreis ihn lieber mied. Die Stadt und die Menschen darin wären natürlich schuld an seiner Misere, polterte er regelmäßig, in der Stadt seien Luft und Klima ungesund, die Menschen schlecht. Er wusste das ganz genau und untermauerte dieses Wissen mit dem Verweis auf den »linken Spaghettifresser« bei der »Mülle«.
Trotz seiner damals schon auffälligen Macken schien Edwin mit seiner außergewöhnlichen Vitalität uns seinem jugendlich-frischen Charme eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf meine Mutter ausgeübt zu haben. Die beiden wurden von der Verwandtschaft endgültig verkuppelt, da Edwin anfangs insgesamt und bei Tageslicht besehen trotz allem ein brauchbarer Kerl zu sein schien. Zudem war er Bruno Botos Cousin und Luise Evis Cousine. Die Familie hält eben zusammen.
Luises ältere Schwester, meine Tante Lieselotte, besaß vor allem durch ihre Kriegserlebnisse eine ausgeprägte Kenntnis der menschlichen Psyche einschließlich aller Facetten derer möglichen Fehlbildungen, Abnormitäten und Deformierungen. Bereits deutlich vor Luises erster Schwangerschaft war Lotte die Erkenntnis gekommen, dass Edwin ein sehr spezieller Kandidat sei, doch was sollte sie tun? Luise tat sich mit der Erkenntnis ihrer Schwester schwer, dass doch nicht alles in Ordnung war, denn das wäre ihr ein Eingeständnis einer getrübten Urteilsfähigkeit gewesen. Also hielt Luise unbeirrt und vielleicht auch aus ihrer Verliebtheit heraus etwas naiv an dem Glauben fest, dass sich erstens jeder Mensch zum Guten hin ändern könne und zweitens eine Familie nur Edwins guten Seiten hervorkehren würde. Wie fatal dieser Irrtum war, sollte sie später noch feststellen.
Edwin hegte seinerseits instinktiv ein ebenso tiefes Misstrauen gegenüber Lieselotte wie seinen Groll gegenüber dem Rest der Welt. Er dachte so bei sich, dass es wohl das Beste sei, Deutschland endgültig den Rücken zu kehren, also begann er, Luise davon überzeugen zu wollen. Luise war ihrerseits »in der Welt« zuhause, konnte sich ebenso gut vorstellen, ihr Glück an jedem Platz derselben zu finden. Edwins Idee fiel folglich auf fruchtbaren Boden. Sein Traum war Australien, diametral um den Erdball herum und somit in weitestmöglichem Abstand zu seinem Cousin Bruno Boto und der garstigen Schwester seiner Herzdame – eben jenen beiden Menschen in seinem direkten Umfeld, die er im tiefsten Innersten fürchtete und zugleich verachtete.
Am 05. Januar 1961 nahm Luise schriftlichen Kontakt zum Büro der australischen Botschaft in Bonn auf, damals im Hohenzollernring 103. Sie schrieb in englischer Sprache, so, wie sie es in der Schule erlernt und im Beruf verbessert hatte, anbei legte sie Kopien ihrer Arbeitszeugnisse. Ihre bisherige berufliche Laufbahn war tadellos, die Zeugnisse beschrieben eine internationale Expertise.
Bereits am 15. Februar 1961 bekam sie direkt aus Canberra Antwort per Luftpost. Das Schreiben enthielt mehrere Fragebögen zu ihrer Person, zum Familienstand und zu den Qualifikationen des erwähnten Mannes. Ihre Ausbildung und Berufserfahrung sei hinreichend belegt und gern gesehen (»exellently trained and skilled, … with relevant professional experience, …«), und ja, für den Mann werde sich auch etwas adäquates finden (»… and we´ll surely find some adequate work that correspondes to the education and skills of your future husband«).
Zwei Tage später schrieb Luise erneut an die australische Botschaft in Bonn, eine direkte Antwort an das Immigration Office in Canberra schien ihr zu forsch. Es musste eben alles seine Ordnung haben. Sie fügte Kopien von Edwins Seefahrtsbuch und seinen Führerscheinen hinzu, zudem eine Kopie des Zeitungsartikels, der seine waghalsige Flucht aus der DDR in einem undichten Ruderboot dokumentierte. Sie war überzeugt, das würde Edwins Durchhaltewillen verdeutlichen. Luises Antwort hinterließ tatsächlich nachhaltigen Eindruck. Am 13. März 1961 erhielt sie wieder Antwort aus Canberra, es war die Zusage zur Einwanderung ohne weitere Bedingungen. Luise notierte freudig in ihrem Oktavheft, dass nun bald alle Probleme überwunden wären.
Leider überschnitt sich die Einwanderungserlaubnis mit Luises erster Schwangerschaft, mein älterer Bruder schickte sich an, die Welt zu erobern. Am 28. April 1961 heirateten meine Eltern. Das war wohl insgesamt eine sehr ambivalente Sache. Einerseits wollte Luise ihrem Mann und ihrer Familie alles ermöglichen, andererseits stand der Auswanderung das nun werdende Leben entgegen, diesbezüglich vor allem Luises Überzeugung der Überlegenheit einer geburtlichen Vor- und Nachsorge im eigenen Land. Mutter suchte mit aller Diplomatie nach einer Lösung. Sie schlug vor, Edwin möge doch schonmal vorab auswandern, sie käme dann mit dem Kind nach. Diese Idee befeuerte wiederum Edwins pathologisches Misstrauen. Er machte Luise zum Vorwurf, sie habe das alles nur inszeniert, um ungestört ein bestehendes Verhältnis, wer immer der betreffende auch sei, ausleben zu können. Edwin war überzeugt, Luise wolle ihn quasi beiseite räumen.
„Die wollte mich gleich zu Anfang weghaben!“, grollte er später regelmäßig.
Es wurden anstrengende Monate für die werdende Mutter. Edwin hatte nämlich alles darangesetzt, das kleine Glück, das ihm unverhofft in den Schoß gefallen war, umgehend wieder zu zerstören. Die gesamte Schwangerschaft hindurch nagten massive Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe an seiner labilen Psyche, nährten und verfestigten ein selbstkonstruiertes Gespinst aus Mutmaßungen und dem Verdacht, er sei nicht der leibliche, also wahrhaftige Vater.
Mit dem desillusionierten Ausspruch »Fünf Minuten Glück, neun Monate Terror« hatte Luise sich Lieselotte gegenüber in einem schwachen Moment offenbart. Lotte argwöhnte, Edwins Geisteszustand sei bedenklich.
Nach der Geburt seines ersten Sohnes am Freitag, den 27. Oktober 1961, glätteten sich die Wogen vorerst. Edwin sah in das Gesicht dieses properen Bürschchens und damit in einen Spiegel. Der stammte eindeutig von ihm ab. Mutter blieb als Wöchnerin samt Kind in der Klinik, war erschöpft, aber wohlauf. Alle anderen feierten in der Budapester Straße die Ankunft des neuen Erdenbürgers mit reichlich Bier und Schnaps. Lieselottes Mann Adolf Christmann verlor auf dem Heimweg nach Billstedt mit sensationellen 2,6 Promille seinen Führerschein, was meinem Bruder den Beinamen »teurer Neffe« einbrachte. Abgesehen von dieser kleinen Unpässlichkeit schien alles auf dem richtigen Weg zu sein, Edwin, nun stolzer Vater, war glücklich und friedfertig. Noch.
Als Edwin vierzehn Monate später im Rahmen der gesamtfamiliären Silvesterfeier 1962/63 bei Evi und Bruno Boto in der Budapester Straße alkoholumnebelt kurz nach Mitternacht prahlte, was für einen prächtigen Sohn er da gezeugt habe, kommentierte sein Cousin augenzwinkernd, ja, das sei wohl richtig, jedoch habe er, Bruno Boto, dem Buben »die Ohren besäumt«. Das war in Edwins Ohren kein Humor, denn diesbezüglich hatte er keinen. Das war eine Kampfansage! Eine Kriegserklärung! Wenn das der Wahrheit entspräche, wäre der Junge ein Kuckuckskind, Edwin selbst somit der bedauernswerteste Trottel südlich des Nordpols. Nach neunmonatigem Terror und einer nur wenig längeren Zeitspanne der Beschaulichkeit stand Edwins Misstrauen gegen alles und jeden wieder in voller Blüte. Die traute Kleinfamilie verließ überstürzt die Feier, der kurz zuvor noch überstolze Vater fluchend voran. Eine Dreiviertelstunde später im Reyesweg 16 in Barmbek angekommen, wurde Edwin in der Neujahrsnacht 1963 erstmals übergriffig, schlug hart zu.
Lotte konnte es nicht ertragen, dass ihre kleine Schwester derart abartig traktiert wurde. Die beiden Schwestern sprachen lang, Lottes Mann Adolf hörte betroffen zu. Lotte kam eine pragmatische, aber folgenschwere Idee, die den schwesterlichen Zusammenhalt für lange Zeit nachhaltig stören sollte. Sie machte den Vorschlag, Luise solle sich umgehend von Edwin trennen, dann könne sie wieder arbeiten gehen und ihr Kind ohne einen terrorisierenden und prügelnden Gatten großziehen. Auf Luises Einwand hin, dass das in ihrem Beruf nicht ginge, entgegnete Lotte, der Junge könne vorerst bei ihr bleiben. Luise war empört und wies das Ansinnen brüsk zurück. Erst schlug der Mann, dann wollte ihr die Schwester das Kind wegnehmen. Natürlich war das so, denn Lotte hatte keine eigenen Kinder. Luise fühlte sich verraten und verkauft, die Einträge in ihrem Oktavheft verfasste sie eindeutig und unmissverständlich. Hatte sich denn jetzt die ganze Welt gegen sie verschworen?
Nach den Tränen der Wut und der Enttäuschung über einen solchen Verrat folgte eine mehrmonatige Zeit der Stille. Alle Versuche einer Annäherung blockte Luise konsequent ab, jegliche Art der Intervention wurde von ihr bissig zurückgewiesen. Selbst die Schwager Adolf und Bruno Boto hatten ihre Karten verspielt, Luise ließ jeden auflaufen. Wahrscheinlich hatte Edwin doch recht, vielleicht waren seine Ideen doch nicht so spinnert? Schließlich wollte die Schwester ihr das Kind abspenstig machen und Edwin hatte immer wieder vor Lieselottes schlechtem Wesen gewarnt. Die und ihr Mann schafften es nicht, eigene Kinder in die Welt zu setzen, verfolgten nun offenbar perfideste Pläne. Was hatte die große Schwester denn schon zu bieten? Luise wusste um ihre eigenen Fähigkeiten und zudem detailliert um die Stolpersteine in Lieselottes Leben, demnach war die Sache klar wie Kloßbrühe.
Man schrieb sich zwar Glückwunschkarten zu den Geburtstagen, feierte verhalten ein paar gemeinsame Feste, die sich nicht vermeiden ließen, blieb jedoch insgesamt auf Abstand. Luise wollte ihr Leben selbst meistern, ganz ohne schlaue Ratschläge, gänzlich ohne die Möglichkeit, von der eigenen Schwester über den Tisch gezogen zu werden. Den Kontakt zur australischen Botschaft behielt sie bei.
Etwa zwei Jahre nach Geburt ihres ersten Kindes nebst vorangegangener Heirat wollte Mutter eigentlich wieder arbeiten, doch Edwin verbot es ihr. Zwar durften Frauen mittlerweile nach dem Gleichberechtigungsgesetz von 1958 ohne Erlaubnis ihres Ehemannes arbeiten, dies bis 1977 jedoch nur, wenn es »mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar« war. Da Edwin sich trotz allen Charmes sehr früh als psychopathisch-dominant entpuppt hatte, war dieses Thema umgehend tabu für ihn, seine Verweigerung vorhersehbar. Er war der Herr im Haus, er war der Ernährer. Dass seine Frau schon vor der Ehe mehr als das Vierfache seines damaligen Salärs verdient hatte, empfand er als tiefsitzende Schmach, als persönliche Herabwürdigung. Dieser Dorn steckte tief im Fleisch, das Leben war so ungerecht.
In Edwins Augen lief doch alles perfekt, wie es war. Luise versorgte das Kind, war Hausfrau und Mutter und in gewisser Weise vielleicht sogar glücklich. Sie bereitete dem Gatten die Stullen und den Kaffee für den Tag, bespaßte den gemeinsamen Nachwuchs, hielt die Wohnung sauber oder klönte tagsüber mit den Nachbarn. Abends stand sie auf dem Bürgersteig und erwartete voll Freude und Hingabe die Rückkehr ihres heldenhaften Mannes. Wie so oft kam es auf die individuelle Sicht der Dinge an.
Das getroffene Arrangement lief eine gewisse Zeit passabel, doch Luises Weltoffenheit drohte wieder Oberhand zu gewinnen. Ihre wachsende Unzufriedenheit zeigte sich nicht als offener Widerstand gegen das, was Edwin als einzige gesellschaftlich anerkannte Ordnung verstand, sondern eher als ein zaghaftes Herantasten an bestehende Grenzen. Edwin witterte Ungemach, seine Instinkte waren sofort hellwach. Wie hätte er auch nur ernsthaft glauben können, dass eine Frau wie Luise dauerhaft mit Herd und Heim glücklich und zufrieden sei? Also war es besser, relativ zeitig erneut Nachwuchs anzusetzen. Edwin war überzeugt, das werde seine Frau schon bald auf andere Gedanken bringen, ihr deren eigentliche Bestimmung aufzeigen.
Im Sommer 1963 war es dann so weit. Luise und Edwin wollten nachlegen, hielten zusammen gegen die bucklige Verwandtschaft und die böse Welt.
Am 30. August 1963 schrieb sie hoffnungsvoll in ihr Oktavheft:
»Morgen wird alles gut. Morgen ist Edwin zuhause und muss nicht noch am Sonnabend fahren. Wir werden tagsüber schön im Stadtpark spazieren gehen, und wenn die Sonne scheint, wird Eddi vielleicht ein wenig im großen Rundbecken planschen. Ich werde uns was schönes zu Essen kochen und wir werden wieder eine glückliche Familie sein. Es wird so werden, wie es sein soll. Und wenn alles klappt, bekommen wir wieder Nachwuchs. Dann wird alles gut, denn eine werdende Mutter wird nicht geohrfeigt. Edwin wird sich beruhigen und ändern, das weiß ich, denn eigentlich ist er kein schlechter Mann. Er hatte nur eine sehr schwere Kindheit.«
Auch Luises zweite Schwangerschaft mit mir wurde zur echten Tortour. Edwins tiefverwurzeltes Misstrauen gegen jeden im Allgemeinen und seinen Cousin Bruno Boto im Besonderen entflammte erneut.
Am 26. Dezember 1963 traf sich die Familie in der Budapester Straße erstmalig nach langer Zeit wieder halbwegs gelöst und fröhlich. Lediglich Edwin blieb seiner Natur entsprechend argwöhnisch, versuchte sich aber in Anpassung an die allgemeine Feierlaune dennoch etwas in Offenheit und Konversation. Gänzlich spannungsfrei war er nie. Als Luise allen freudig erklärte, sie sei im vierten Monat und alles sei in Ordnung, schaute Lotte ihr tief und fragend in die Augen.
„Wirklich alles?“
Lieselotte kannte Luise nur zu gut, wusste um den unerschütterlichen Optimismus ihrer Schwester, doch konnte sie ebenfalls Edwin sehr präzise einschätzen. Der war sofort bereit.
„Natürlich alles, wenn Luise das sagt! Du solltest sie kennen“, grolle er.
„Eben drum“, konterte Lieselotte provokant.
„Lotte. Es ist gut!“, schlichtete Luise in beginnender Schärfe.
„Ich frag doch nur, lieb´ Schwesterlein“, säuselte Lotte.
„Lieselotte! Es ist gut, jetzt!“, schob Luise barsch nach.
Bruno Boto konnte es nicht lassen. Eher nebensächlich, nicht einmal direkt an Edwin gewandt, lästerte er nonchalant in den Augenblick der Stille hinein.
„Na, Edwin, dann erzähl doch mal, wie und wo … lass mal hören, von deinen großen Taten.“
Das war offensichtlich zu viel für Edwins gebeutelte und empfindsame Seele.
Mutters Oktavheft sagt aus, dass sie und Edwin die Feier deutlich vor der Zeit verlassen hätten und dass leider einige Weihnachtsgeschenke für den Sohn dort vergessen worden waren. Zwar gab es danach keine Einträge von Übergriffen Edwins, Luise beschrieb sehr betont eine friedliche, fast harmonische Zeit, doch wer zwischen den Zeilen zu lesen vermag, dem offenbart sich ein differenzierteres Bild: Fünf Minuten Glück, neun Monate Terror. Erstmalig verwies Edwin in gesichertem Wissen um die Rechtslage ausdrücklich darauf, dass ihm seit der Heirat »die Hälfte von allem« gehöre – und weil er der Ernährer sei, wohl noch etwas mehr.
Im Januar 1964 schrieb Luise erneut an die australische Botschaft und erklärte, dass der Wille zur familiären Auswanderung weiterhin bestünde, jedoch private Ereignisse (»private matters«) die Umsetzung leider verzögerten.
Werden und Vergehen
Am 09. Juni 1964 wurde ich geboren. Stichtag war der 31. Mai (nein, der eigentliche »Stichtag« war neun Monate vorher), doch ich ließ mir etwas Zeit. Als Mama sechs Tage nach meiner Geburt mit mir aus der Klinik Finkenau kam, mich stolz in eine weiche Decke gewickelt in die Wohnung trug, reagierte mein Bruder bestürzt bis panisch. Er war nun nicht länger der alleinige Sonnenschein. Mit seinen zweidreiviertel Jahren spürte er instinktiv, dass seine Alleinherrschaft über Spielzeug und Kinderzimmer abrupt und unwiederbringlich vorüber war.
„Mama, bring das Baby wieder weg!“, bettelte er voller Entsetzen.
Okay, ich war nur körperlich zugegen, bekam von dem kleinen Drama nichts mit, doch lachte die Familie später immer wieder herzlich über die Angst meines Bruders, die elterliche Aufmerksamkeit von nun an teilen zu müssen.
Edwin beruhigte sich nach meiner Geburt tatsächlich merklich. Er hielt seinen allumfassenden Argwohn im Zaum, die nun vierköpfige Durchschnittsfamilie durchlebte eine angenehme Zeit. Das Verhältnis zwischen Luise und Lieselotte hielt sich zwar weiterhin in überschaubarem Rahmen, was beide sicherlich bedauerten, doch die emotionale Demarkationslinie war äußerst stabil. Luise hatte einen veritablen Dickschädel, Lieselotte konnte hervorragend schmollen, beide sahen sich in der Rolle der zu Unrecht gescholtenen. Keine wollte den ersten Schritt machen, denn Nachgeben werteten beide gleichermaßen als Zeichen der Schwäche und als Eingeständnis der eigenen Fehlsicht. Der schwesterliche Zwist wurde erst an meinem ersten Geburtstag durch einen dramatischen Vorfall vollends geheilt.
Über Monate hatte Lottes Mann Adolf mehrfach geäußert, dass er am liebsten heimgehen wolle, er fühle sich fremd in dieser Welt. Luise sprach mit ihm, sagte, wenn er derartiges Heimweh habe, müsse er eben zurück in seine Heimat, doch Adolf schüttelte betrübt den Kopf. Seine Heimat sei Freudental, etwa 20 Kilometer westlich von Odessa, und das sei für ihn unerreichbar. Er meine sein »Heimgehen« in anderer Weise.
Am Mittwoch, den 09. Juni 1965, wollten Lotte und Adolf nachmittags nach Barmbek fahren, um meinen ersten Geburtstag gebührend zu feiern. Lotte machte sich in der Parterrewohnung noch ausgehfein, Adolf war bereits in der Kellergarage. Anfangs rief sie ihn noch fröhlich bei seinem Spitznamen »Atsche«, sein richtiger Vorname war seit gut 20 Jahren etwas verpönt und in Verruf geraten, doch es kam keine Antwort. In zunehmender Schärfe rief sie nach ihm, doch eine Reaktion blieb weiterhin aus. Nichtbeachtung war für Lieselotte nur schwer erträglich, zudem gehörte diese Art absolut nicht zu Adolfs Naturell. Lottes Verstimmung schlug in ein ungutes Gefühl um, das sich mit jeder ausbleibenden Antwort steigerte. Mit beklemmender Vorahnung ging sie hinunter in den Keller, dort fand sie ihn. Adolf Christmann hatte sich mit einer zur Kordel geflochtenen Wäscheleine an der Decke der Garage erhängt.
Mama erfuhr von dem Vorfall erst Stunden später. Wir hatten noch kein Telefon, also war sie mehrfach zu unserer Nachbarin Henriette gegangen, um sich von dort aus telefonisch nach Lottes und Adolfs Verbleib zu erkundigen. Nach vielen Versuchen erreichte sie Lieselotte endlich und erfuhr, was geschehen war. Luise eilte umgehend zur nächsten Bahnstation und fuhr zu ihrer Schwester, um Beistand zu leisten.
Nur wenige Wochen später stand ein fremder Mann vor Lottes Tür, ein netter Herr mit sonorer Stimme und deutlichem Akzent aus dem Osten. Er stellte sich höflich und charmant als Bruno Mantel aus Freudental bei Odessa vor und fragte nach Adolf Christmann, seinem besten Freund aus Kindertagen. Lotte bat Bruno herein, kochte Kaffee und erklärte ihm, was kürzlich vorgefallen war. Beide fanden ineinander Trost, sie blieben ein Leben lang zusammen.
Kein Applaus im Dunkeln
Insgesamt waren meine ersten drei Jahre schon okay. Anfangs lag ich meistens weich gebettet herum oder krabbelt etwas später ziemlich orientierungslos durch meine kleine Welt. Ich bekam meine Flasche, später den ersten Brei, und hatte mit Beißring, Ball, Rassel oder ähnlichem Krimskrams den lieben, langen Tag über genug zu tun. Ich beschwerte mich über eine volle Windel, quengelte über durchschiebende Zähne oder als tägliches Ärgernis über die eigene Machtlosigkeit, wenn eine höhere Instanz unwiderruflich den Mittagsschlaf anordnete. Der Rest der großen, weiten Welt war noch überwiegend unerforscht und lag erst außerhalb des Gitterbettes, danach hinter der Wohnungstür. Die Instanzen »Vater« und »Mutter« bildeten fortan eine fest betonierte und absolut hierarchische Einheit, bei der jeder Widerstand, jedes Aufbegehren ab einem gewissen Punkt zwecklos blieb.
Die ersten Grenzen waren gesetzt, die hatte ich widerspruchslos zu akzeptieren, akzeptierte diese sogar häufig, weil Vater und Mutter es schließlich gut mit mir meinten. Ebenso oft opponierte ich aber auch, übte mich in frühkindlichem Widerstand, doch mein Scheitern war stets vorprogrammiert, weil Eltern einfach stärker sind. Da konnte ich brüllen, bis der dünn behaarte Schädel puterrot wurde, strampeln und heulen, bis die Fontanelle pochte. Jedes Kind kennt das. Jedes Kind schläft dann mehr oder weniger rasch aus Erschöpfung ein, doch nach dem Aufwachen ist alles wieder in Ordnung ... meistens in Ordnung, nur leider nicht immer.
Meine überschaubare, heile Welt bekam ihren ersten Riss, als ich zu Beginn der Nacht von Sonnabend, den 10. auf Sonntag, den 11. Juni 1967, durch ungewöhnliche Geräusche geweckt wurde. So richtige Nacht war es eigentlich noch nicht, eher Abend, doch schon dämmrig, und das Rollo am Fenster war heruntergezogen. Weil ich mit meinen drei Jahren recht früh ins Bett musste und die Zeit als solche für mich noch eine eher nachrangige Bedeutung hatte, war es in meinen Augen Nacht. Anfangs davon überzeugt, ich würde träumen, waren diese Geräusche nach dem Aufwachen dennoch weiterhin klar und deutlich zu hören, wenn auch gedämpft durch die Kinderzimmertür. Da war Papas eigenartig monotone Stimme, zwischendurch mehrfaches Klatschen. Als ich tags zuvor die drei Kerzen auf meinem Geburtstags- Käsekuchen auspusten durfte, hatten auch alle vor Freude geklatscht. Hatte schon wieder jemand Geburtstag?
Mehrfach glaubte ich Mama weinen zu hören, doch das konnte nicht sein. Wieso sollte Mama weinen? Gestern war ich glücklich über all die Geschenke, den Käsekuchen und die drei Kerzen, und Mama war glücklich, weil ich glücklich war. Vielleicht weinte sie, weil mein Geburtstag vorbei war, aber das konnte auch nicht sein, denn selbst ich, um den sich gestern noch alles gedreht hatte, fand den vorherigen Tag toll. Komisch war das alles, sehr komisch. Im anderen Bett wimmerte mein Bruder, antwortete aber nicht sofort, als ich ihn leise ansprach. Tat ihm irgendwas weh? War er sauer, dass in meinem Geburtstagskuchen Rosinen waren, die er so überhaupt nicht mochte? Die hatte er mit Mamas Erlaubnis aus seinen Stücken rauspulen dürfen, also war doch alles in Ordnung. Leise flüsterte ich ihm in der Dunkelheit zu. Und noch einmal.
„Sei doch still!“, zischte er angespannt.
„Sei doch endlich still!“, kam es bestimmend, als ich ihn drittmalig flüsternd ansprach. Ich hörte auf ihn. Er war schließlich der Ältere, damals mein Vorbild und Idol, dem ich nach Kräften nachzueifern versuchte. Also fragte ich nicht weiter. Kurze Zeit später wurde es wieder ruhig, doch einfach wieder einschlafen konnte ich nicht. Die zuvor gehörten Geräusche waren zu seltsam, als dass ich sie unbedacht vergessen konnte.
Nach einer weiteren, für mich nicht abschätzbaren Zeitspanne waren da erneut Geräusche, diesmal aber andere. Unterdrücktes Keuchen, Stöhnen, Grunzen, einmal ein eher hilflos klingendes »Edwin … aua«. Waren da etwa Monster, mit denen Mama und Papa kämpften? Verängstigt zog ich mir die Decke bis zum Hals und starrte ins Dunkel. Irgendwann kam Mama ins Kinderzimmer und setzte sich zu meinem Bruder ans Bett. Sie sprach leise mit ihm, strich ihm über die Stirn. Mein Bruder fragte leise etwas, was ich aber nicht verstehen konnte.
„Das hast du alles nur geträumt, alles wird wieder gut“, hörte ich Mama flüstern.
„Warum weinst du, Mama?“, fragte Eddi. Er war ebenfalls bemüht, zu flüsterte.
„Weißt du, manchmal tun Erwachsene dumme Dinge … und wenn die ganz besonders dumm sind, dann weinen sogar Erwachsene.“
„Hast du was Dummes getan, Mama?“
„Nein, mein Schatz, ich hab mich nur so doll über Stefans schönen Geburtstag gefreut. Weißt du, manchmal weinen Erwachsene auch, wenn sie sich ganz doll freuen.
Auf deinen Geburtstag freu ich mich auch schon.“
Eddi dachte kurz nach.
„Wenn ich Geburtstag hab, dann sollst du aber nicht weinen, Mama.“
Sie küsste ihn nochmal auf die Stirn, ging zu meinem Bett und strich mir über den Kopf. Ich atmete flach, hielt die Augen zu, dann schlief ich ein.
Am nächsten Morgen, das Rollo war bereits oben, hatte Mama rote Augen und eine auffällig rote Stelle auf der linken Wange. Mama erklärte mir, sie habe beim Nachdenken ihren Kopf zu lang auf eine Hand gestützt, dann sehe es nun mal so aus, wie es aussieht. Als ich fragte, warum sie denn nicht auch mal die andere Seite zum Aufstützen benutzt habe, wurde Mama ernst und nachdenklich, hatte einen seltsamen, für mich nicht zu deutenden Gesichtsausdruck.
„Ach, mein Schatz“, seufzte sie, „die eine Seite reicht mir erstmal. Die andere kommt dann wohl später … kommt ganz bestimmt noch dran. Ich sollte in Zukunft weniger nachdenken.“
Ich war mir sicher, sie war traurig, das machte mir ein flaues, diffuses, undefiniert beklommenes Gefühl. Andererseits hatte Mama mir die Angelegenheit verständlich erklärt, der Vorfall war für mich damit erledigt. Nacheinander nahm sie Eddi und mich auf den Arm und drückte uns beiden jeweils ein Küsschen auf die Wange.
Eben weniger als vier Monate später, am 27. Oktober 1967, wiederholte sich das Szenario in leicht veränderter Form. Mein Bruder hatte Geburtstag, sein Käsekuchen enthielt keine Rosinen und seine Geschenke entsprachen seinem Alter. Die waren so viel interessanter als meine, doch Eddi wollte partout nicht zulassen, dass ich mit seinen Geburtstagssachen spielte. Ärgerlich war das schon, gemein und ungerecht, weil er schließlich auch mit meinen Sachen spielte. Aber egal, wenn ich so alt wie er sein würde, wären meine Geschenke mindestens ebenso interessant. Dass der Altersunterschied zwischen uns dauerhaft Bestand haben wird und Eddi somit regelmäßig Geschenke bekommen würde, die um so vieles interessanter als meine wären, erkannte ich noch nicht. Das war vorerst aber auch nebensächlich.
Am späteren Abend glaubte ich, in einer Wiederholung zu leben, einer Zeitschleife. Kaum, dass wir Kinder in den Betten waren, veränderte sich Papas Stimmung. Seine Stimmlage wurde monoton, er sprach über die schlechte Welt im Allgemeinen und seine schlechte Welt im Besonderen. Mein Bruder begann schneller zu atmen, dann zu wimmern. Ich durfte ihn ja nicht fragen, sollte doch »endlich still