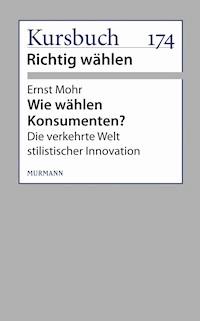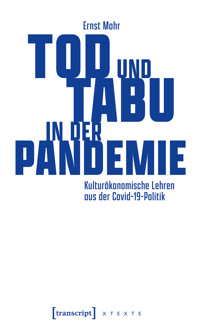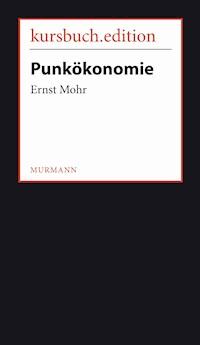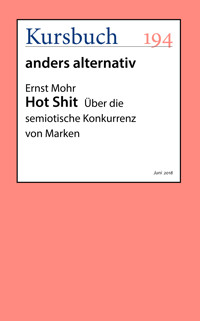
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kursbuch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die These, die Ernst Mohr, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen, in seinem Beitrag im Kursbuch 194 entwickelt, lautet: Die Marke, Ikone des Kapitalismus, wird zum Regelbrecher des Kapitalismus, denn die Alternativen, die es in ihm gibt, werden nicht nach seinen Regeln produziert. Unternehmen tun, was sie im Sinne ihres eigenen Erfolgs tun müssen, sie branden, um ihre Produkte zu einer Alternative im Markt zu machen. Sie seien damit erfolgreich, so Mohr, wenn ihr Produkt als alternativlos zurückbleibt. Und nur wenn das Branding in dieser Form scheitert, schafft es tatsächlich Alternativen. So sei die Alternativlosigkeit dem Erfolg und der Alternativenreichtum dem Misserfolg unternehmerischen Handelns geschuldet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Ernst MohrHot ShitÜber die semiotische Konkurrenz von Marken
Der Autor
Impressum
Ernst MohrHot ShitÜber die semiotische Konkurrenz von Marken
Früher gab es im Einzelhandel nur Waren wie Mehl, Zucker, Gemüse, Fisch, Butter, Kernseife, Milch zu kaufen – Güter so alternativlos wie unsere Grundbedürfnisse. Es gab nur Ware, die sich zur Bedürfnisbefriedigung ergänzte, sogenannte Komplemente, wie die Ökonomen sagen. Heute wartet auf uns in den Supermärkten ein kaum mehr überschaubares Angebot an Marken in jeder einzelnen Produktkategorie (bis hinab in jede einzelne Subkategorie) – Güter also mit einer Vielzahl an Alternativen, sogenannte Substitute, wie die Ökonomen sagen.
Diese Entwicklung von der Alternativlosigkeit zum Alternativenreichtum ist weniger dem technischen Fortschritt geschuldet als dem Fortschritt im Branding – einem Prozess der Bedeutungsverleihung von Dingen. Ware – Dingen mit identischer Funktionalität – wird im Branding spezifische und damit unterschiedliche Bedeutung verliehen. So entstehen aus funktional identischen Dingen unterschiedliche Objekte mit alternativen Bedeutungen, die wir als Marken kennen: Aus einem Mittel gegen den Reizmagen wurde Coke oder Pepsi, aus Suppenwürze Maggi oder Tellofix, aus Kaffee Dallmayr-, Eduscho-, Darboven-, Eilles-, Illy- usw. Kaffee, aus Benzin wurde Esso, Agip, Shell oder BP, und aus einem Automobil wurde Mercedes, BMW, VW, Audi, Fiat, Rolls-Royce oder Tata Motors.
Der technische Fortschritt vergrößert lediglich den Reichtum an Produktsubkategorien: 95-, 98-Oktan-Benzin; Mittel-, Ober- und Luxusklasseautos; Verbrennungs-, Hybrid- und Elektromotor; Bohnen- und Kapselkaffee. Erst das Branding bringt den Alternativenreichtum in die Welt: 95-Oktan-Benzin von einer ganzen Handvoll verschiedener Tankstellenmarken, fast jeden Fahrzeugtyp gibt es von mindestens einem Dutzend Automarken, Kaffee von 1000 gebrandeten Röstereien. Vom Wein, den wir am Etikett erkennen, ganz zu schweigen.
Branding macht die Welt alternativenreich, so jedenfalls die ins Auge stechende Evidenz. Unser Dank dafür gilt dem Branding der Unternehmen! Aber ist es tatsächlich so? Und falls ja, wem gebührt der Dank wirklich? Die folgenden Überlegungen dazu kommen zu einem paradoxen Schluss: Unternehmen branden, um ihre Produkte zu einer Alternative im Markt zu machen. Ist ihr Branding besonders erfolgreich, bleibt ihr Produkt als alternativlos zurück; nur wenn das Branding in einem zu präzisierenden Sinn scheitert, schafft es tatsächlich Alternativen. So ist die Alternativlosigkeit dem Erfolg und der Alternativenreichtum dem Misserfolg unternehmerischen Handelns geschuldet.
1. Marke als Alternative
Funktional ähnliche Ware wird zu den Produktionskosten gehandelt. Unternehmen erwirtschaften damit einen Gewinn, der ihr unternehmerisches Risiko entgilt, aber nicht mehr. Kein Unternehmen rentiert sich so wirklich, jedenfalls nicht in einem ordentlich funktionierenden Markt. Erst wenn es ein Unternehmen schafft, seine Ware aus dem Gros des Konkurrenzangebots herauszuheben, sind größere Gewinne möglich. Bei funktional identischen oder sehr ähnlichen Produkten gelingt dies, wenn das Ding ohne Bedeutung, das alle verkaufen, in ein Markenobjekt, das heißt in ein Objekt mit einer speziellen Bedeutung verwandelt wird. Dessen Bedeutung hat sich dann in unseren Köpfen festgesetzt und wird aktiviert, wenn wir von der Marke stimuliert werden: »Gute Nahrung aus unserer Kindheit« (Nestlé), »The real thing« (Coke), »Glamour« (Prada), »Prätentionslosigkeit« (Birkenstock) usw. Diese Transformation von Ding zu Objekt ist das Ziel des Branding. So entstehen Alternativen: Beim Schuhwerk zum Beispiel haben wir die Wahl zwischen »Glamour« (Prada) und »Prätentionslosigkeit« (Birkenstock). Für Prada ist Birkenstock keine Konkurrenz mehr und Prada nicht für Birkenstock. So heben sich beide voneinander ab, und beide erwirtschaften größere Gewinne. Das Motto lautet: Bedeutung schafft Gewinn. Der Barwert dieser Bedeutung ist der Markenwert, den Experten wie den Wert der Fabrikanlagen, der Patente und der liquiden Mittel in Geldeinheiten ausdrücken. So ist heute der Markenwert des Markenportfolios der BMW AG größer als der Wert jedes ihrer anderen Vermögensteile, größer als alle Produktionsanlagen weltweit zusammen und größer als der Wert aller Patente im Eigentum des Unternehmens.
Professionelles Branding schafft diese intangiblen, aber realen Werte. Marken mit schwacher Bedeutung sind weniger wert als solche mit einer starken. Starke Marken sind solche mit einer starken Bedeutung. Sie vermitteln markante Produkteigenschaften jenseits der funktionalen Eigenschaften: Die Markenpersönlichkeit zum Beispiel vermittelt menschliche Eigenschaften wie Unangepasstheit (Saint Laurent), Femininität (Dove), Maskulinität (Harley-Davidson) oder Androgynität (Disney). Eine schwache Marke ist wie ein Mensch ohne Eigenschaften, ihr Markenwert ist im Vergleich zu einer starken Marke gering. Starke Marken bieten echte Alternativen, und jedes Unternehmen will eine starke Marke (sein). Gemäß dieser Logik verdanken wir den Alternativenreichtum in der Konsumwelt dem Branding der Unternehmen.
2. Die alternativlose Marke