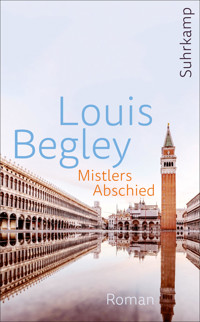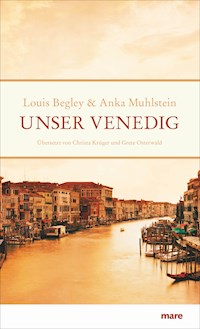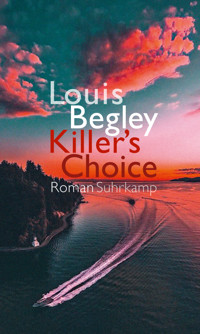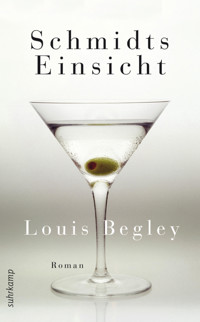11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Hugo Gardner, einst ein erfolgreicher Auslandskorrespondent für ein renommiertes Magazin, erfährt, dass seine – wesentlich jüngere – Frau Valerie sich nach vierzig Jahren Ehe von ihm scheiden lassen will, fällt er aus allen Wolken, hatte er sich doch auf einen ruhigen gemeinsamen Lebensabend eingestellt. Während er Valeries Beweggründe zu begreifen versucht, trifft er auf einer Reise nach Paris seine frühere Geliebte Jeanne wieder, die er immer noch hinreißend findet. Die beiden nähern sich einander wieder an und genießen die gemeinsamen Stunden – doch kann ein Neuanfang nach all den Jahren und angesichts alter Verletzungen wirklich gelingen?
Louis Begleys neuer Roman entführt die Leserinnen und Leser in die Stadt der Liebe und erzählt von einer bittersüßen späten Romanze – lakonisch und unsentimental.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Louis Begley
Hugo Gardners neues Leben
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Christa Krüger
Suhrkamp
Widmung
Für Anka, immerUnd wieder für Grisha
Motto
In Meergewölben ward uns Aufenthalt
Bei Nixen in rotbraunen Seetangs Winken,
Bis Menschenlaut uns weckt und wir ertrinken
T. S. Eliot, »Das Liebeslied von J. Alfred Prufrock«
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Motto
Inhalt
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Informationen zum Buch
Textnachweis
Impressum
Hinweise zum eBook
I
Ich wollte gerade zum Lunch gehen, da klingelte das Telefon. Auf dem Display wurde eine New Yorker Nummer angezeigt, die ich nicht kannte. Ich zuckte die Achseln: Was soll's. Ich gehe ran.
Ist Hugo Gardner zu sprechen?
Eine schwer einzuordnende Stimme. Schroff, jemand, der es nicht darauf anlegte, angenehm zu klingen. Vielleicht ein Spendeneinwerber für pensionierte Polizeichefs.
Wer ist am Apparat?
Rechtsanwalt William Sweeney. Ist Hugo Gardner zu sprechen?
Ich gab mich zu erkennen und fragte, was ich für ihn tun könne.
Ich vertrete Ihre Ehefrau, Mrs. Valerie Gardner. Werden Sie von einem Anwalt vertreten?
Ich weiß nicht, ob ich verstehe. Warum fragen Sie, ob ich einen Anwalt habe? In welcher Angelegenheit vertreten Sie meine Frau?
Ich kann einen Fall nicht mit einer Partei besprechen, die schon von einem Anwalt vertreten wird, das werden Sie verstehen. Jedenfalls wäre es besser, wenn ich mit Ihrem Anwalt spräche.
Besser wäre es, wenn Sie mir erklärten, worum es hier eigentlich geht. Je abhängig von Ihrer Auskunft würde ich womöglich meinen, ich brauchte einen Anwalt oder auch nicht. Also bitte, fangen Sie an.
In Ordnung, Hugo. Soweit ich weiß, ist Ihre Frau ein paar Tage verreist, geschäftlich unterwegs. Richtig?
Ich wollte diesen Herren eigentlich bitten, mich mit Mr. Gardner anzureden. Stattdessen sagte ich: Ja, das ist richtig.
Mrs. Gardner möchte sich scheiden lassen. Sie hat mich gebeten, Sie davon in Kenntnis zu setzen und darauf zu dringen, dass Sie sich einen Rechtsbeistand sichern, damit die Sache schnell und glatt über die Bühne gehen kann. Das ist der Grund für meinen Anruf. Ihre E-Mail-Adresse lautet [email protected], sagte mir Mrs. Gardner. Wenn das korrekt ist, schicke ich Ihnen gleich im Anschluss an unser Telefonat eine Mail mit meinen Kontaktdaten, damit Ihr Anwalt sich mit mir in Verbindung setzen kann.
Einen Moment, bitte, sagte ich. Was soll das heißen: Meine Frau will sich von mir scheiden lassen? Das ist mir ganz neu.
Sie hat sich schon gedacht, dass Sie sich überrascht geben würden. Sie wünscht die Scheidung wegen unmenschlicher Behandlung, und sie macht das Zerrüttungsprinzip geltend. Dass sie recht hat, werden Sie wohl zugeben.
Den Teufel werde ich tun.
Wir wollen nicht streiten, Hugo. Sie erhalten eine E-Mail von mir. Danach erwarte ich eine Nachricht von Ihrem Anwalt.
Er legte auf.
Ich hatte vorgehabt, allein in meinem Club zu Mittag zu essen und dann in eine Fotografie-Ausstellung im MoMA zu gehen. Beides konnte warten. Zwölf Uhr fünfzehn. Also neun Uhr fünfzehn in San Francisco. Ich rief Valerie auf ihrem Handy an. Sie war keine Frühaufsteherin. Ich nahm an, sie würde im Fairmont in ihrem Bett frühstücken. Ich ließ es mehrmals klingeln. War sie im Bad, oder hatte sie beschlossen, den Anruf nicht anzunehmen, als sie sah, dass ich der Anrufer war? Aber nein, sie antwortete. Ein müdes: Ja.
Hallo, Valerie, sagte ich, ich habe gerade eine sehr merkwürdige Unterhaltung mit einem Mann namens Sweeney hinter mir. Er behauptet, dass er Anwalt ist und dass du dich scheiden lassen willst. Was ist los?
Was los ist, hat dir Bill Sweeney gerade gesagt. Ich kann nicht mehr mit dir leben. Lieber würde ich sterben. Ich will die Scheidung le plus vite possible.
Warum sie es nützlich fand, französische Brocken in die Unterhaltung einzustreuen, war mir schleierhaft. Das Ganze war mir schleierhaft.
Ich glaube, ich träume, antwortete ich. Vor zwei Tagen bist du abgereist. Mit dem Morgenflieger. Nach einem sehr herzlichen Abschied. In der Nacht davor hatten wir uns geliebt. Jedenfalls schien es dir zu gefallen. Ich habe dir erzählt, dass ich Karten für Eugen Onegin besorgen wollte, und du hast gesagt: tolle Idee. Karten für dich und mich. Was ist denn zwischen vorgestern und heute passiert? Soll dies ein schlechter Scherz sein?
Passiert ist, dass ich mich letzten Dienstag von dir habe ficken lassen, wie gewöhnlich, wenn ich Ruhe brauche vor einer Reise, bei der beruflich etwas für mich auf dem Spiel steht. Verstehst du, was das heißt? Achtest du überhaupt auf irgendetwas? Merkst du jemals, was um dich herum vorgeht? Weißt du nicht, dass man mit dir lebt wie mit einer Leiche? Nicht mal wie mit einem Zombie. Mit einer Leiche, die noch nicht unter der Erde ist! Ich kann dich nicht ausstehen, seit Jahren schon kann ich dich nicht mehr ausstehen. Weißt du das denn nicht, du Blödmann?
Nein, nichts davon weiß ich. Warum hast du nichts gesagt, bevor du mir Mr. Sweeney geschickt hast?
Machst du Witze? Damit du mir wieder drei Stunden lang auseinandersetzt, wie sehr ich mich irre? Es ging nicht anders.
Tatsächlich, sagte ich. Kennen die Kinder deine Gefühle? Wissen sie, dass du an Scheidung denkst?
Barbara kennt meine Gefühle bestimmt. Hältst du sie für schwachsinnig? Dass ich dich definitiv verlasse, habe ich ihr noch nicht erzählt, aber Roddy wird sie eingeweiht haben. Er hat Bill Sweeney empfohlen.
Aha, sagte ich, zog einen Stuhl unter der Küchenarbeitsplatte hervor und setzte mich.
Aha, wiederholte ich. Und wie sehen deine nächsten Schritte aus?
Das war eine dumme Frage, merkte ich, aber ich hatte geredet, ohne nachzudenken, wie auf Autopilot geschaltet.
Ich fahre nächsten Mittwoch wieder in die City zurück. Am Donnerstag gegen elf Uhr möchte ich in die Wohnung kommen, um Kleider und ein paar andere Dinge zu holen. Du bist dann besser nicht da. Mrs. Perez kann aufpassen, dass ich mich nicht am Familiensilber der Gardners vergreife. Du solltest deinen Anwalt mit Bill Sweeney bekannt machen. Du wirst wohl diesen Idioten Weinstein engagieren, nehme ich an.
Als die Kanzlei, die für meinen Vater und später auch für mich gearbeitet hatte, ihre Abteilung für Trusts und Vermögensverwaltung schloss, hatte Larry Weinstein es übernommen, sich um mein Testament und die Trusts zu kümmern, die ich für die Kinder eingerichtet hatte. Mein Steuerberater hatte ihn empfohlen, und Larry bewährte sich, er war sogar deutlich intelligenter als sein Vorgänger, ein alberner Squash spielender Yalie. Mrs. Perez war unsere Haushälterin. Zufällig hatte sie mir ein paar Stunden zuvor mitgeteilt, sie habe ihre Periode und werde nicht zur Arbeit kommen. Heute war Donnerstag. Mrs. Perez' Perioden konnten sich hinziehen, aber trotzdem, bis nächsten Donnerstag … Wenn sie dann immer noch unter irgendeinem neuen Vorwand ausfiel, würde ich in der Wohnung auf Valerie warten. Vielleicht würde ich in jedem Fall da sein. Es hing davon ab, was Larry sagte.
Ich schaffte es, einen Abschiedsgruß zu krächzen, und legte auf. Was hätte ich auch noch sagen sollen.
Kein Witz, sagte Larry, als er sich meine Geschichte angehört hatte.
Ich war am selben Nachmittag noch zu ihm gegangen, gleich von meiner Lieblings-Hamburger-Kneipe aus, wo ich mir einen Cobb-Salat von tausend plus Kalorien, ein Fassbier und einen doppelten Espresso zuführte. Zur Hölle mit dem Kalorienzählen. Selbst wenn ich ein, zwei oder drei Pfund zunahm, war ich immer noch dünn genug. Und ohnehin scherte sich keiner um meine Gürtellinie, oder? Ich hatte geplant, im Club zu Mittag zu essen, aber der Gedanke, am Mitgliedertisch zu sitzen und mit meinen Nachbarn Konversation zu machen, stieß mich ab. Ich trank meinen Kaffee, zahlte die Rechnung und machte mich auf den Weg zu Larrys Büro.
Ich gab keine Antwort, also sagte er es noch einmal: Kein Witz. Und Sie hatten keinen Schimmer?
Ich schüttelte den Kopf.
Hat sie einen anderen?
Keine Ahnung, erwiderte ich. Mich trifft es wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wenn da ein anderer ist, hat sie sich's nicht anmerken lassen. Ich bin nicht misstrauisch, das sollte ich dazusagen. Wahrscheinlich würde ich es als Letzter merken. Ich möchte Sie etwas fragen. Sie kennen meinen Sohn Rod. Ich weiß noch, dass Sie mein Testament und den Trust mit ihm durchgegangen sind.
Larry nickte.
Finden Sie plausibel, was er getan hat? Dass er seiner Mutter einen Scheidungsanwalt besorgt, ohne mir etwas davon zu sagen? Ohne darauf zu bestehen, dass sie ihm freistellt, mir Bescheid zu geben?
Das ist merkwürdig, erwiderte Larry. Wundert mich nicht, dass es Sie aufbringt. Zu seiner Verteidigung: Vermutlich hat er gedacht, er würde Ihnen beiden einen Gefallen tun, wenn er seiner Mutter Bill Sweeney empfiehlt. Bill wirkt ruppig, aber er ist kompetent und alles in allem vernünftig. Sie hätte sich jemanden aussuchen können, der sehr viel übler ist.
Verstehe. Und was jetzt?
Valerie ist eine sehr energische Person. Für mich klingt es, als habe sie sich entschieden, so dass es sinnlos ist, eine Versöhnung oder Vermittlung zu versuchen. Sweeney wird Sie auffordern, einer Trennung zuzustimmen. Wenn Sie die Vereinbarung unterschreiben, wird es möglich – falls Sie keinen Einspruch erheben, und warum sollten Sie das tun? –, die Scheidung einvernehmlich einzureichen. Das Scheidungsurteil kommt dann ziemlich schnell durch.
Ohne dass ich ihr einen Scheidungsgrund gegeben habe?
Er lachte. Im Staat New York gilt die schuldunabhängige Scheidung. Sie haben mir erzählt, was Sweeney sagte: unmenschliche Behandlung – das heißt, Sie haben sie schlecht behandelt – und Zerrüttung der Beziehung. Nach dem New Yorker Scheidungsrecht ist das gut genug – oder schlimm genug. Wie Sie wollen. Ich habe Ihnen erklärt, dass sie eine Trennungsvereinbarung anstreben werden. Anschließend werden Sie hören, wie viel Geld sie verlangt, welche Möbel, Kunstgegenstände und so weiter. Der Rest, also die Schuldfrage, ob Sie wirklich ein Monster sind und so weiter, ist dann irrelevant.
Geld?
Sicher wird sie Geld verlangen, vielleicht Alimente, vielleicht eine Abfindung, vielleicht beides.
Selbst wenn es ihre Idee ist und ich nichts angestellt habe, weder Ehebruch begangen noch sie verprügelt, geschlagen oder angebrüllt habe? Ich brülle nicht.
Er nickte.
Und damit muss ich einverstanden sein?
Nein, aber wenn Ihre Frau entschlossen ist und Sweeney es ihr nicht ausredet, werden Sie ihr am Ende einen erheblichen Anteil dessen, was sie verlangt, zugestehen oder einen Rosenkrieg mit ihr anfangen, der womöglich vor Gericht entschieden wird.
Das würde ich wohl nicht wollen. Und sie?
Schwer zu sagen. Sie meinen, Ihre Frau habe Sie nicht gewarnt. Das kann gut bedeuten, sie hat einen anderen, und dieser andere hat das Heft in der Hand. Was immer sie verlangt, wird bis zu einem gewissen Grad verhandelbar sein, aber dass sie und Sweeney ein glattes Nein hinnehmen, bezweifle ich.
Ich überlegte und sagte, er habe wahrscheinlich recht.
Sind Sie in der Lage, mich in den Verhandlungen gegen sie zu vertreten, fragte ich. Und übernehmen Sie solche Fälle?
Ja auf beide Fragen, antwortete er. Sie war nie meine Mandantin, also entsteht kein Konflikt für mich. Sie ist nur eine Begünstigte in Ihrem Testament, das Sie übrigens schleunigst ändern sollten. Und ich habe an so vielen Trennungsvereinbarungen und Scheidungen mitgearbeitet, dass ich mich Sweeney gewachsen fühle. Wenn wir aber absehen, dass dies vor Gericht endet, müssten wir vielleicht jemand anderen ins Spiel bringen.
Das sind die ersten guten Nachrichten, die ich heute höre. Eine Frage habe ich noch: Sollte ich in der Wohnung sein, wenn Valerie kommt und ihre Sachen holt? Am nächsten Donnerstag. Soll ich mich fernhalten? Was ist am besten?
Ich würde gerne Sweeney anrufen und ihm sagen, dass ich mit von der Partie bin und dass Sie planen, in der Wohnung zu sein, wenn Ihre Frau kommt. Warten wir ab, was er dazu meint. Vielleicht ist er strikt dagegen, dann sollten wir eine Konfrontation vermeiden. Oder vielleicht sagt er, in dem Fall werde er Valerie begleiten. Daraufhin könnten Sie beschließen, dass Sie mich dabeihaben möchten. Übrigens muss ich Sie bitten, mir ein Mandatierungsschreiben zu unterzeichnen.
Mir recht, sagte ich. Ich erwarte Ihren Anruf und den Brief. Und jetzt muss ich schleunigst weiter.
In Wirklichkeit hatte ich alle Zeit der Welt. Ich wurde nirgendwo erwartet, aber ich wollte lieber gehen, bevor ich mitten im Büro meines Anwalts weinend zusammenbrach.
Sie kam tatsächlich mit Sweeney in die Wohnung. Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, hatte ich Larry an meiner Seite. So waren beide Anwälte der Flut ihrer Häme und Anschuldigungen ausgesetzt. Sweeney hatte einen Stapel Klebezettel zur Hand, die Valerie an das Zeug heftete, das sie haben wollte. Als sie und Sweeney aufbrachen, sagte Larry, wir würden uns ihre Forderungen notieren und entsprechend reagieren. Das löste bei Valerie eine Sturzflut von sarkastischen Bemerkungen aus, und Sweeney machte viele Worte, die ich mir nicht anhörte.
Sie kam noch zweimal mit Sweeney in die Wohnung und einmal allein in das Haus in Bridgehampton. Bis zur Unterzeichnung der Trennungsvereinbarung ließen wir weniger als vier Wochen vergehen. Ich merkte, dass ich wenig Lust zum Widerstand hatte – wozu auch? Sie nahm einen Batzen von meinem Geld, obwohl sie mich wegen eines Mannes verließ, der acht oder zehn Jahre jünger war als sie, ein Kerl namens Louis Leblanc, bei dem sie schon eingezogen war, Eigentümer eines schicken Restaurants in Chelsea. Bald kam heraus, dass sie schon seit einer ganzen Weile mit ihm geschlafen hatte. Sie nahm sämtlichen Schmuck mit, auch die Kunstgegenstände, die ich ihr in den beinahe vierzig Jahren unserer Ehe geschenkt hatte, dazu die meisten Gemälde und Zeichnungen an den Wänden unserer Wohnung und des Hauses in Bridgehampton – außer den Porträts meiner Familie (sie sagte, beim Anblick dieser Scheißbostoner sei ihr immer schlecht geworden). Gott sei Dank besaß sie nicht die Frechheit, unsere Wohnung für sich zu verlangen (die ich mit meinem Geld gekauft hatte, als ich von meinem letzten Auslandsposten in die Stadt versetzt wurde) oder Anspruch auf das Haus in Bridgehampton zu erheben, das ich von meiner verwitweten kinderlosen Tante Hester geerbt hatte, die auch meine Patin war.
Wie sich zeigte, bin ich einfach dumm oder nur altmodisch genug, um im Unterbewusstsein damit einverstanden zu sein, dass der Ehemann sich bis aufs letzte Hemd ausplündern lässt, unabhängig von der Schuldfrage und den Begleitumständen – Valerie hat mittlerweile nicht unerhebliche eigene Ersparnisse und dazu die Karriere gemacht, die ihr so wichtig ist. Außerdem befand ich mich in einem Schockzustand aus Fassungslosigkeit und tiefer Traurigkeit. Warum tat sie das? Weil ich ein Kadaver bin? Zugegeben, sie ist eine wohlgeformte und noch sehr hübsche Einundsechzigjährige, und ich bin vierundachtzig, aber richtig ist auch, dass ich nur zehn Pfund mehr wiege als seinerzeit im College, als ich im Squashteam spielte, dass ich fit und bei guter Gesundheit bin – abgesehen von dem kleinen Problem, dass Krebszellen sich in meiner Prostata verlustieren – und dass ich noch einen ansehnlichen Haarschopf habe. Gut meinen es diese Krebszellen offenbar nicht mit mir, aber der sehr kultivierte Urologe, der sich um meinen Intimbereich kümmert, seit ich seinen Vorgänger, einen geschwätzigen und unverschämt teuren Iren, abserviert habe, ist mit mir einig, dass wir die Sache vorläufig im Guten oder Schlechten auf sich beruhen lassen sollten. Nur umschreibt er das mit einem medizinisch und politisch korrekteren Fachausdruck. Er ist bereit, sich auf die Strategie des Watchful Waiting – des Abwartens und Beobachtens – einzulassen. Warten worauf? Dass ich an etwas anderem sterbe? Oder darauf, dass die kleinen Biester sich auf den Weg machen, um sich in meinen Knochen, meiner Leber oder weiß Gott wo sonst noch einzunisten? Wenn es so weit kommt, gönne ich mir ein Ticket erster Klasse nach Zürich. Einer meiner alten Journalistenfreunde wird eine diskrete Klinik für mich ausfindig machen, ich werde mit ihm ein ausgezeichnetes Mittagessen im »Drei Könige« einnehmen und mich dann in diese Klinik bringen lassen. Dem freundlichen Arzt dort meinen Obolus zu zahlen und den Styx zu überqueren, wird eine Erleichterung für mich sein.
Ich habe Journalistenfreunde erwähnt. Vielleicht sollte ich das erklären. Gleich nach dem College meldete ich mich freiwillig zum Militärdienst, wie praktisch alle, die ich kannte, und diente zwei Jahre. Nach der Grundausbildung im Fort Dix in New Jersey war ich im Supreme Headquarters Allied Powers Europe in Fontainebleau stationiert. Dort im SHAPE fand ich einen Dienstverpflichteten, der im Harvard College zwei Jahrgänge über mir gewesen war. Wir freundeten uns an. Als er demobilisiert wurde, hatte ich noch ein paar Monate Dienst, und bevor er ging, sagte er, wenn ich interessiert sei, würde er versuchen, mir einen Job bei Life zu vermitteln, wo er vor dem Militärdienst gearbeitet habe und wohin er jetzt wieder zurückkehren werde. Ich war in der Redaktion der College-Zeitung gewesen und sehr angetan von seinem Angebot. Er hielt Wort. Einen Monat nachdem die Army mich zurück nach New York City transferiert hatte, stellte ich mich bei der Zeitschrift vor. Meine Eltern waren nicht begeistert – mein Vater, Partner bei Morgan Stanley, hatte erwartet, dass ich Ökonomie oder Jura studieren würde, und meine Mutter blies in das gleiche Horn –, aber dies war die Arbeit, auf die ich gehofft hatte. Drei Jahre später wurde das elegante neue Time-Life-Haus eröffnet, und ich zog Leine – jedenfalls sahen manche meiner Life-Kollegen das so. Aus meiner Sicht war der Wechsel zur Time ein unverhoffter brillanter Karrieresprung. Mein in der Schule gelerntes und in den Jahren in Fontainebleau auf Hochglanz poliertes fließendes Französisch, ergänzt durch ein gewisses natürliches Talent, wie ich ohne falsche Bescheidenheit sagen kann, bescherte mir einen Posten als Auslandskorrespondent. Während einer lebenslangen Laufbahn bei der Time, die mich im Zickzack durch Europa und Lateinamerika geführt hatte, war ich nacheinander Chef des Pariser und des Moskauer Büros. Als ich drei Jahre in Moskau gewesen war, bot man mir einen Posten als leitender Redakteur in New York an. Ein Jahr später wurde ich Chefredakteur. 2005 ging ich in den Ruhestand. Diesmal verließ ich wirklich ein sinkendes Schiff. Leider hatte die Zeitschrift, so wie ich sie gekannt hatte, keine Zukunft mehr. Aber ich war dem Rat meines Vermögensverwalters gefolgt und hatte so gut wie alle Aktien der Gesellschaft, die ich nach und nach als Mitarbeiteroptionen erworben hatte, auf ihrem Höchststand verkauft. Die Erlöse machten mich zusammen mit dem, was ich von meinen Eltern und meiner Tante Hester geerbt hatte, zu einem Mann mit mehr Vermögen, als ich erwartet hatte.
Damals in den siebziger Jahren hatte Valerie in London für die L. A. Times gearbeitet, den Job verloren, war nach Paris gezogen und suchte händeringend Arbeit; ein Mann, der mit uns beiden befreundet war, machte uns miteinander bekannt und bat mich, ihr zu helfen. Das tat ich. Über Kollegen verschaffte ich ihr eine Teilzeitstelle bei der Herald Tribune im Ressort für die weniger anspruchsvollen kulturellen Ereignisse. Eins kam zum anderen. Um Klarschiff zu machen, gab ich einer Französin den Laufpass, mit der ich eine dauerhafte, sexuell hoch befriedigende und entspannte Beziehung gehabt hatte. Warum ich sie verließ? Das ist eine lange verwirrende Geschichte. Valerie war ein paar Jahre jünger als meine Freundin, zum Anbeißen süß und so herrlich amerikanisch! Ich wollte ein amerikanisches Mädchen, eine amerikanische Ehefrau haben. Unsere beiden Kinder, Roddy und Barbara, sind beide in Paris geboren. Kurz nach Barbaras Geburt richtete Valerie ihre Energie auf die französische Küche, nahm an Cordon-bleu-Kursen teil und erfand sich neu als Gourmetköchin und Kochbuchautorin, inspiriert von Julia Child. Eine wirklich sehr erfolgreiche Autorin: Ihre beiden letzten Kochbücher wurden schnell Bestseller, sie hatte eine Fernsehserie »Kochen mit Valerie« im NPR und zwei Bücher auf der Backlist, Authentische Gerichte aus dem Périgord und Eine Amerikanerin kocht in Moskau Koulibiak und Borschtsch wurden wieder aufgelegt und verkauften sich wie Fleischpiroggen. Paradox, und in meinen Augen auch undankbar, begründete sie ihren moralischen Anspruch auf einen Teil meines Kapitals damit, dass meine herausragende Stellung als Journalist anfangs die volle Anerkennung ihrer Arbeit blockiert habe, da Kritiker sie als meinen Schützling, als bloßes Anhängsel eingestuft hätten. Vielleicht ganz zu Anfang? Aber ich hätte gedacht, dass mein Einfluss, soweit davon die Rede sein kann, ihr eher die Startmöglichkeit verschaffte, die sie brauchte und die sich eindeutig positiv auf ihre Karriere auswirkte. Ich habe nie versäumt, ihr Mut zu machen. Die Gelegenheit, in vielen Küchen als Gourmetspezialistin, Chefköchin und so weiter aufzutreten und die Restaurantkritiker-Mafia kennenzulernen, verdankt sie mir. War das unfair? Ein Beispiel für die männliche Dominanz in den damaligen Medien? Vielleicht, aber ich hatte das System nicht gemacht, und sie profitierte mit Sicherheit gern davon.
Als Larry anrief und mir sagte, die Scheidung sei glatt durchgegangen, dankte ich ihm, telefonierte mit meiner Weinlieferantin und ließ ihm eine Flasche Jahrgangs-Laurent-Perrier schicken, diktierte einen netten Gruß dazu und setzte mich dann an meinen Schreibtisch und vergrub das Gesicht in den Händen. Was sollte ich tun? Feiern oder klagen, dass eine Frau gegangen war, die ich nach vierzig Jahren Ehe immer noch liebte und begehrte, die Mutter meiner Kinder? Allein feiern oder zusammen mit Freunden? Mit welchen Freunden, welchem Freund, das war die Frage. Tim Harris, ein Schulkamerad aus dem College, der in der City wohnte, noch genug Kondition hatte, um zum Essen und Trinken auszugehen und noch nicht dabei war, den Verstand zu verlieren, wäre meine naheliegende erste Wahl gewesen, aber er hatte sich schon vor langer Zeit in einen Lunch-Kumpan verwandelt. Seine Frau, die ich kannte, seit sie geheiratet hatten und die ich mochte, hatte mehrfach deutlich gemacht, dass sie jetzt Valeries Freundin sei. Die beiden Frauen gingen zusammen zum Lunch, zu Ausstellungseröffnungen und Konzerten; wenn Jill anrief und ich ans Telefon ging, sagte sie kaum hallo, bevor sie nach Valerie fragte; wenn wir abends etwas zu viert unternahmen – was immer seltener geschah –, konzentrierte sich Jill ganz auf Valerie und ihre kulinarischen Großtaten. Ich hatte nichts dagegen gehabt. Vom Beginn unserer Ehe an hatte ich mich gewissenhaft darum bemüht, sie in den Kreis meiner Freunde und Kollegen zu integrieren. Ich gebe nicht damit an. Es war einfach nur richtig und nötig. Sie war so viel jünger und fremd in dem Milieu meist älterer Leute, die, beruflich gesehen, alle arriviert und in vielen Fällen zu einigem Ansehen gekommen waren. Als wir nach New York übersiedelten, gab ich mir weiter Mühe, sie einzubeziehen. Mittlerweile wurde sie als Kochbuchautorin bekannt, aber sie hatte nie in der City gelebt und hatte keinen eigenen Bekanntenkreis, während ich, rundheraus gesagt, nicht nur in New York geboren und aufgewachsen war, sondern aufgrund meiner Stellung auch Macht und Ansehen besaß. Eine Frau, die wie Valerie neu in die City kommt, greift oft auf Schulkameradinnen aus dem College zurück. Aber Valerie war ins Reed College in Oregon gegangen, und ich glaube, sie hat nie versucht, in New York Ehemalige aus diesem College zu finden. Mit ihrer Fernsehsendung änderte sich natürlich alles radikal. Sie wurde zu einer kleinen Berühmtheit. Dass unser geselliges Leben von Valerie bestimmt wurde, erschien ganz natürlich. Wir gaben viele Einladungen zu Hause; Valerie kochte hervorragend und unwiderstehlich; beim Servieren und Aufräumen hatten wir fachkundige Helfer; und sie bezauberte unsere neuen Gäste genauso, wie sie von Anfang an meine alten New Yorker Freunde bezaubert hatte. Und so wie mich damals, als ich ihr in Paris Hilfe leistete. Genau genommen, hatte ich nicht die Energie oder auch nur den Wunsch, einen meiner alten Kollegen und Freunde bei der Time, Altersgenossen oder jüngere Autoren und Lektoren, die für mich gearbeitet und mich als ihren Mentor betrachtet hatten, anzurufen und zu sagen: Hör mal, es gibt Neuigkeiten, Valeries und meine Scheidung ist durch, wollen wir zusammen zum Dinner gehen?
Zu dumm. Ich wäre gern in eines der Bistros in meiner Gegend gegangen (hier am Carnegie Hill gibt es genug davon) oder in das norditalienische Restaurant in den fünfziger Straßen, das ich besonders schätze, und hätte mir einen Martini, eine Flasche guten Wein und ein gutes Gespräch gegönnt. Aber wussten diese Leute von Valerie und mir und hatten beschlossen, sich aus der Sache herauszuhalten und deshalb nichts von sich hören lassen, weder telefonisch noch per E-Mail, um zum Beispiel zu sagen, es tue ihnen leid, oder zu fragen, ob sie irgendwas für mich tun könnten? Konnte es sein, dass sie nichts wussten? Ich hatte außer Tim niemandem erzählt, dass sie mich verlassen hatte, aber das hieß nicht, dass sie nicht geredet hatte. Vielleicht hatte sie dafür gesorgt, dass sie und ihr Monsieur Leblanc mit genau den Paaren feierten und dinierten, die für mich als mögliche Gesellschaft bei einem Dinner in Frage gekommen wären? Warum auch immer, ich rief niemanden an, und keiner rief mich an.
Ich arbeitete bis ungefähr acht Uhr an meinem Buch mit dem vorläufigen Titel Der üble Trick: Wie George W. Bush uns in den Krieg führte – und konsumierte gleich hier bei mir, begleitet von meiner alten Rigoletto-CD, nicht einen, sondern zwei Martinis, kaltes Brathuhn und fast eine ganze Flasche Burgunder. Lang lebe die Musikkonserve! Ich konnte eine meiner Lieblingsopern hören und verschont bleiben von den Schrecknissen der neuen Peter-Gelb-Inszenierungen in der Met. Mit dem Buch kam ich gut voran, das Material hatte ich zusammen bis auf ein paar Lücken, die ich in der New York Public Library füllen konnte oder sehr oft auch online. Ich schwankte zwischen Wut auf das, was das Duo Bush-Cheney dem Land und dem gesamten Nahen Osten angetan hatte, und wildem Gelächter über ihre Dummheit. In W.s Fall zeigte sich die Begriffsstutzigkeit deutlich in verbalen Ausrutschern und Ankündigungen, die im Nu vom Gang der Ereignisse lächerlich gemacht wurden. Cheneys grundlegende Dummheit war schwerer zu erkennen. Sie verbarg sich hinter der Rolle der machiavellistischen Gewieftheit, die er sich zugelegt hatte und den Medien und Politikern beider Parteien glaubhaft vorspielte. Wie sonst würde man die fatalen Schachzüge erklären, die er W. einredete, sei es der Angriff auf den Irak oder die Arbeit »auf der dunklen Seite« des Krieges und die Beschädigung der Ehre des Landes? Ich hoffte, das Buch würde mir so gut gelingen, dass es mich aus dem Loch herausriss, in das Valeries Weggang und vorher einige Reaktionen auf mein früheres Buch mich gestoßen hatten. Das war eine Studie, eigentlich nur ein langer Essay über Bill Clintons Präsidentschaft gewesen. Ich hatte ihn einige Male interviewt und gemerkt, dass ich immun gegen seinen Charme war. Meiner Einschätzung nach hatte er nur eine solide Leistung für sich zu verbuchen: die dringend nötige Steuererhöhung, die er energisch in Gang setzte. Seine Tatenlosigkeit angesichts des Völkermordes in Ruanda und die sehr verspätete Reaktion auf den Balkankrieg waren erschreckend, und sein beschämendes persönliches Benehmen setzte das Amt des Präsidenten herab und ebnete W. den Weg ins Weiße Haus. Es kam kaum darauf an, ob diese Einschätzung richtig oder falsch war. Als mein Buch veröffentlicht wurde, trieb die Clinton-Maschinerie schon Hillary als die unvermeidliche demokratische Präsidentschaftskandidatin des Jahres 2016 voran, und das Buch verärgerte ihre Fans unter den Rezensenten und politischen Analysten. Nicht alle Kritiker oder Wortführer gehörten zu ihrer Clique. Im konservativen und rechtsextremen Lager wurde ich vollmundig gelobt – nicht ganz die Instanz, an deren Beifall mir liegt.
Nein, zu feiern gab es nichts, nur Schmerzen in einem Winkel meiner Psyche zu lindern. Ich ging später als sonst und leicht beschwipst zu Bett. Zwei großzügige Portionen Small Batch Bourbon nach dem Dinner taten ihre Wirkung. Ich war mir sicher, dass ich ohne Mühe einschlafen und vielleicht bis sieben oder acht Uhr morgens durchschlafen würde.
Entspann dich, Hugo, redete ich mir zu. Morgen ist wieder ein Tag.
Noch ein idiotischeres Klischee für den Anlass fiel mir nicht ein.
II
Ja, morgen kam, wieder ein Tag in Hugo Gardners neuem Leben, der sich als ziemlich alltäglich erwies. Ich presste gerade die üblichen zwei Apfelsinen für meinen Frühstückssaft aus, da klingelte das Telefon. Es war Mark Horowitz, der vor kurzem in den Ruhestand gegangen war und vorher in der NYT das Ressort Innenpolitik geleitet hatte. Seine Frau Edie lehrte noch an der Columbia Mathematik. Ich hielt sie für ein gutes Paar. Mark lud mich zu einer Party am kommenden Montag ein.
Das wird eine bunte Mischung sein, kündigte er an. Der alte Haufen und ein paar von Edies Kollegen. Viel zu essen und viel zu trinken. Kein besonderer Anlass. Nur eine Party. Übrigens hat mir jemand gesagt, Valerie und du, ihr hättet irgendwie Probleme. Wir möchten, dass du weißt …
Klar, er versuchte zu sagen, dass ich herzlich eingeladen sei, auch wenn ich allein käme, und ich unterbrach ihn und musste gegen meinen Willen lachen. Ja, sagte ich, so kann man es auch ausdrücken. Wir sind geschieden – seit gestern, genau genommen. Sie hat mich verlassen wegen eines Kerls mit Namen Louis Leblanc, dem La Bonne Bouffe unten in Chelsea gehört. Ich glaube, sie lebt mit ihm zusammen.
Ich konnte Marks Erleichterung spüren.
So etwas hat man mir mehr oder weniger zu verstehen gegeben, erklärte er mir. Wie auch immer, Edie und mir tut es sehr leid, und wir hoffen, du kommst. Von halb neun bis zum bitteren Ende. Allein oder in Begleitung, wie du willst.
Ich werde da sein, erwiderte ich. Im Moment gibt es keine Begleitung. Ich komme nur selbst. Sehr gern, wirklich. Danke. Und grüß Edie herzlich!
So, die Katze war aus dem Sack. Wenn Mark Bescheid wusste, obwohl weder er noch Edie Valerie besonders nahestanden, dann redeten die Leute jetzt über uns, wahrscheinlich Leute, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie uns als Gegenstand für Klatsch interessant finden würden. Die gute Nachricht war, dass ich nicht allen Bekannten, die ich zufällig traf, mitteilen musste, wir hätten uns getrennt. Ich konnte stillschweigend voraussetzen, dass sie es schon wussten. Die schlechte Nachricht war, dass sie vielleicht wer weiß was über uns erzählten.
Als ich darüber sinnierte, während ich meinen Orangensaft trank, klingelte das Telefon schon wieder. Ich las auf dem Display: P. Ludington. Ich sagte: Hallo, Penny!
Sie klang atemlos wie immer schon, auch in den alten Zeiten am Radcliffe; das bedeutete nicht notwendig, dass sie gerannt war. Es war ihre Art, sexy zu klingen. Damit hatte sie Erfolg, seit ich sie kenne. Hugo, hauchte sie. Bist du dieses Wochenende draußen am Strand? Ich habe von der Sache mit Valerie gehört. Wie absolut schrecklich! Du musst sehr bestürzt sein.
Wie ist die Wettervorhersage?, fragte ich dagegen.
Perfekt, versicherte sie, sonnig und sogar warm.
Wenn die Vorhersage stimmt, werde ich draußen sein, sagte ich. Diesen Winter bin ich kaum in meinem Haus gewesen. Ich denke, es steht noch. Irgendjemand – einer meiner Hausbesorger – hätte mir wahrscheinlich Bescheid gesagt, wenn es abgebrannt oder die Rohre geplatzt wären!
Kommst du dann am Samstag zum Dinner? Nur ein paar Leute. Acht Uhr?
Gern.
Hugo, warum hat Valerie das gemacht?
Das Streben nach Glück. Ein amerikanisches Grundrecht.
Sie hatte es gut mit dir getroffen, Hugo, und das wusste sie auch. Alle haben es gewusst. Ein dämlicher Fehltritt, wenn du mich fragst. Vergiss nicht, das Datum in den Kalender einzutragen. Samstag um acht. Ganz zwanglos.
Ist notiert.
Ich war bald nach dem Ende der Verhandlungen mit Valerie und ihrem Anwalt und nachdem ich die Trennungsvereinbarung unterschrieben hatte, für die ganze Sommersaison nach Bridgehampton gefahren und hatte dann das getan, was ich dort immer tat, bis auf Veränderungen, die damit zusammenhingen, dass ich zum ersten Mal, seit ich das Haus geerbt hatte – ein Jahr nach der Heirat mit Valerie –, allein war. Ohne Valerie, ohne Kinder, ohne Enkel. Ohne dass Valerie sich über ihre Einladungen zum Dinner oder das Rezept für ihr neuestes Gericht aufregte. Das war mir recht. Morgens ging ich als Erstes zum Ende der Einfahrt, klaubte die Times auf und machte mir Frühstück. Gloria, unsere Haushälterin