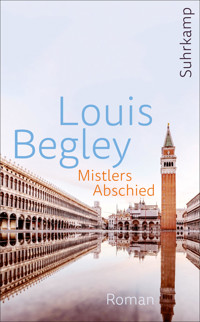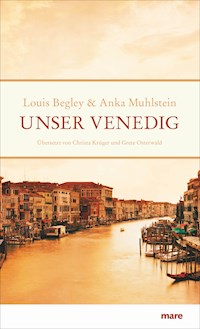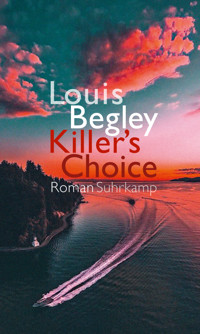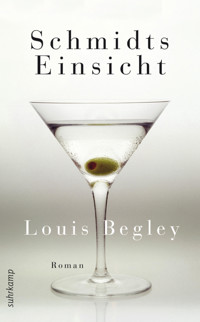
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schmidt hat alles: Nach seiner vorzeitigen Pensionierung ist der frühere Anwalt Direktor einer Stiftung; eine Aufgabe, die ihn auf Reisen um die Welt schickt. Seine Hoffnung auf ein Enkelkind scheint sich zu erfüllen, die Frauen liegen ihm nach wie vor zu Füßen. Einerseits. Andererseits hat ihn Carrie, seine jugendliche Freundin, wegen eines anderen, jüngeren verlassen. Jetzt erwartet sie ein Kind und weiß nicht, wer von beiden der Vater ist. Auch Schmidts Tochter Charlotte zieht sich immer mehr zurück, in ihre eigene Welt aus Teilnahmslosigkeit und Hass. Dabei droht sie nicht nur, sich selbst zu zerstören. Einziger Lichtblick ist Alice, eine Frau, die er vor Jahren bewundert hat, und die plötzlich wieder in sein Leben tritt. Doch haben die beiden eine Vergangenheit, die eine gemeinsame Zukunft nicht ganz leicht macht… Wieder schießt Schmidt nicht selten übers Ziel hinaus und steht sich oftmals selbst im Weg. Was, wenn nach all den Jahren der Liebe und der Einsamkeit die größte Herausforderung noch vor ihm liegt: Was, wenn es an der Zeit ist, sich zu ändern? Mit seiner ganz eigenen Leichtigkeit erzählt Begley, der große Romancier, von Zeiten des Aufbruchs und der Angst, loszulassen und dabei vollends zu verschwinden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Schmidt hat alles: Nach seiner vorzeitigen Pensionierung ist der frühere Anwalt Direktor einer Stiftung; eine Aufgabe, die ihn auf Reisen um die Welt schickt. Seine Hoffnung auf ein Enkelkind scheint sich zu erfüllen, die Frauen liegen ihm nach wie vor zu Füßen. Doch andererseits hat ihn Carrie, seine jugendliche Freundin, wegen eines anderen, jüngeren verlassen. Jetzt erwartet sie ein Kind und weiß nicht, wer von beiden der Vater ist. Auch Schmidts Tochter Charlotte zieht sich immer mehr zurück, in ihre eigene Welt aus Teilnahmslosigkeit und Haß. Einziger Lichtblick ist Alice, eine Frau, die er vor Jahren bewundert hat und die plötzlich wieder in sein Leben tritt. Doch haben die beiden eine Vergangenheit, die eine gemeinsame Zukunft nicht ganz leichtmacht …
Louis Begley, 1933 in Polen geboren, studierte Literaturwissenschaften und Jura in Harvard und arbeitete bis 2004 als Anwalt in New York, wo er noch heute lebt. Seine Werke wurden in 15 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Im suhrkamp taschenbuch erschienen zuletzt Der Fall Dreyfus (st 4304), Ehrensachen (st 3998) und Schiffbruch (st 3708).
www.louisbegley.com
Louis Begley
Schmidts Einsicht
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Christa Krüger
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem TitelSchmidt Steps Backim Verlag Alfred A. Knopf, New York
Umschlagfoto:Christopher Campbell / the food passionates / Corbis
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
© Suhrkamp Verlag Berlin 2011
© Louis Begley 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: cornelia niere, München
eISBN 978-3-518-76830-3
www.suhrkamp.de
Für Anka, immer
»Nothing can be sole or whole that has not been rent.«
W.B. Yeats, Crazy Jane Talks with the Bishop
I
Silvester, acht Uhr morgens. Noch sechzehn Stunden, dann war wieder ein beschissenes Jahr vorbei, beschissen wie das ganze letzte Jahrzehnt. Was würde das neue Jahr bringen? Für die Nation, die – unglaublich und wundersam – ihre Geschichte überwunden hatte und Barack Obama ins Weiße Haus entsandte, erhoffte sich Schmidt Erlösung und Reinigung. Dieses Hochgefühl trieb ihm Tränen in die Augen, darauf war er nicht gefaßt, und er konnte sie nur mit dem Ärmel seines Parkas abwischen. Er fragte sich, ob irgendwer, abgesehen von Obamas eigener Familie, eine derart ungetrübte Zuneigung für den Mann empfand wie er, Schmidt? Wohl kaum, wagte er zu vermuten: Seine Sympathie für diesen außergewöhnlichen jungen Menschen ging weit über die Treue zu einer Partei hinaus. Sie hatte wenig oder nichts damit zu tun, daß er die Demokraten schon seit Adlai Stevensons zweiter Kandidatur für die Präsidentschaft unterstützte. Als Stevenson zum erstenmal zur Wahl gestanden hatte, war Schmidt noch zu jung gewesen, aber 1956 stimmte er gegen den sicheren Sieger Ike, aus Prinzip und auch, weil es ihm Spaß machte, seinen Vater zu ärgern, der sich die reaktionäre Einstellung der griechischen Reeder, seiner wichtigsten Mandanten, zu eigen gemacht hatte, genauso wie deren Vorliebe für maßgefertigte Schuhe und Anzüge. Nein, seine Liebe für Obama – was sprach gegen dieses Wort – war auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt, war Teil der Liebe zu seinem Land. Und er hatte noch einen zweiten, eher privaten Grund zur Freude: die Hoffnung, daß der Fluch, mit dem er sich dreizehn Jahre zuvor selbst gestraft hatte – ein Gemisch aus all seinen schlechten Eigenschaften, Eifersucht und Neid, blindem Stolz und jähem unversöhnlichem Zorn –, endlich gebannt war. Vielleicht hatte auch er bessere Zeiten vor sich.
Er sammelte die New York Times in der Einfahrt auf, ging zurück zum Haus und las das Thermometer an der Veranda ab. Frostige vier Grad unter Null. Mit etwas Glück würde es am späten Vormittag deutlich wärmer werden, so daß Alice sich nicht zu plötzlich auf die Kapricen des Ostküstenwetters einstellen mußte. Noch vor vier Tagen war das Thermometer auf erstaunliche vierzehn Grad gestiegen – eine Rekordtemperatur, wie Schmidt in der Times gelesen hatte. Zu Weihnachten war es kühler gewesen, aber immer noch lächerlich mild: zwölf Grad. Die Wettervorhersage kündigte einen Umschwung an: Für den Neujahrstag 2009 wurden Tiefstwerte bis zu zwölf und Höchstwerte von vier Grad unter Null erwartet. Schmidt legte die Zeitung auf den Küchentisch und verließ das Haus wieder, um wie jeden Morgen sein Grundstück zu inspizieren. Seine Haushälterin Sonja würde in ein paar Minuten kommen und ihm das Frühstück auf den Tisch stellen. Im Haus hatte sie zur Zeit so wenig zu tun, daß er sich gedrängt sah, Beschäftigungen für sie zu erfinden, denn nichts demoralisiert das Personal so schnell wie Müßiggang. Der hohe Schnee – gut fünfzehn Zentimeter –, der Bridgehampton in der Woche vor Weihnachten innerhalb weniger Stunden zugedeckt hatte, war im warmen Wetter geschmolzen und hatte das Gras wachsen lassen. Es grünte wie Anfang Juni. Auch alles andere sah gut aus, besonders die Azaleen und Rhododendren am Außenrand des Rasens hinter dem Haus. Die knospenfressenden Rehe hatten sie verschont, obwohl Gus Parrish auf Schmidts Anweisung hin die Büsche nicht, wie sonst, zum Schutz mit schwarzen Nylonnetzen umwickelt hatte. Der Gärtner hatte verblüfft nach dem Grund gefragt, und Schmidt hörte sich die peinliche Wahrheit aussprechen: Für ihn sähen die Büsche in den Netzhüllen wie prähistorische Monster auf dem Sprung zum Angriff gegen das Haus aus. Der Anblick sei ihm nicht geheuer. Daraufhin hatte sich Gus gefügt, ohne auf irgendeine Weise anzudeuten, daß er seinen Kunden für übergeschnappt hielt, und das fand wiederum Schmidt überraschend – und erfreulich. Ein Grund mehr, sich glücklich zu schätzen, daß er Gus’ Leute als Nachfolger für Jim Bogards Neffen angeheuert hatte, der sich endlich auch, wie sein Onkel lange zuvor, zur Ruhe gesetzt hatte. Genaugenommen waren die Bogards schon für die Pflege des Grundstücks zuständig gewesen, bevor es nach dem Tod seiner Frau Mary an Schmidt übergegangen war, damals, als es noch Marys Tante Martha gehörte und er, seine Frau und ihre Tochter Charlotte als Marthas nächste Angehörige an Wochenenden und in den Sommerferien bei ihr zu Gast waren. Vertrauen lohnt sich eher als Mißtrauen. Er hatte Gus erklärt, daß er das Anwesen zu Silvester aus einem besonderen Grund tipptopp haben wollte, und Gus hatte sich daran gehalten. Schmidts Erfahrungen mit Gus waren in der Tat so gut, daß er glaubte, in puncto Zuverlässigkeit und Ausführung – optimalen Personaleinsatz nannte man das umständlich in Schmidts alter Kanzlei – seien Gus’ Leute anderen Gärtnern in den Hamptons ähnlich überlegen wie Wood & King den minderen Varianten der New Yorker Anwälte in den auf Schadensrecht spezialisierten Kanzleien rund um die City Hall oder Borough Hall, die, seitdem der Werbung keine Grenzen mehr gesetzt waren, ihre Dienste mit spanischen Werbeslogans auf Reklameschildern in U-Bahn-Wagen anboten. Gus’ Rechnungen waren hoch, so daß einem die Augen übergingen, aber das gehörte dazu und erinnerte ebenfalls an W & K. Die Namen all der freundlichen Kolumbianer, die Schmidts Rasen hegten und pflegten, die Ränder der Blumenbeete säuberten und Laubbläser betätigten, deren infernalischer Lärm Schmidts alte Siamkatze Sy und das junge Abessinierkätzchen Pi in Panik versetzte, waren in den Rechnungen einzeln aufgeführt und mit Angaben über Stundenlohn, einer Beschreibung der geleisteten Arbeiten und des Zeitaufwands versehen. Die Stundenzahlen in Gus’ Rechnungen wurden diskret aufgerundet, wie Schmidt annahm, ein Verfahren, das auch bei den Mitarbeitern von W & K üblich war: Telefonat mit Mr. Schmidt, so und so viele Zehntelstunden; Überarbeitung eines Memorandums nach seinen Randbemerkungen, zwei ganze und sieben Zehntelstunden, eine von Schmidt gewünschte Überprüfung der Punkte X, Y und Z zur Absicherung des Memorandums, elf Stunden und eine Zehntelstunde. Elf Stunden und eine Zehntelstunde an einem einzigen Tag? fragte sich Schmidt. Diesen Einträgen folgte bei W & K wie auch bei Gus eine Liste der zu erstattenden Auslagen. Bei W & K waren es Gebühren für Ferngespräche, Briefmarken, Botendienste, Kopien, Abendessen und Taxikosten für eine Heimfahrt nach Überstunden im Büro; bei Gus acht Sorten Dünger, Unkrautvertilger und Mittel gegen Insektenbefall; wenn die zwitschernden kolumbianischen Damen mitarbeiteten, kamen dazu noch säckeweise Pflanzerde, Blumenzwiebeln und Setzlinge.
Er hörte Sonjas Auto in der Einfahrt, sie fuhr einen weißen Mercedes, ein ziemlich neues Modell sogar, an dessen Herkunft Schmidt immer wieder herumrätselte, seit sie im Sommer damit aufgetaucht war. Gehörte der Wagen einem Freund? Hatte sie ihn bei einer Tombola ihrer Kirche gewonnen oder mit ihrem Ersparten gekauft? In dem Fall zahlte er ihr einen zu hohen Lohn. Wie konnte er das Rätsel lösen, wenn er beharrlich weiter vermied, sie zu fragen? Zeit fürs Frühstück. Er begrüßte Sonja und setzte sich. Der Kaffee war siedend heiß und stark; der Joghurt gar nicht so übel, die Trauben hervorragend. Was fehlte, waren die Croissants und Scones, die er früher jeden Morgen bei Sesame gekauft hatte, dem wunderbaren Delikatessenladen, noch immer seiner Einkaufsquelle für Geflügelsalat, Käse und Ravioli in brodo. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen, als er sich an dieses Gebäck erinnerte, das auf Anweisung der chinesisch-amerikanischen Dame Dr. Tang, der Nachfolgerin seines alten Hausarztes und Freundes David Kendall, von seinem Frühstückstisch verbannt war. Kendall war im Ruhestand. Schmidt fragte sich, ob er überhaupt noch irgend jemanden kannte, der sich nicht zur Ruhe gesetzt hatte. Ja, natürlich: Gil Blackman, sein alter Freund und Zimmergenosse im College, drehte immer noch Filme; Mike Mansour war wie immer damit beschäftigt, seine Milliarden zu verwalten, und die fabelhafte Caroline Canning und ihr scheußlicher Ehemann Joe kritzelten nach wie vor ihre Bücher.
Albern und überflüssig, daß Frau Dr. Tang so auf seine Diät achtete, dachte er. So überflüssig wie in gewisser Weise auch die Dienste von Gus und seinen Vorgängern, die Schmidt Jahr für Jahr weiter beschäftigte, seit Tante Martha gestorben war und Mary das Haus geerbt hatte. Wie viele Jahre waren das inzwischen? Er zuckte die Achseln: fast vierzig. Wie lang würde es noch so weitergehen? Nach seiner Einschätzung nicht mehr als zehn Jahre. Er hatte Dr. Tang gefragt, ob sie vorhersehen könne, in welcher Form der Tod ihn treffen werde. Angst würden Sie mir damit nicht machen, hatte er gesagt, auf uns alle wartet eine Begegnung in Samarra, und ich besitze eine Grabstelle mit Blick auf die Peconic Bay, die mir sehr gefällt. Sie antwortete mit einem fröhlichen Lachen und erklärte ihm, bei einem Patienten, der so gesund sei wie er, könne man nichts vorhersagen. Schmidts Simultanübersetzung: Stellen Sie keine dummen Fragen, überlassen Sie es dem Tod und Co., die werden es schon richten. Höflich wie immer, hatte er in das Lachen eingestimmt. In Wahrheit hegte er seine eigenen Vorahnungen: ein Hirnschlag oder Krebs, teuflische Krankheiten, die nicht immer auf schnelle Beute aus sind. Aber ganz gleich, was ihn am Ende traf, niemand, absolut niemand würde ihn in ein Altersheim zwingen. Falls er dann noch bei Verstand und nicht gelähmt war, würde er seinen Weg zum Exitus selbst finden. Andernfalls würden die Instruktionen, die er bei Gil hinterlegt hatte und die dem Freund die Entscheidung über Schmidts Leben und Tod überließen, die Sache regeln – zur Not müßte Gil etwas nachhelfen. Das war nicht mehr verlangt, als er für seinen Freund tun würde, der seinerseits Regelungen getroffen hatte, die Schmidt Entscheidungsvollmacht gaben. Demenz, die Krankheit, die mit der größten Wahrscheinlichkeit sämtliche Fluchtwege abschnitt, fürchtete er mehr als alles andere. Aber über drei Generationen war, soviel er wußte, keiner seiner Vorfahren dement geworden. Die Kehrseite der Medaille, die ansehnliche Seite, war eben seine Gesundheit. War er morgens erst einmal in Gang gekommen, bewegte er sich noch ganz geschmeidig. Wenn er zum Beispiel darüber nachdachte – und das tat er oft –, ob sein Zustand vor dreizehn Jahren in Paris, als er Alice zum ersten Mal besucht hatte, sehr viel anders gewesen war als jetzt, hielt er den Unterschied ehrlich gesagt für nicht nennenswert. Es sei denn, man konzentrierte sich auf die tiefen Furchen, die sich von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln zogen und sich inzwischen noch tiefer eingegraben hatten, auf die eingefallenen Wangen oder die schlaffe, in Falten hängende Haut am Hals. Alles in allem ließen sie ihn dermaßen schwermütig aussehen, daß er der Fratze eines Wasserspeiers glich, wenn er versuchte zu lächeln. Die Lage war noch weniger hervorragend, wenn es um seine Libido und seine sexuelle Leistungsfähigkeit ging. Nach ihrer jüngsten Prüfung konnte er sich nur ein »ausreichend« attestieren, allerdings hatte er, wie er Alice versicherte, auch noch nie eine der Wunderpillen probiert, die der tonangebende Tattergreis Bob Dole im Fernsehen anpries. Außerdem war der besagte Test unfair gewesen: Die Dame, die er womöglich enttäuscht hatte, konnte der unvergleichlichen Alice nicht das Wasser reichen. Er war alt, und die Zeit hatte ihm übel mitgespielt, aber war es deshalb verwerflich, wenn er die überteuerten Forderungen der Hampton-Mafia, der Gärtner, Hilfsarbeiter, Zimmerleute und Klempner in Kauf nahm, nur weil es ihm Vergnügen machte, sein Haus in bester Ordnung zu halten? Oder daß er Schecks ausstellte für die ungeheuerlichen Grundsteuern zur Finanzierung der städtischen Dienstleistungen, die säuberlich auf der Steuerrechnung aufgelistet waren, wie zum Hohn, um ihm zu beweisen, daß er keinen persönlichen Vorteil aus seinen Zahlungen zog? Wer weiß wie viele Männer kriegten keinen mehr hoch, und viele Frauen hatten ihre Orgasmen immer nur vorgetäuscht, bis sie endlich verkünden konnten, in ihrem Alter hätten sie die ganze Sache aufgegeben, und diese Leute lebten in Häusern, die viel grandioser waren als seines. Und gaben mehr Geld aus als er! Warum sollte er es nicht genauso machen? Irgendwo mußte er wohnen, dies war der Ort, der ihm am liebsten war. Wer wollte sich beschweren? Es war sein Geld, also konnte er es ausgeben oder verschenken. Er hatte keine gesetzlichen Erben mehr, und die von ihm ausgesetzten Vermächtnisse waren durch die Erbmasse mehrfach gedeckt, so daß für die Universität Harvard eine hübsche Summe übrigblieb. Es sei denn, er entschied sich, Alice den größten Teil dieses Geldes zu vermachen; in dem Fall würde Harvard immer noch eine elegante Schenkung erhalten; extravagant wäre sie allerdings nicht mehr.
Noch vier Stunden, dann war Alice in Bridgehampton! In seinem Haus. Unter seinem Dach würde sie schlafen. Hätte er sie lieber anderswo empfangen? Vielleicht in einem herzigen Häuschen in Sag Harbor mit welligen Fußböden und ewigem Schimmelgeruch? Die Antwort war ein lautes, deutliches Nein: Koste es, was es wolle!
Er sagte Sonja Bescheid, daß er einkaufen gehe, und, nein, sie brauche nicht dazubleiben und beim Mittagessen zu helfen, auch nicht beim Aufräumen und Abwaschen, und wenn sein Gast Mrs. Verplanck anrufe, solange er unterwegs war, solle sie sagen, daß er in spätestens einer Stunde wieder zu Hause sei und zurückrufen werde. Zwar glaubte er nicht, daß ihr Handy in den USA funktionierte, aber andererseits konnte es sein, daß sie das Telefon des Taxifahrers benutzte. Beschwingt und besorgt zugleich holte er seinen Audi Kombi aus der Garage – den Nachfolger des Volvo, den er mit Bedauern abgegeben hatte, als die 200 000-Kilometer-Marke überschritten war –, fuhr zuerst nach Wainscott, um Fischsuppe einzukaufen, dann auf der Fernstraße 27 zurück zu Sesame, wo er Brot und Käse und Ravioli in brodo zum Mittagessen am Neujahrstag und Croissants für Alice zum Frühstück besorgte, und schließlich holte er in Bridgehampton die vorbestellten Blumen für den Küchentisch und Alices Zimmer ab. Damit war alles im Haus, was sie am Neujahrstag brauchen würden, wenn in den Hamptons nur noch die Minimärkte geöffnet waren. Auch die Restaurants waren dann geschlossen, aber um die Abendessen brauchte er sich nicht zu kümmern. Sie würden zu Mike Mansours Silvesterparty gehen, und Gil und Elaine Blackman hatten Alice und ihn zum Dinner am Neujahrsabend eingeladen, eine fürsorgliche Geste, für die Schmidt geradezu kindlich dankbar war.
Alice hatte am Freitag, dem Tag nach Weihnachten, angerufen und gesagt, sie werde Silvester mit einem Flugzeug aus Paris kommen, das um zehn Uhr dreißig am Kennedy Airport landen sollte. Sie müsse dann zwar im Morgengrauen aufstehen, aber das nehme sie lieber in Kauf als den Verkehrsstau auf der Autobahn und die Menschenmassen im Flughafen, denen sie begegnen würde, wenn sie einen späteren Flug nähme. Sie wollte sich nicht darauf einlassen, daß er sie abholte, sie verbot es sogar ausdrücklich. Aber sie nahm sein Angebot an, ein Auto zu schicken, das sie nach Bridgehampton bringen würde. Nach dem Telefonat ging er auf die hintere Veranda, stand dort reglos und ließ in sich einsinken, was sie gesagt hatte. Alice kam wirklich! Er hatte sich wieder und wieder selbst versichert, daß sie ihm nicht absagen, daß sie nicht erklären werde, sie habe beschlossen, ihn doch nicht zu besuchen, so etwas würde sie nicht tun, dazu war sie viel zu ernsthaft. Trotzdem war es wie ein Wunder, als er sie tatsächlich am Telefon sagen hörte: Ich werde den und den Flug nehmen und dann und dann am Flughafen in New York ankommen, und du kannst jemanden schicken, der mich dort abholt und zu dir nach Hause bringt. Er hatte kurz erwogen, Bryan zu schicken – seinen Heimwerker, Hausbewacher und Katzenversorger in Personalunion –, der alle Seiten- und Nebenstraßen kannte, war dann aber zu dem Schluß gekommen, daß das Geschwätz dieses redseligen Aussteigers und bekehrten Dealers Alice nach acht Stunden im Flugzeug nicht zuzumuten sei. Wenn Bryan unabkömmlich war oder wenn Schmidt einen Vorwand fand, sich seiner Gesellschaft zu entziehen, ohne ihn zu kränken, beschäftigte er einen runzligen Iren mit dem Hol- und Bring-Dienst vom und zum Flughafen. Dieser Mann sollte Alice abholen; Schmidt schärfte ihm ein, bereits weit vor der erwarteten Landezeit des Flugzeugs in der Ankunftshalle hinter der Zoll- und Paßkontrolle zu warten und ein Schild mit Alices Namen gut sichtbar hochzuhalten.
Er sah auf die Uhr. Halb zwölf. Sie mußte inzwischen auf dem Long Island Expressway sein. Da er auf der Webseite der Air France nachgesehen hatte, wußte er, daß das Flugzeug fünfzehn Minuten vor der Zeit gelandet war. So früh am Vormittag waren die Warteschlangen vor dem Einreiseschalter sicher nicht lang, auch vor einem Feiertag nicht. Deshalb war sie wohl, falls sich keine Probleme mit der Gepäckausgabe ergeben hatten, gegen elf Uhr fünfzehn ins Auto gestiegen und müßte anderthalb bis zwei Stunden später vor seinem Haus ankommen. Das war eine vorsichtige Schätzung. Sie kalkulierte ein, daß der Verkehr womöglich zähflüssig war und daß Murphy die Neigung hatte, alle Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten, was ihm nicht wirklich vorzuwerfen war. In einem vorübergehenden Rückfall in seine Zeiten als schwerer Trinker gönnte sich Schmidt einen doppelten Bourbon, warf einen Eiswürfel ins Glas und setzte sich in seinen Schaukelstuhl. Der Küchentisch war mit dem guten Porzellan und Silberbesteck gedeckt. Der rote Blumenschmuck rundete das Bild hübsch ab. Am Zustand seines Haushalts war nichts auszusetzen. Er konnte beruhigt in seinem Stuhl schaukeln und an seinem Whiskey nippen. Um ein Uhr klingelte das Telefon. Es war Murphy, der meldete, daß sie in der Nähe von Water Mill waren. Der Mann war gescheiter, als er aussah! Sie kamen zügig voran. Also würden sie in fünfzehn Minuten dasein.
Sein sechster Sinn meldete ihm, daß der Wagen sich der Einfahrt näherte. Er trank seinen Whiskey schleunigst aus und hastete zum Vordereingang. Jemand hatte Murphy eingeschärft, er müsse respektvoll mit dem Kies in den Einfahrten seiner Kunden umgehen. Der Wagen rollte im Schneckentempo auf das Haus zu. Endlich hielt er. Schmidt öffnete die Tür. Die Hand, die seine fest umschloß, steckte in einem langen Handschuh aus dunkelrotem Veloursleder, den er wiedererkannte. Er gehörte zu jenem Paar, das Alice getragen hatte, als sie sich vor zweieinhalb Monaten, am vierzehnten Oktober im Restaurant an der Rue de Bourgogne mit ihm zum Abendessen traf.
Zum ersten Mal hatte Schmidt Alice gesehen, als sie Tim Verplanck heiratete, einen jungen Mitarbeiter bei W & K, den er besonders schätzte. Die Hochzeit fand in einer Kirche in Washington statt. Damals war Alices Vater französischer Botschafter in den Vereinigten Staaten. Am Nachmittag beim Empfang in der Botschaft tanzte Schmidt mit ihr. Weiße Freesien steckten in ihren Locken, die die Farbe von altem Gold hatten, und sie trug einen wallenden Schleier aus elfenbeinweißer Spitze, der nach Marys Meinung ihrer Großmutter gehört haben mußte. In den Monaten und Jahren danach hatte es einige Essen in der Wohnung der Schmidts gegeben – Mary hätte gewußt, wie viele, sie merkte sich solche Dinge –, bei denen sie, wie bei W & K üblich, Nachwuchsanwälte, die für ihn arbeiteten, samt Ehefrauen oder Verlobten zu Gast hatten; außerdem die Essen mit anschließendem Tanz, zu denen die Kanzlei einmal im Jahr alle Anwälte und Ehefrauen einlud, und später, als Tim Vollmitglied der Kanzlei geworden war, Dinner in kleinerem Kreis für die Sozii und ihre Frauen. Alices Schönheit, ihr Schick und ihre vollkommen aufrechte Haltung, die Art, wie sie den Kopf mit dem schweren, zum Knoten geschlungenen oder im Nacken mit einer Spange zusammengehaltenen Haar hoch trug, machte Schmidt jedesmal sprachlos, verschlug ihm buchstäblich den Atem. Sie hatte die unerschütterlich guten Manieren einer Diplomatentochter. Die Erinnerung an ihre schwindelerregend langen, vollkommenen Beine war ihm besonders teuer. Die Gelegenheit, diese Beine zu bewundern, ergab sich für die gesamte Kanzlei, als Alice zu einem Firmenfest in feuerrotem Minirock und schwarzen Netzstrümpfen erschien, so aufregend gekleidet, daß keine der anderen Ehefrauen sich auch nur annähernd mit ihr messen konnte. Aber weder damals noch zu einem anderen Zeitpunkt hatte Schmidt sie begehrt, nicht, solange Tim lebte, das konnte er beschwören. Affären innerhalb der Kanzlei, ehebrecherische erst recht, waren für ihn tabu, so wie seiner Meinung nach für alle anderen anständigen Männer seiner Klasse und Generation auch. Noch ein anderer, weniger rechtschaffener Grund hatte ihn zurückgehalten: Als Mary noch lebte, hatten alle Frauen, die seine Lust weckten, etwas Zwielichtiges an sich. Das waren Frauen, die er in Hotelbars aufsammelte, oder eine Jurastudentin, mit der er – was unverzeihlich war – Pot geraucht hatte, als er an der Westküste Nachwuchs für die Kanzlei anwerben sollte. Die einzige Ausnahme war das halb asiatische Au-pair-Mädchen gewesen, das sich damals um Charlotte kümmerte. Dieses schüchterne, höfliche Mädchen hatte sich ihm angeboten, ganz unschuldig und zugleich so unmißverständlich und drängend, daß Klugheit und Prinzipien sich in Luft auflösten. Selbst wenn er sich erlaubt hätte, Alice zu begehren, hätte er sich die Vorstellung verboten, daß sie sich zu einem Abenteuer am Nachmittag auf ihrem Wohnzimmersofa oder in einem Touristenhotel in der Stadt bereit finden würde. Einen solchen Vorschlag hätte sie mit Verachtung zurückgewiesen. Sie liebte Tim, und selbst wenn in ihrer Ehe etwas nicht zum besten stand, wofür er allerdings keinen Anhaltspunkt hatte, war sie für eine schmutzige Affäre mit Schmidt oder einem anderen verheirateten Kollegen ihres Manns zu nobel, zu stolz – ein chevalier sans peur et sans reproche, hätte Schmidt vielleicht gesagt, wäre sie ein Mann gewesen. Dann verschwand sie aus Schmidts Blickfeld. Er verlor die ganze Familie aus den Augen, als Tim die Leitung des Pariser Büros der Kanzlei übernahm und Alice ihm natürlich mit den Kindern dorthin folgte. Tim zeigte sich kaum noch im New Yorker Büro, viel seltener als seine Vorgänger, die alle eifrig darauf geachtet hatten, in Kontakt zu bleiben, und deshalb regelmäßig an Kanzleibesprechungen in New York teilnahmen und in den Fluren nach offenstehenden Türen suchten, die anzeigten, daß ein Besuch nicht unwillkommen wäre. Es war keine schlechte Idee, den Finger am Puls der Kanzlei zu haben und sicherzugehen, daß sich nichts zusammenbraute, dessen Folgen für das Pariser Büro womöglich ungünstig waren.
So kam es, daß er Alice seit mindestens vierzehn Jahren nicht mehr gesehen hatte, als er sie im April 1995 in Paris aufsuchte, um ihr nach Tims erschreckendem, vollkommen unerwarteten Tod persönlich sein Beileid auszusprechen. Er fand sie noch schöner als damals: Sie sah fraulicher aus, weicher und weniger unnahbar. Sie war nicht mehr knabenhaft, sondern erwachsen. Ganz überraschend – unsinnig, wie er in späteren Augenblicken der Bitterkeit fand – hatte er sich sofort in sie verliebt, ohne eine einzige Umarmung, ohne daß seine Lippen die ihren berührt hätten. Eine späte Jugendliebe, könnte man sagen; er glaubte, daß er sich selbst mit verbundenen Augen rettungslos in sie verliebt hätte, nur auf ihr Lachen hin. Und jetzt, nach dreizehn verlorenen Jahren seit jener Begegnung im April schien ihm seine Liebe ungebrochen. Wenn Glück für ihn zu haben war, dann in Gestalt einer Zukunft mit Alice.
Sie reiste mit leichtem Gepäck wie ein junges Mädchen, mit einem einzigen kleineren Koffer, darauf rote Aufkleber, damit er auf den Gepäckbändern der Flughäfen leicht zu erkennen war, und mit einer wurstförmigen Tasche, deren Reißverschluß sie nicht zugezogen hatte, so daß allerhand französische Illustrierte, Zeitungen und Papiere, die aussahen wie Manuskripte, herausschauten. Er brachte die Gepäckstücke hinauf und zeigte Alice das Zimmer, in dem sie wohnen sollte. Es war Charlottes Zimmer gewesen, hatte viel Sonne und Erkerfenster mit Blick auf den Rasen, den Garten an der Rückseite des Hauses und den hinter dem Grundstück liegenden großen Salzwasserteich mit den Wildgänsen, die keine Zugvögel mehr waren. Überrascht von dieser Schönheit, bat Alice um eine ausgiebige Führung durch Haus und Garten. Aber zuerst wäre ihr ein Lunch lieb, sagte sie, dann ein Bad und ein ausgiebiger Mittagsschlaf. Nach dem Essen änderte sie ihre Meinung und fand, es sei besser, den Rundgang zu machen, bevor es dunkel werde. Als sie damit fertig waren und in der Tür zu ihrem Zimmer standen, sagte er: Dieser Ort gefällt dir. Vielleicht möchtest du hier leben.
Sie gab keine Antwort, sondern blieb reglos stehen. Unsicher, ob er richtig geraten hatte, was sie sich wünschte, umarmte er sie. Ihr Mund schmeckte noch nach dem Essen, Haar und Kleider rochen ganz leicht nach Schweiß und trugen Geruchsspuren der Stunden, die sie an Flughäfen und im Flugzeug verbracht hatte. Die unvermittelte Intimität erregte ihn wie etwas Verbotenes. Er küßte sie lange, aber in dem Moment, als er fühlte, daß er hart wurde, trat sie zurück.
Zeit für mein Bad, sagte sie sehr leise. Wo wirst du sein?
Hier, sagte er und zeigte auf sein Zimmer genau gegenüber. Ich werde so tun, als würde ich lesen und Musik hören.
Darf ich dann zu dir kommen?
Schmidt stellte den Thermostaten für das obere Stockwerk etwas höher und setzte sich in den roten Sessel in seinem Zimmer. Er hielt das Haus gern kühl, manche würden sagen kalt, aber Alice war das Leben in der Kälte eines Holzhauses an der Nordatlantikküste, an dem Windböen rüttelten, noch nicht gewohnt. Auch nicht das Zusammensein mit einem alten Kerl, der sein Leben lang am Heizöl gespart hatte. Auf seinem Nachttisch lagen der unsäglich traurige Roman eines russischen Juden, der in der Zeit der Schlacht bei Stalingrad spielte, und ein Stapel ungelesener Exemplare des New Yorker und der New York Review of Books, die sich seit November angesammelt hatten, als er gleich nach dem Tag der Präsidentenwahl seine Rundreise zu den Life Centers angetreten hatte, die in Mittel- und Osteuropa und in verschiedenen ehemals sowjetrussischen Staaten von Michael Mansours Stiftung, noch immer unter Schmidts Leitung, betrieben wurden. Der Roman war so überwältigend, daß er die Lektüre immer wieder unterbrechen mußte, weil er nur eine begrenzte Menge der geschilderten Greuel aufnehmen konnte; er glaubte, gerade jetzt nicht noch eine Szene der Demütigung ertragen zu können. Kannten die adretten, freundlichen Ukrainer, die ihn im Life Center von Kiew begrüßten, diese grauenvolle Geschichte – was sie erzählte, mußte doch auch von ihren Großvätern oder sogar ihren Vätern handeln? Am Abend zuvor hatte er vor dem Einschlafen gelesen und das Buch nach der Szene weggelegt, in der ein alter Bolschewik, ein hochrangiger Kommissar, aus Gründen verhaftet wird, die er nicht versteht. Ein viel jüngerer Kommissar schlägt ihn wieder und wieder, nur um den Willen des Alten zu brechen. Jetzt konnte Schmidt allenfalls seine Gedanken schweifen lassen, während er dem Klassikprogramm des Musiksenders in Connecticut lauschte, auf den sein Radio immer eingestellt war. Alice zog ihn heftig an, ja, aber was er für sie empfand, ging weit über sexuelles Verlangen hinaus. Es war Liebe, die eines alten Mannes freilich. Er wollte sie immer an seiner Seite haben. Er hatte ihr die Ehe angetragen, und heiraten wollte er sie wirklich, da er sich von einer Ehe Stabilität versprach, obwohl die Erfahrung das Gegenteil lehrte, das wußte er wohl. Dennoch hatte er ihr erklärt, er sei bereit, mit ihr zusammenzuleben, wo immer sie wolle und zu jeder Bedingung, die sie stellen mochte. Er hatte sich ihr auf der Basis einer Probezeit mit Zufriedenheitsgarantie angeboten, mit der Versicherung, bei Nichtgenügen werde er sich ohne Widerrede davonschleichen. War es fair, war es vernünftig, einer Frau, die dreiundsechzig war, die Ehe oder eine andere Form des Zusammenlebens mit einem Mann anzutragen, der gerade achtundsiebzig geworden war? Es gab keine andere Antwort als ein Nein auf diese Frage, aber nein wollte er nicht als Antwort gelten lassen, er war sogar ernsthaft der Meinung, daß die Argumente gegen seinen Heiratsantrag womöglich überschätzt würden. Er hatte sie in aller Deutlichkeit auf die Risiken hingewiesen, die ohnehin auf der Hand lagen, und er war noch weiter gegangen: Er hatte ihr sogar gesagt, daß er ihr abraten würde, wäre er ihr Vater oder ihr Bruder. Trotzdem lag die Entscheidung bei ihr. Was seinen eigenen Standpunkt betraf, gab er sich keinen Illusionen hin. Auch wenn eine Heirat das war, was er sich sehnlichst wünschte, wußte er trotzdem genau, welche Strafe eine scheiternde Ehe bedeutet. Im schlimmsten Fall lebt man mit einer Mitgefangenen, die langsam zum Feind wird, und noch im Normalfall mit einem mehr oder weniger unersprießlichen Menschen. Überdies heißt Zusammenleben, daß ein gewisser Grad an körperlicher Intimität vom Partner erwartet wird. Schlimm genug für eine Frau, wenn sie sich den Liebesdiensten eines unattraktiven alten Knackers unterziehen muß – Schmidt hielt alle alten Kerle, sich selbst nicht ausgenommen, für grundsätzlich unattraktiv –, und noch schlimmer für den Mann, von dem erwartet wird, daß er die Initiative ergreift und ab und an sogar das Wunder der Penetration noch einmal vollbringt. Eine innere Stimme erinnerte Schmidt daran, daß Scheidungsgesetze diese Probleme im Griff hatten. Man konnte sich im voraus darauf einigen, daß der unglückliche Ehepartner Fersengeld geben durfte. Vielleicht waren diese Fragen endgültig erst post factum zu beantworten; hier paßte die Warnung: Weitergehen auf eigene Gefahr.
Schmidt machte abrupt Schluß mit diesen Grübeleien. Sie war schön, wohlriechend und begehrenswerter als alle anderen Frauen, die er kannte, mit einer Ausnahme: Carrie, Hekate persönlich, die in Gestalt einer zwanzigjährigen puertoricanischen Kellnerin zu ihm gekommen war. Zwei lange Jahre, die sich unauslöschlich jedem Nerv in seinem Körper eingeprägt hatten, war sie seine Geliebte gewesen. Und dann endete die Idylle, wie nicht anders zu erwarten. Carrie fand einen blonden Riesen, sanft wie ein Lamm, und ging zu ihm, mit Schmidts Segen, schwanger mit einem Kind, über dessen Vater Ungewißheit herrschen würde. Und Alice: Vielleicht kein Zaubergeschöpf der Nacht, aber sein Typ! Und wer wollte sagen, daß das Spiel den Einsatz nicht lohnt? Die Strafe für Feigheit kannte er nur zu gut: grämliche Einsamkeit und Verzweiflung. Seine Befürchtungen, er sei unfair Alice gegenüber, waren dummes Zeug. Sie war erwachsen. Vor einem Augenblick hatte sie noch gefragt, ob sie nach ihrem Bad zu ihm kommen könne. Das war kaum mißzuverstehen.
Beim Frühstück hatte er die ersten Seiten der Times kaum überflogen. Jetzt holte er sich die Zeitung aus der Küche, begann zu lesen und fand bald die einzige halbwegs passable Nachricht: Die Neuauszählung in Minnesota hatte wieder einen Vorsprung von Al Franken vor dem jammervollen Norm Coleman ergeben; aber es handelte sich nur um fünfzig Wählerstimmen. Neuauszählung! Schmidt hatte gehofft, das Wort nie wieder hören zu müssen, nachdem die Hinterhältigkeit, die bis zum Obersten Gerichtshof hinaufreichte, W. ins Weiße Haus gebracht hatte. Sonst nur Geschichten voller Horror und Verwirrung. Am Tag zuvor hatte die Hamas aus dem Gazastreifen eine Rakete abgeschossen, die fast 30 Kilometer weit in israelisches Gebiet flog und eine Mutter von vier Kindern tötete. Nach UN-Berichten hatten die Israelis bei ihrem Angriff auf diesen unseligen Streifen Land bereits dreihundertsiebzig Palästinenser getötet, darunter zweiundsechzig Frauen und Kinder. Was bewiesen diese Zahlen, wenn nicht, daß es vergeblich war, Palästinenser in großer Zahl zu töten? Ihren Kampfwillen hatte man damit kaum gebrochen. Aber versuchte die Hamas, israelische Frauen und Kinder zu schonen? Dazu äußerte sich die Times nicht. Würden Hamas und Hisbollah Ruhe geben, bevor sie die Israelis aus Israel vertrieben und ins Meer gejagt hätten? Wahrscheinlich nicht, aber wenn sie die Israelis stark genug bedrängten, würden diese die Bombe werfen. Wo sie abgeworfen würde, war eine gute Frage, auf die mit Sicherheit nicht einmal Mike Mansour eine Antwort wußte. Und wenn die Iraner die Bombe ebenfalls besaßen, dann würden sie sicherlich versuchen, sie auf Tel Aviv zu werfen, für die Juden eine Katastrophe im Ausmaß von Auschwitz, worauf die Israelis Teheran und die Insel Kharg auslöschen und damit eine Kettenreaktion auslösen würden, die alle von iranischem Öl abhängigen Länder ins Chaos stürzen mußte. Würde nicht jemand – die Russen, die Pakistanis, die Chinesen oder sogar die Nordkoreaner – den iranischen und arabischen Freunden zu Hilfe kommen? Womit? Schmidt gab auf. Er wußte es nicht, und er war kein Leitartikler der Times, mußte also auch nicht so tun, als ob. Er konnte nur hoffen, daß er tot war, bevor die Antwort sich zeigte. Ein anderer Artikel berührte ein Thema, das seinem alten Fachgebiet näher war. Er handelte davon, daß die Börsenaufsichtsbehörde an ihrer Verteidigung der mark-to-market-Vorschrift festhielt, die verlangte, daß Finanzinstitute täglich die Aktiva in ihren Bilanzen nach dem Marktwert notierten, also nach dem, was ein Käufer an dem Tag für sie zu bezahlen bereit war. Schmidt war felsenfest überzeugt, daß die Banken das Volk bis aufs Hemd ausplündern würden, sollte diese Regel ausgesetzt oder abgeschafft werden. Jeder, der je mit ihnen zu tun gehabt hatte, war zu diesem Schluß gekommen. Es gab jedoch ein vernünftiges Gegenargument, das der Journalist nicht erwähnt hatte. Es besagte, daß Wertpapiere nicht zwangsläufig wertlos waren, nur weil zur fraglichen Zeit kein Kaufinteresse an ihnen bestand. Sollten sie in den Bankbilanzen wirklich mit dem Wert null geführt werden? Das wäre so, als sagte man, ein Haus in einer schattigen Straße in Scarsdale, das jemand erst vor drei Jahren für zwei Millionen Dollar gekauft hatte, sei plötzlich keinen Cent mehr wert, nur weil der Dow abgestürzt war und sich momentan keine Käufer finden ließen. Wieder ein Rätsel, das Kopfschmerzen bereitete. Womöglich konnte Mike Mansour es lösen. Vielleicht bot sich eine Gelegenheit, ihn am Abend beim Essen zu fragen. Dieser großartige Financier war nie um eine Überzeugung verlegen, und nie hielt er damit hinter dem Berg. Man konnte sich mokieren über Mansour und die Art, wie er sein Geld machte und austeilte, aber wenn er Einschätzungen zu Finanzfragen abgab, war es geraten, gut aufzupassen. Diese Lektion hatte Schmidt im Oktober 2007 gelernt, als Mike ihm riet, Aktien zu verkaufen und statt dessen Schatzbriefe und Gold zu erwerben.
War er eingenickt? Wie lange war sie schon in seinem Zimmer? Erst als sie sagte, Hallo, hier ist die Dame aus Paris, nahm er sie bewußt wahr. Alice konnte sich so lautlos bewegen wie seine Katzen, wie seine verlorene Carrie, und stand nun vor ihm, lächelnd, barfuß, die Fußnägel mit einem Rot lackiert, das er herzergreifend kühn fand, in einem sandfarbenen Trainingsanzug, dessen Material, feinstes Kaschmir, sich so weich anfühlte, daß er glaubte, ihre nackte Haut zu spüren, als er sie in die Arme nahm. Er versuchte sie zu küssen, aber sie wandte den Kopf ab und sagte, Schmidtie, ich möchte ein ernstes Gespräch mit dir führen. (Schmidtie nannten ihn seine Freunde, das war ihr aufgefallen; sein Vorname Albert und dessen scheußliche Diminutive mißfielen ihm.)
Natürlich können wir ein ernsthaftes Gespräch führen, Alice, sagte er, aber erlaubst du mir ein Eröffnungsplädoyer?
Sie nickte.
Es ist ganz einfach: Ich liebe dich. Ich habe über alles nachgedacht, was ich dir sagte, als ich dich im Oktober besucht habe. Es war mir damals ernst, und es ist mir jetzt ernst. Bitte gib mir eine zweite Chance, und lebe mit mir, in einer Ehe oder in Sünde, hier in diesem Haus oder in New York oder in Paris oder wo immer du willst – solange wir zusammensein können und solange ich vollständig zu deiner Zufriedenheit bin.
Er wußte nicht genau, welche Reaktion er erwartet hatte, aber als er ihr Lächeln sah, fühlte er sich erleichtert. Schmidtie, war das ein Eröffnungs- oder ein Schlußplädoyer? Wie nennen Anwälte das? Ein Klagebegehren?
Ein wenig von beidem, antwortete er. Aber bitte denk daran, daß ich meine Beweisführung noch nicht abgeschlossen habe.
Dann beeil dich und schließ sie ab, Schmidtie, sagte sie lachend. Laß mich nicht warten.
Mit einem großen Schritt war er bei ihrem Sessel. Er sank auf die Knie und lehnte den Kopf an ihre Beine.
Warte, warte, flüsterte sie, ich muß dir auch etwas sagen. Ich wäre nicht hier, wenn ich dich nicht gern hätte, wenn ich nicht mit dir zusammensein wollte. Aber dreizehn Jahre sind vergangen. In unserem Alter ist das so lange wie ein ganzes Leben. Weißt du noch, wie du mir gesagt hast, ich solle mich nicht an einen alten Mann binden? Jetzt bist du sogar noch älter, aber Schmidtie, davor hab ich keine Angst. Sorgen macht mir mein eigener Zustand. Ich weiß nicht, was du von mir halten wirst. Ich bin jetzt auch alt, und ich habe den Körper einer alten Frau.
Er protestierte, denn er meinte, das gebiete der Anlaß. Er versicherte ihr, sie habe sich nicht verändert, sie sei immer noch die herrliche blonde Schönheit, in die er sich vor Jahren verliebt habe, nie sei sie begehrenswerter gewesen. Und beim Reden merkte er das Wunderbare: Was er ihr sagte, war die Wahrheit.
Schsch, Schmidtie, antwortete sie, du bist ritterlich, ich weiß. Mußt du auch töricht sein? Hast du dich gefragt, was du vorfindest, wenn ich meine Kleider ausziehe?
Sie nahm seine Hand, führte sie unter ihr Top und preßte sie gegen ihre Brust. Kannst du die Veränderung fühlen? Schlaff. Alles schlaff geworden, mein ganzer Körper. Schlaff und lasch.
Er widersprach aufs neue, aber sie sagte: Schsch! Heute nachmittag wird alles in Ordnung sein, wie neu, als wäre es das erste Mal. Aber heute nacht und morgen dann? Du bist ein so höflicher Mensch, daß du wahrscheinlich versuchen wirst, mich jeden Tag zu lieben, solange ich hier bin. Aber es wird dir wie eine Pflichtübung vorkommen, nicht weil du mich nicht liebst oder mir keine Lust verschaffen möchtest, sondern weil wir alt sind. Was wirst du dann machen? Diese Pillen nehmen? Heimlich natürlich. Du bist sehr korrekt.
O Alice, flüsterte er, sag nichts mehr.
Aber ich hab dir gesagt, daß wir reden müssen. Wie könnten wir diese grauenvolle Party in Water Mill einfach vergessen? Und dann hast du mich nach London kommen lassen. Warum? Um mich zu maßregeln und zu demütigen. Um sicherzugehen, daß ich wußte, wie wütend du warst. Und danach dann dieser schreckliche lieblose Sex. Wie eine Notzucht. Und dann all die Jahre des Schweigens, bis du aus dem Nichts wieder aufgetaucht bist. Warum? Weil du dir ausgerechnet hattest, daß ich verfügbar bin. Stimmt’s?
Alice, wir wissen beide, was passiert ist. Ich war ein Narr. Ein Idiot. Das habe ich zugegeben. Ich habe dich um Verzeihung gebeten.
Und ich habe dir gesagt, daß ich nicht wütend bin, nicht mehr. Und daß ich mit schuld war. Aber wir dürfen nicht wieder stolpern. Das könnte ich nicht aushalten.
Sie hatte nicht versucht, seine Hand, die auf ihrer Brust lag, wegzuschieben, und er hatte weiter gestreichelt, die eine und dann auch die andere Brust. Gleichbehandlung. Alice begann zu stöhnen.
Warte, warte, sagte sie. Hör zu. Bitte sprich nicht mehr vom Heiraten. Nicht jetzt. Ich will dich nicht für töricht halten müssen. Überlaß mir, dir die Ehe anzutragen. Wenn ich meine, daß wir soweit sind.
Das verspreche ich, antwortete er. Ich verspreche es.
II
Alice schlief so tief und fest, daß er die Lampe auf der Kommode anschalten und seine Kleider einsammeln konnte, ohne sie zu stören. Das leise Geräusch, das sie hören ließ, war ein zufriedenes Murmeln, meinte er. Dann vergrub sie ihren Kopf unter den Kissen. Daß sie gut schlief nach einer Nacht im Flugzeug und anschließendem Sex, der mit einer überschwenglichen Klimax geendet hatte, war nicht überraschend, erfüllte ihn aber trotzdem mit Stolz. Er sah es als Beweis dafür, daß er seine Sache gut gemacht hatte, daß er ein aufmerksamer Gastgeber war. Auch er war eingenickt, aber nur kurz. Beim Aufwachen merkte er, daß sie einen Arm um ihn geschlungen und sich eng an ihn geschmiegt hatte. Ihre Glut, ihre unverhohlene Konzentration, als warte sie auf einen unglaublich hohen Ton aus der Ferne, der die Explosion von Freude auslösen würde! So war in seiner Erinnerung auch das erste Mal mit ihr gewesen. Mit geschlossenen Augen, den Körper ihm entgegengehoben, hatte sie sich der Lust auf ihre eigene Art so offen und vollständig hingegeben wie Carrie. Gewisse Gesten, die er von Carrie gelernt hatte, wurden jetzt ohne Kommentar und ohne Ärger abgewehrt. Wie unwichtig sie waren, ob willkommen oder unwillkommen! Seine Liebesakte mit Alice hielten sich eigentlich an die Regeln, die er und Mary in ihrer mehr als dreißigjährigen, schicklichen und von großer Zuneigung geprägten Ehe befolgt hatten, aber das Ergebnis war vollkommen anders. Mary war fast nie zum Orgasmus gekommen. Was sie daran hinderte, war ihre tief im Inneren verborgene Angst, daß er Macht über sie gewinnen würde, wenn sie es soweit kommen ließe; davon war er überzeugt. Lieber gab sie sich mit der unreifen Lust zufrieden, die ihr das Petting auf dem Wohnzimmersofa verschaffte, ein unsinnig langes Vorspiel und nach dem Akt eine klebrig kalte Enttäuschung. Wahrscheinlich meinte sie, er habe die Folgen – seine Schuldgefühle, die Demütigung – verdient. Vergleiche anzustellen war schäbig, das wußte er, aber wie sollte er sie vermeiden? Die erschreckende Wildheit, die er mit Carrie erfahren hatte, würde er mit Alice nie erleben, aber Carrie hatte ihn auch an die äußersten Grenzen seiner Ausdauer getrieben. Lange hätte er wohl nicht mehr mit ihr mithalten können.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!