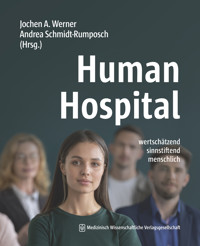
Human Hospital E-Book
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die zukünftigen Herausforderungen für unser Gesundheitssystem sind groß: Der demografische Wandel der Gesellschaft führt einerseits zu steigenden Patientenzahlen und andererseits zu einer Verstärkung des ohnehin dramatischen Fachkräftemangels. Die Kosten der Gesundheitsversorgung steigen unvermindert aufgrund immer besserer (und teurerer) Behandlungsverfahren. Allerdings blicken wir bereits heute auf die Endlichkeit wachsender Finanzmittel, beschleunigt durch globale Krisen und Erschütterungen. Unübersehbar ist auch, dass die Attraktivität des Gesundheitssystems für die Mitarbeiter Schaden nimmt und die Abwanderung von qualifiziertem Personal in Medizin und Pflege die Situation weiter verschärft. Das Gesundheitssystem in Deutschland wird sich verändern, ja neu aufstellen müssen. Viele fordern eine radikale Kehrtwende und eine Rückkehr zu mehr Menschlichkeit. Das menschliche Krankenhaus stellt seine Patienten und Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Human Hospital bedeutet: eine maximale Leistungsfähigkeit der Krankenversorgung, die spürbare Entlastung der Beschäftigten, eine enge, digitalgestützte Verknüpfung mit anderen Akteuren im Gesundheitssystem, mehr Wirtschaftlichkeit, mehr Wertschätzung und ausgeprägter Klima- und Ressourcenschutz. Dieses Buch benennt die Herausforderungen in der sich wandelnden Gesellschaft und stellt dabei den Menschen in den Mittelpunkt. Welche Fragen beschäftigen die Patienten der Zukunft? Wie wandelt sich die Arbeitswelt Krankenhaus? Wichtige Zukunftsthemen auf Patienten- sowie auf Mitarbeiterebene werden beleuchtet: z.B. New Work, Resilienz, Transparenz, Ressourcenschonung oder Individualisierte Medizin. Das Buch stößt Diskurse an und stellt Fragen an die Gestalter und Entscheider im Gesundheitssystem. Die Herausgeber und Autoren ergreifen ihre gesellschaftliche Verantwortung bei der Bewältigung der originären Aufgaben des Gesundheitssystems: Menschen zu helfen und Menschen zu dienen. Und dies nicht nur medizinisch, sondern eben auch als Good Corporate Citizen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jochen A. Werner | Andrea Schmidt-Rumposch (Hrsg.)
Human Hospital
wertschätzend. sinnstiftend. menschlich
mit Beiträgen von
O. Basu | J. Buer | D. Dettling | A. Diehl | G. Dobos | J. Egger | T. Emler | T. Esch | C. Eysel | M. Gastaldo | T. Geldmacher | H. Haller | R. Hecker | F. Herter | J. Hildebrand | F. Hoffmann | K. Hünninghaus | R. Kimmig | J. Kleesiek | C. Kleinschnitz | S. Kobus | A. Köhn | E. Krauße | S. Langer | S. Lehringer | T. Linkenheil | S. Liszio | A.A. Mahabadi | G. Marckmann | S. Matthys | D. Matusiewicz | P. Merke | M.M. Michaelsen | S. Moebus | C. van Nahl | N. Nardini | E. Natour | F. Nensa | H.A. Neu | H. Nickl | C. Nickl-Weller | E.-M. Nilkens | S. Oeder | S. Oertelt-Prigione | T. Ossiek | T. Rassaf | A. Roggel | M. Rolshoven | A. Rüland | K. Scheer | D. Schliffke | A. Schmidt-Rumposch | F.H. Schmitz-Winnenthal | C. Schöbel | I. Schrader | C. Schuldt | C. Schulz | V. Starker | A. Struchholz | M. Teufel | M. Tewes | K. Thiede | J.A. Werner | L. Wortmann
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Das Herausgeber-Team
Prof. Dr. Jochen A. Werner
Universitätsmedizin Essen
Hufelandstraße 55
45147 Essen
Andrea Schmidt-Rumposch
Universitätsmedizin Essen
Hufelandstraße 55
45147 Essen
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Unterbaumstraße 4
10117 Berlin
www.mwv-berlin.de
ISBN 978-3-95466-908-0 (eBook: PDF)
ISBN 978-3-95466-909-7 (eBook: ePub)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, 2024
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Im vorliegenden Werk wird zur allgemeinen Bezeichnung von Personen nur die männliche Form verwendet, gemeint sind immer alle Geschlechter, sofern nicht gesondert angegeben. Sofern Beitragende in ihren Texten gendergerechte Formulierungen wünschen, übernehmen wir diese in den entsprechenden Beiträgen oder Werken.
Die Verfasser haben große Mühe darauf verwandt, die fachlichen Inhalte auf den Stand der Wissenschaft bei Drucklegung zu bringen. Dennoch sind Irrtümer oder Druckfehler nie auszuschließen. Daher kann der Verlag für Angaben zum diagnostischen oder therapeutischen Vorgehen (zum Beispiel Dosierungsanweisungen oder Applikationsformen) keine Gewähr übernehmen. Derartige Angaben müssen vom Leser im Einzelfall anhand der Produktinformation der jeweiligen Hersteller und anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Eventuelle Errata zum Download finden Sie jederzeit aktuell auf der Verlags-Website.
Produkt-/Projektmanagement: Anja Faulenbach, Ulrike Marquardt, Berlin
Copy-Editing: Monika Laut-Zimmermann, Berlin
Layout, Satz und Herstellung: zweiband.media, Agentur für Mediengestaltung und -produktion GmbH, Berlin
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Cover: © Adobe Stock: fizkes, Beitragsaufmacher: Freepik: Rochak Shukla
Zuschriften und Kritik an:
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Unterbaumstr. 4, 10117 Berlin, [email protected]
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
das Buch Human Hospital ist für uns als Herausgeber eine ganz besondere Herzensangelegenheit. Es ist nicht nur ein Buch, das unter Mitwirkung zahlreicher und namhafter Autorinnen und Autoren wichtige Sachverhalte und Initiativen zusammenträgt. Es ist auch ein Fazit persönlicher Erkenntnisse und Erfahrungen vor dem Hintergrund unseres Generalthemas: die Medizin besser und vor allem menschlicher zu gestalten. Und dies nicht in einer fernen und damit unverbindlichen Zukunft, sondern im Hier und Jetzt.
Die Einstufung des Buches als Selbstreflektion unseres bisherigen Weges würde aber deutlich zu kurz greifen. Human Hospital will mehr. Das Buch hat den Anspruch, als Standardwerk erstmals und umfassend alle Gedanken, Ideen sowie Impulse zu fokussieren und in verschiedenen Schwerpunkten zu strukturieren, die für das Verständnis und die konkrete Umsetzung eines menschenzentrierten Krankenhauses notwendig sind. Zwischen dieser Zielprojektion und der tatsächlichen Realität liegen Welten. Denn die traurige Wahrheit ist, dass wir uns in der vergangenen Dekade dem Human Hospital nicht angenähert, sondern uns von ihm entfernt haben. Die Menschlichkeit in der Medizin ist im Spannungsfeld zwischen dem DRG-System, dem Primat der Interessensgruppen, den digitalen Defiziten, dem zunehmenden Personalmangel und ganz allgemein einer Reformunwilligkeit und -unfähigkeit verloren gegangen. Für dieses Buch und den damit verbundenen Impuls des Aufbruchs und des Optimismus wird es daher höchste Zeit!
Human Hospital steht in einer engen inhaltlichen Verbindung mit unseren zuvor erschienenen Büchern Smart Hospital sowie Green Hospital. Aber es ist nicht der Abschluss einer Trilogie, wie man aufgrund der Reihenfolge des Erscheinens fälschlicherweise vermuten könnte. Human Hospital ist der Oberbegriff, der Rahmen, gewissermaßen die Inkarnation unserer Grundüberzeugung als Manager und als Menschen, in unseren verantwortungsvollen Positionen eine empathische und mitfühlende Medizin zu schaffen. Diesen Anspruch verfolgen wir bei uns an der Universitätsmedizin Essen, aber auch, das sagen wir ganz unbescheiden, als Impuls- und Ideengeber für die Gesundheitspolitik insgesamt in unserem Land. Smart, Green, Human – alles ist untrennbar miteinander verbunden, geht ineinander über, verstärkt sich, schafft Synergien. Diese Triade ist die Grundlage zur Lösung unserer tiefgreifenden strukturellen Herausforderungen im Gesundheitssystem, einer von den Menschen jeden Tag erlebbaren Einrichtung der Daseinsvorsorge. Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussionen muss man hinzufügen: Die Funktionsfähigkeit der Gesundheitsversorgung ist für die Akzeptanz unserer demokratischen Grundordnung unverzichtbar.
„Wertschätzend – sinnstiftend – menschlich“ lautet der Untertitel von Human Hospital. Wie leicht aufgeschrieben, wie umfassend und wie schwer zu realisieren ist dieser Anspruch! Wir sind daher sehr froh und stolz darauf, dass wir bei dieser Mammut-Aufgabe auf die herausragende Unterstützung unserer Autorinnen und Autoren, sämtlich Expertinnen und Experten in ihren Fachbereichen, bauen konnten. Noch stärker als in den beiden bereits erschienenen Werken haben wir darauf geachtet, die Vielfalt der Meinungen noch größer, die Einbeziehung anderer Fachbereiche noch breiter, das Buch insgesamt noch vielschichtiger zu machen. Denn genau so ist Medizin bereits heute und wird sie erst recht morgen sein: Sie existiert nicht als isolierte, selbstverliebte Disziplin im Elfenbeinturm, sondern in der Kooperation und der Interaktion mit ganz unterschiedlichen Menschen und ihrer Expertise. Wir danken allen Autorinnen und Autoren von Herzen für ihre Beiträge. Sie alle haben maßgebliche und wegweisende Impulse gegeben.
Besonders danken möchten wir an dieser Stelle auch unserem ehemaligen Kaufmännischen Direktor der Universitätsmedizin Essen, Thorsten Kaatze. Er hat während seiner langjährigen Zeit als Mitglied des Vorstands die Transformation zum Smart Hospital und zum Green Hospital und damit auch den Weg hin zum Human Hospital tatkräftig und erfolgreich mit begleitet. Dieses Buch ist daher auch sein Verdienst und der Beleg dafür, dass tatsächlicher Fortschritt nicht als Einzelleistung, sondern immer im Team erfolgt.
Als Herausgeber würden wir uns sehr freuen, wenn dieses Buch wie seine Vorgänger nicht „nur“ konsumiert oder zur Kenntnis genommen wird. Human Hospital soll zur Diskussion, zur kritischen Auseinandersetzung, gern auch zum Widerspruch anregen und einladen. Denn wir wissen, dass es auf dem schwierigen und langen Weg zu einer menschlichen und gerade deshalb zukunftsfesten Medizin nie den einen Königsweg, sondern immer nur die Verschmelzung vieler Ideen zu einem großen Ganzen gibt.
Prof. Dr. Jochen A. Werner Andrea Schmidt-Rumposch Essen, im Juni 2024
Inhalt
ITransformation Ebene 1: Mensch, Gesellschaft und Gesundheit
1Annäherung an ein neues Menschenbild in der MedizinJochen A. Werner
2Von der Rückkehr der Krankenhäuser zu den MenschenSusanne Moebus
3Mit Resilienz die Zukunft gestaltenChristian Schuldt
EXKURS: Unterstützung in Krisensituationen – bürgerschaftliches Engagement als Inkubator für mehr MenschlichkeitTim Geldmacher
4Mehr Kommunikation wagenAchim Struchholz
5Medizinisches Wissen muss zugänglicher werdenJan Buer und Martin Rolshoven
6Transformation der Ernährung und Stärkung der ErnährungsmedizinKristin Hünninghaus
EXKURS: Musiktherapie als künstlerische Therapie im klinischen AlltagSusann Kobus
7Wie Roboter unsere Krankenhäuser menschlicher machenThomas Linkenheil
8Implementierung eines Pediatric-Health-Play-TeamsOliver Basu, Stefan Liszio, Carolin van Nahl und Jens Hildebrand
9Everytime – everywhere: Telemedizin als Antwort auf den Ärzte- und VersorgungsmangelChristoph Schöbel
EXKURS: ChatGPT, Bard, Claude et al. – wie Maschinen die Medizin vielleicht wieder menschlicher machenFelix Nensa
10Geschlechtersensible MedizinLaura Wortmann und Sabine Oertelt-Prigione
EXKURS: Neue Chancen durch präventive GehirngesundheitChristoph Kleinschnitz
11Bedarfsgerechte Integration der Palliativmedizin in die KrankenversorgungMitra Tewes
IITransformation Ebene 2: Patient der Zukunft
1Human Hospital für und mit informierten Patienten – Chance für eine sichere und patientenzentrierte GesundheitsversorgungRuth Hecker
2Menschlichkeit unter der Geburt – Chance Human HospitalRainer Kimmig
EXKURS: Vom Bittsteller zum informierten Kunden – die Rolle des modernen PatientenDetlef Schliffke und Hajo Arne Neu
3Der mobile PatientJens Kleesiek und Jan Egger
EXKURS: Grenzgänger – wenn Mediziner zu Patienten werdenAnke Diehl
4Personale Medizin und ResilienzMartin Teufel
5Der smarte Patient und Big DataDavid Matusiewicz
6Human Hospital und Hospice Care – der Beitrag der Hospizarbeit zu menschensensiblen BeziehungenKarin Scheer
IIITransformation Ebene 3: Arbeit der Zukunft
1Mit New Work durch die Hintertür zu einem humanen KrankenhausPatrick Merke
2Mitarbeiter gesucht – gutes Recruiting als Erfolgsfaktor für die ZukunftAndrea Köhn
EXKURS: Human Capital im Human HospitalSilke Langer
3Mentale Gesundheit – Stressreduktion und Resilienz durch digitale AchtsamkeitsinterventionenTobias Esch und Maren M. Michaelsen
4Die Pflege der Zukunft – differenziert, emanzipiert und menschlichAndrea Schmidt-Rumposch und Sonja Lehringer
EXKURS: „Meine Station“ – auf dem Weg zum Human HospitalNadja Nardini, Felix Herter und Friedrich Hubertus Schmitz-Winnenthal
5Gesundheitsberufe im WandelEva-Maria Nilkens und Tatjana Ossiek
EXKURS: Eine freundliche Ansage – Verbesserung der Erreichbarkeit und Entlastung durch ein Service- und InformationscenterSusanne Oeder
6New Leadership – über den Mut, Zukunft zu gestaltenVera Starker
7Familie und Beruf im GleichgewichtAngela Rüland
IVTransformation Ebene 4: Werte, Purpose und Kultur
1Erfolgreiches Corporate Responsibility ManagementMichael Gastaldo
EXKURS: Organisationsethik im Human HospitalGeorg Marckmann
2Eigentum neu denken – Purpose-Economy für ein nachhaltiges GesundheitswesenFelix Hoffmann
3Gesundheitswelt im Wandel – wie Werte der Generationen X, Y und Z Krankenhäuser verändern werdenDaniel Dettling
4Wegbereiter für die Medizin der Zukunft – wertebasierte Führung in KrankenhäusernCarla Eysel
EXKURS: Den ganzen Menschen sehenEhsan Natour
5Achtsamkeit bei Patienten und BehandlernGustav Dobos und Heidemarie Haller
EXKURS: Healing Culture – wie Kultur zur Gesundheit beitragen kannInsa Schrader
6Humane Medizin – wie der Abbau von Überversorgung zu mehr Gesundheit führen kann und mussChristian Schulz und Katharina Thiede
EXKURS: Klinikseelsorge als zentraler Bestandteil eines Human HospitalEileen Krauße
7Green Hospital – Green MindsetTobias Emler
8Konzepte für humane Krankenhausbauten – wie Architektur heilen hilftChristine Nickl-Weller, Hans Nickl und Stefanie Matthys
9Vom Reparaturbetrieb zur Gesundheitswerkstatt – das Krankenhaus als Präventionsbegleiter am Beispiel der KardiologieAnja Roggel, Amir A. Mahabadi und Tienush Rassaf
I Transformation Ebene 1: Mensch, Gesellschaft und Gesundheit
1Annäherung an ein neues Menschenbild in der Medizin
Jochen A. Werner
Ein normaler Werktag in Deutschland morgens um sieben Uhr: Viele hunderttausend Menschen drängen sich in Treppenhäusern und vor Hauseingängen und warten. Nein, sie warten nicht auf die Öffnung des Discounters, um bloß nicht das aktuelle Angebot zu verpassen. Sie warten auf Einlass, Einlass in eine von über 60.000 Arztpraxen, um dann gewöhnlich gegen acht Uhr endlich ins Wartezimmer gelassen zu werden. Dort heißt es weiter warten, bis der Haus- oder Facharzt endlich die durchschnittlich gut sieben Minuten Zeit findet (in Schweden übrigens über 20 Minuten), sich um seinen Patienten zu kümmern. 250 Werktage im Jahr das gleiche Bild und man muss kein Betriebs- oder Volkswirtschaftler sein, um zu erahnen, welche gigantischen Ressourcen an Arbeitszeit und damit Geld hier von Montag bis Freitag verschleudert werden. Und man muss auch kein Mediziner sein, um sich vorzustellen, dass es in dieser kurzen Behandlungs- und Gesprächszeit insbesondere bei einer Erstdiagnose schwierig ist, sich ein genaues Bild von den Beschwerden und damit von einer exakten Diagnose mit anschließender maßgeschneiderter Therapie zu machen.
1.1Istzustand
Dieser szenische Einstieg in das Thema will keineswegs die Haus- und Fachärzte angreifen, die jeden Tag für ihre Patienten Großartiges leisten. Ganz im Gegenteil: Der „Massenbetrieb“ ist ja gerade Ausdruck ihres ärztlichen Ethos, ihres unermüdlichen Strebens, allen Menschen zu helfen, jedem gerecht zu werden, niemanden nicht zu behandeln. Sie reiben sich jeden Tag in ihren Praxen auf, ohne aber natürlich in ihrem Kosmos und ihrem Verantwortungsbereich das System verbessern zu können. Aber auch die Arbeitszeit und die Kraft der Ärzte in Praxis und Krankenhaus sind beschränkt, zumal ein wesentlicher Teil davon auf Dokumentation, die Erfüllung von Vorschriften und die Abrechnung der erbrachten Leistungen verwendet wird, anstatt auf das Patientengespräch und die Behandlung. Nicht nur die Patienten, sondern auch und gerade die niedergelassenen Ärzte sind Leidtragende eines Gesundheitssystems und einer verfestigten Fortschrittsverweigerung, die Deutschland langsam, aber mit jedem Tag deutlich spürbarer von einer zeitgemäßen medizinischen Versorgung entfernt. Nicht viel besser ist die Situation in den Kliniken, wo ebenfalls – auch bei elektiven Eingriffen – unnötige Wartezeiten, ineffiziente Prozessabläufe, die Suche nach freien Betten und Kapazitäten eher die Regel als die Ausnahme sind – von teilweise untragbaren Zuständen in den Notaufnahmen ganz zu schweigen.
Vor allem bleibt eines auf der Strecke: Menschlichkeit!
Bevor der mitunter komplexe Sachverhalt weiter erläutert wird, muss in diesem Zusammenhang mit einem Missverständnis, einem verbreiteten Selbstbetrug aufgeräumt werden: Dass Deutschland über eines der besten Gesundheitssysteme der Welt verfügt. Das mag vielleicht einmal so gewesen sein, ist aber aktuell definitiv nicht mehr der Fall. Richtig ist vielmehr, dass wir in Deutschland trotz Ausgabe von fast einer halben Billion Euro jährlich (!) für Gesundheitsdienstleistungen eine unterdurchschnittliche Lebenserwartung sowie – mit zunehmender Dynamik – ein ungesteuertes Krankenhaussterben verzeichnen. Obwohl es im Vergleich mit dem europäischen Schnitt ausreichend Pflegekräfte gibt, spürt man auch an der Universitätsmedizin Essen schmerzhaft den Mangel an gut ausgebildeten Pflegekräften, übrigens auch den Mangel an gut ausgebildetem Personal in fast allen anderen Berufsfeldern. Dafür gibt es jedoch bundesweit viel zu viele Krankenhausbetten, eine weit überbordende Bürokratie und das Primat des Datenschutzes statt des Patientenwohls. Deutschland ist leider zunehmend perfekt darin, risikoscheu zu agieren, Chancen und Perspektiven neuer Technologien geradezu reflexartig zunächst einmal abzuwürgen, statt zu fördern. Ein gutes Beispiel für diese Verweigerungshaltung – just beim Schreiben dieses Beitrags – ist der im Dezember 2023 geschlossene EU AI Act, also die Verordnung zur Regulierung und Steuerung von Künstlicher Intelligenz.
Man kann zurecht die Frage stellen, ob es nicht prinzipiell naiv ist, seitens der EU die wahrscheinlich wirtschaftlich und technologisch wichtigste Kraft, eben die Künstliche Intelligenz, überhaupt regulieren zu wollen. Zumal in anderen Teilen der Welt diese staatliche Regulierung, im Übrigen auch noch ein bürokratisches Monster, überhaupt nicht zur Debatte steht: Eine Geisteshaltung, die zunächst nach Hindernissen und nicht nach Chancen sucht, die immer erst reguliert statt fördert, die Kreativität unterdrückt und auf Gleichmacherei setzt. Um es klar zu sagen: Es soll keineswegs für eine ungehinderte Ausbreitung einer zweifellos risikobehafteten Technologie plädiert werden. Im Gegenteil: Es muss gerade in der Medizin bei solchen Themen achtsam gehandelt werden, das ist auch gelebter Standard bei der Einführung neuer Verfahren, Operationstechniken oder Medikamente. Aber das Verhältnis zwischen Fortschrittsoffenheit und gerechtfertigter Skepsis, zwischen Optimismus und Pessimismus, zwischen Machen und Verweigern ist grundsätzlich aus der Balance geraten.
Das zweite Missverständnis neben der irrigen Annahme, unser Gesundheitssystem sei Weltspitze, ist die Verwendung des Terminus. Das Wort „System“ suggeriert Effizienz, ineinandergreifende Zahnräder, ganzheitliches Denken, ein harmonisches Zusammenwirken im Sinne eines übergeordneten Ziels. Dabei ist das genaue Gegenteil richtig: Unser Gesundheits-„System“ besteht aus Silos und Sektoren mit teils widerstrebenden Partikularinteressen, deren Schnitt- und Übergabestellen demzufolge mehr schlecht als recht funktionieren. Jeder Patient erlebt dies auf seiner Reise – manchmal auch seiner Odyssee – zwischen Hausarzt, Facharzt, Krankenhaus, Rehabilitation und Pflegeheim. Der Terminus wird in diesem Beitrag dennoch weiterverwendet, einfach weil er eingeführt und bekannt ist. Man sollte aber niemals vergessen, dass das Gesundheitssystem eben kein funktionierender Organismus, keine geschmierte Prozesskette ist, sondern vielmehr von tiefen Gräben, Mauern und knallharten Individualinteressen geprägt ist.
1.2Neue Patientenrolle
Zurück zum Eingangsbeispiel und der Rolle des Patienten: Es ist unklar, ob die immer noch sehr untertänige Mentalität gegenüber den Ärzten und allen übrigen Leistungserbringern etwas mit der obrigkeitshörigen deutschen Mentalität zu tun hat oder eher damit, sich in der Mangelwirtschaft Gesundheitssystem tunlichst nicht unbeliebt zu machen, um überhaupt noch behandelt zu werden. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Klar ist aber: Die Maßstäbe haben sich verschoben, und wer in letzter Zeit einmal auf der Suche nach einem Handwerker war, hat ebenfalls erlebt, dass sich die eigene Rolle und Position von der eines Kunden immer mehr zu der eines Bittstellers verändert hat.
Es fehlt häufig an Wertschätzung gegenüber den Patienten. Und auch dies ist kein Vorwurf an die Menschen mit Patientenkontakt, kein Vorwurf an Ärzte, Pflegepersonal, Sprechstundenhilfen, MTAs und MFAs. Ich bin fest davon überzeugt und habe es in meiner ärztlichen Karriere durchgängig erlebt, dass alle diese Menschen fast ausnahmslos gewillt sind, das Beste für die Patienten zu erreichen, Freundlichkeit, Wärme und Wertschätzung eingeschlossen. Aber es fällt eben schwer, in einem zunehmend dysfunktionalen, an vielen Stellen von Überlastung geprägten Gesundheitssystem freundlich und wertschätzend zu sein, wenn zehn Patienten am Tresen in der Praxis stehen oder auf Station im Krankenhaus das Telefon ohne Unterlass klingelt, wenn man gerade im Gespräch mit Patienten ist. Nicht nur die Patienten selbst, auch die Leistungserbringer sind Opfer jahrzehntelanger struktureller Versäumnisse. Soweit die Zustandsbeschreibung, soweit das Delta zu einer menschenzentrierten Medizin, zu einem Human Hospital.
Denn die zentrale Frage ist: Wie können die Zustände verändert und verbessert werden? Die Antwort lautet: durch den smarten Patienten.
Um gleich Missverständnissen vorzubeugen: Der Idealtyp des smarten Patienten ist (noch) keine Realität, die man sich durch die Benennung eines Begriffs gleichsam herbeizaubern kann. Der smarte Patient ist vielmehr das Endresultat eines Prozesses, der Änderung von Denk- und Verhaltensweisen. Andererseits liegt der smarte Patient auch nicht in der utopischen Zukunft. Er steht gewissermaßen schon vor der Tür. Es braucht nicht viel, um ihn Realität werden zu lassen.
Man sollte beim smarten Patienten selbst anfangen, genau genommen bei 84 Millionen Bundesbürgern. Jeder Mensch, egal wie alt, egal welchen Geschlechts, ob gesund oder krank, ist seit seiner Geburt eher sogar seit seiner Zeugung ein Patient. In hoffentlich nicht allzu ferner Zeit, wenn die Vitaldaten der Menschen über Smartwatches, Mobiltelefone oder ähnliche Geräte permanent überwacht und verdächtige Abweichungen sofort an den behandelnden Arzt übersendet werden, ist diese Neudefinition und Erweiterung des klassischen Begriffs „Patient“ durch die erlebte Rundumbetreuung womöglich schon etablierter als heute.
Eine zentrale Kernbotschaft ist: Die Beschreibung „Patient“ muss von der Beschreibung „krank“ entkoppelt werden.
Jeder Mensch hat den Wunsch und hat das Recht, möglichst lange und mit möglichst hoher Lebensqualität zu leben. Das bedeutet: Nicht der Umgang mit einer akuten Erkrankung, also gewissermaßen die Störung des angestrebten Normalzustandes, sondern die Gesamthaftigkeit des Lebens mit allen Anstrengungen, diesen Zustand des langen, gesunden Lebens zu erreichen, definiert den smarten, aufgeklärten, informierten Patienten.
Doppeltes Dilemma
Es wird deutlich, dass eine solche zeitgemäße Definition das doppelte Dilemma des deutschen Gesundheitssystems offenbart: Zum einen beeinträchtigt die mangelnde Digitalisierung nicht nur die optimale Behandlung erkrankter Menschen. Fast noch schlimmer erscheint, dass die digitalen Defizite die wichtigste, bislang noch sträflich ungenutzte, aber unverzichtbare Ressource „Vorsorge und Eigenverantwortung“ ausbremsen – eine Ressource, die auch angesichts des demografischen Wandels und der zunehmenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung unserer Gesundheitsversorgung dringend gehoben werden muss.
1.3Notwendige Veränderungen
Das Gesundheitssystem befindet sich seit Jahren in einem Zustand der Agonie und des Stillstands. Dieser Text ist vor dem Hintergrund der frustrierenden und desillusionierenden gesundheitspolitischen Entwicklungen gegen Ende des Jahres 2023 entstanden, die neben einer strategischen Zusammenhanglosigkeit sämtlich auszeichnet, dass im Grunde einige notwendige Gesetzes- und Reformvorhaben weitgehend zum Stillstand gekommen sind, wie die Krankenhausreform oder der Erfolg der Umsetzung immer noch ungewiss ist (z.B. die elektronische Patientenakte). Der „Wind of Change“ fegt garantiert nicht durch das deutsche Gesundheitswesen. Stattdessen entfernt sich die deutsche Gesundheitsversorgung mit jedem Tag mehr davon, zukunftsfest, leistungsfähig und dauerhaft finanzierbar zu sein.
Die Zeit zur Lösung vieler struktureller Herausforderungen wird knapp.
Und so wird eine Überzeugung immer stärker: Der überfällige Veränderungsimpuls kann nur aus dem System selbst heraus erfolgen. Und zwar nicht von den eigentlich dafür zuständigen Institutionen, der Politik, den Verbänden, Vereinigungen, Interessensgruppen, sondern von der Ressource, um die sich eigentlich alles drehen sollte, die bislang aber in einer zutiefst passiven Rolle gefesselt ist: die erwähnten 84 Millionen Patienten.
Ihnen wachsen eine neue Aufgabe und Verantwortung zu: Sie müssen und werden die Chancen der Digitalisierung für ihre Gesundheit vehement einfordern. Sie werden sich angesichts einer im Privaten zunehmend digitalisierten Welt, in der schon viele Friseurtermine online vereinbart, verschoben oder abgesagt werden können, nicht länger der gigantischen Zeit- und Ressourcenverschwendungsmaschine „Gesundheitsversorgung“ aussetzen wollen. Nicht aus einer altruistischen Verantwortung für das Gesundheitssystem. Sondern weil sie es für sich persönlich als unerträglich und anachronistisch empfinden, in Treppenhäusern zu warten, statt online Behandlungsslots beim Arzt zu vereinbaren.
Selbst in den Kontaktpunkten der Bürger zur deutschen Verwaltung, wahrlich kein Hort des Fortschritts und der Digitalisierung, hat sich in dieser Hinsicht zumindest eine marginale Servicequalität etabliert, über die digitale Vereinbarung von Behördenterminen bis hin zum Wartezeitenmanagement vor Ort – immerhin kleine Fortschritte. Wenn Patienten nur lange genug fordern, werden sich Ärzte und Kliniken fragen, ob es nicht doch angezeigt ist, sich über ein smartes, serviceorientiertes Patientenmanagement Gedanken zu machen. Ein Service, der übrigens nicht nur den Patienten hilft, sondern auch den Betrieb der Klinik oder der Praxis deutlich erleichtert und die Beschäftigten konkret entlastet – keine Theorie, sondern konkrete Erfahrungen, die wir an der Universitätsmedizin Essen mit der Einführung unseres digitalen Service- und Informationszentrums zur Steuerung von Patientenanrufen machen.
Im Gespräch mit niedergelassenen Ärzten hört man oft, dass diese angesichts einer in den nächsten zehn Jahren bevorstehenden Praxisschließung oder -übergabe nicht mehr bereit oder in der Lage seien, neue und vor allem digitale Technologien einzuführen. Ich kann auf der einen Seite diese nur zu menschliche Haltung verstehen, zumal angesichts der gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen die Refinanzierung der damit verbundenen Investitionen ungewiss ist. Man fragt sich nur: Wer sonst im Wirtschaftsleben – vom Konzern bis zum Handwerksbetrieb – könnte es sich leisten, frank und frei zu erklären, nicht mehr in die Zukunft investieren zu wollen? Wahrscheinlich niemand, weil er sonst vom Markt verschwinden würde. Nur in der Medizin ist diese Einstellung überhaupt denkbar. Bei allem Verständnis für die schwierigen Umstände: Wenn man sich fragt, warum das Faxgerät nach wie vor im Gesundheitswesen nicht wegzudenken ist, ist diese Geisteshaltung ein wesentlicher Grund.
Der smarte Patient ist dazu ein Kontrapunkt. Er fordert eben genau das ein, was noch häufig fehlt: eine datenbasierte Gesundheitsversorgung und damit das Ausschöpfen der medizinischen Möglichkeiten. Der smarte Patient will lange gesund und aktiv leben. Und er nutzt dazu die Möglichkeiten, die ihm eine digitale Medizin bietet.
Dies hört sich zunächst harmlos an, ist aber im Kern ein epochaler Wandel des damit verbundenen Menschenbildes. Denn die augenblickliche Struktur des Gesundheitssystems gibt die Entmündigung der Patienten gleichsam vor. Sie haben keine Ansprüche zu stellen, sie sind keine fordernden Kunden, sondern brave Wartende. Im Gegenzug wird ihnen auch nichts abverlangt. Sie brauchen keine Rechnungen zu bezahlen, als Kassenpatient noch nicht einmal zu kontrollieren. Der monatliche Kassenbeitrag reicht, um alle medizinischen Leistungen in Anspruch nehmen zu dürfen.
Bisher sind Intransparenz, Ineffektivität, Passivität die Leitplanken des Gesundheitssystems.
1.4Fazit
Nach über 40 Jahren in verschiedenen verantwortlichen Positionen im Gesundheitssystem habe ich erst in jüngerer Zeit – schmerzlich – erkannt: Die großen Herausforderungen – Smart Hospital, Green Hospital, Human Hospital als Verbindung und Dach aller Anstrengungen – das ist in der Tat alles unverzichtbar. Aber alle diese Themen bilden eben nur den Rahmen, sie formen die Infrastruktur. Sie sind die institutionalisierten Eck- und Endpunkte eines langen Weges, aber eben nicht der tatsächliche Hebel der Veränderung.
Der tatsächliche Hebel ist – wie immer in großen und übergreifenden Transformationsprozessen – der Mensch.
Für die notwendigen und tiefgreifenden Bewusstseins- und Verhaltensveränderungen hin zum smarten Patienten sind ein hoher Informationsstand, Aufgeklärtheit und digitale Affinität erforderlich. Gesundheit und gesunde Lebensführung müssen daher zwingend früh und fest im staatlichen Bildungssystem verankert sein. Bei aller staatlichen Fürsorge, und gerade bei uns in Deutschland sind die Ansprüche in dieser Hinsicht besonders hoch, wird das Gesundheitssystem der Zukunft ohne deutlich gesteigerte Eigenverantwortung nicht mehr funktionieren und auch nicht mehr bezahlbar sein. Es braucht daher im Idealfall 84 Millionen smarte Patienten, eine Volksbewegung aufgeklärter Menschen, die ihr wichtigstes Gut, die Gesundheit, deutlich stärker selbst verantwortet und nicht den Partikularinteressen einer lösungsunfähigen Gesundheitspolitik überlassen möchte.
Natürlich wird es nicht über Nacht geschehen, jahrzehntealte Denk- und Handlungsstrukturen, auch anerzogene Passivität aufzubrechen. Es kann aber dennoch schnell gehen: Weil erkannt wird, wie eklatant durch mangelnde Digitalisierung das Delta zwischen medizinischen Möglichkeiten und eigener medizinischer Versorgung auseinandergeht. Weil realisiert wird, wie wenig die eigenen Anstrengungen zur Prävention gewürdigt und beispielsweise auch in geringere Kassenbeiträge umgesetzt werden.
Der smarte Patient zeichnet sich nicht nur durch die Nutzung des Mobiltelefons oder der Smartwatch aus. Dies ist unverzichtbar, aber es sind letztlich nur Instrumente. Der smarte Patient hat vor allem ein neues, selbstbewusstes, auch von Eigenverantwortung geprägtes Bild von sich und seiner Rolle in der Gesundheitsversorgung. Er ist damit nicht Bestandteil, sondern vielmehr Nukleus einer menschenzentrierten, wertschätzenden Medizin – im Human Hospital und einem ganzheitlich funktionierenden Gesundheitswesen.
Prof. Dr. Jochen A. Werner
Jochen A. Werner hat Medizin an der Christian-Albrechts-Universität Kiel studiert. 1987 promovierte er und begann seine Tätigkeit als Arzt und Wissenschaftler an der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie des Universitätsklinikums Kiel. 1993 Habilitation und 1995 Ernennung zum leitenden Oberarzt der Kieler Universitäts-HNO-Klinik. 1998 wurde Jochen A. Werner Professor und Direktor der Marburger Universitäts-HNO-Klinik und war von 2004 bis 2006 auch Prodekan der Marburger Medizinischen Fakultät. Von 2011 bis 2015 war er hauptamtlicher Ärztlicher Geschäftsführer der Universitätsklinik Gießen und Marburg (UKGM GmbH). Ebenfalls 2011 Aufnahme in die Deutsche Akademie der Nationalen Leopoldina. Zusätzlich übernahm Werner 2014 und 2015 die Rolle des Sprechers im Medical Board des UKGM Mutterkonzerns Rhön-Klinikum AG. Seit 2015 widmet sich Jochen A. Werner in seiner Funktion als Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen der Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Gebiet der Medizin und der Transformation der Universitätsmedizin Essen in ein Human Hospital.
2Von der Rückkehr der Krankenhäuser zu den Menschen
Susanne Moebus
2.1Hintergrund
Mit Blick auf die großen Themen – Demokratie, Klimawandel und Urbanisierung – die unsere Gesellschaften bereits enorm prägen, wird auch die nachhaltige Transformation unseres Gesundheitssystems dringend notwendig. Als zentrale Akteure im Gesundheitssystem sind Krankenhäuser nicht nur von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen, sondern sind auch Verursacher von klimaschädlichen Entwicklungen. Sie tragen somit Verantwortung für nachhaltige Praktiken und Prozesse. Doch aus der Perspektive von Public Health wird die Bedeutungszumessung unvollständig, wenn Menschlichkeit und Nachhaltigkeit dabei vernachlässigt werden.
Die Ottawa-Charta von 1986 (WHO 1986) legt den Grundstein für ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit. Sie betont u.a. die Notwendigkeit, Gesundheit in den alltäglichen Lebenswelten der Menschen zu gestalten. Damit stehen die Wechselwirkungen zwischen Umweltveränderungen, sozialen Determinanten und wirtschaftlicher Entwicklung im Zentrum zur Förderung der Gesundheit der Menschen. In diesem Kontext kann eine systemisch orientierte Krankenversorgung ein zentraler Baustein der Transformation sein.
Vor diesem Hintergrund diskutiert dieses Kapitel, wie Krankenhäuser grundlegende Veränderungen herbeiführen können, um gesundheitsförderliche, nachhaltige und insgesamt menschenfreundliche Einrichtungen zu werden. Es wird argumentiert, dass Ansätze und Denkweisen von Public Health und insbesondere von Urban Public Health wertvolle Ideen beisteuern können. Dieses Kapitel beleuchtet, wie Public Health dazu beitragen kann, den Zusammenhang zwischen Klimawandel, Gesundheit und Krankenhäusern neu zu interpretieren und auf diese Weise transformative Maßnahmen zu identifizieren. Im Vordergrund steht das Konzept der Salutogenese, darauf aufbauend wird die Krankenhausgestaltung als zentraler Teil kommunaler Gesundheitslandschaften vertieft.
2.2Begrifflich-konzeptionelle Grundlagen
(Urban) Public Health
Public Health orientiert sich an der Vision einer Gesellschaft, in der das Recht auf Gesundheit für alle Menschen gesichert ist. Hierfür stehen Instrumente zur Verfügung, die nicht nur auf medizinischen Erklärungsmodellen basieren, sondern auch die Adressierung gesellschaftlicher Verhältnisse umfassen.
In einer Ära, die von globalen Herausforderungen wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust und sozialer Ungerechtigkeit geprägt ist, können die Konzepte, wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen von Public Health eine integrative Rolle spielen, die weit über ihr traditionelles Handlungsfeld hinausgeht. Die Potenziale, die Public Health in die anstehenden Transformationsprozesse für eine gesunde, chancengerechte und nachhaltige Zukunft einbringen kann, sind jedoch noch kaum bekannt und daher erheblich unterschätzt.
Eine wirksame Strategie zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks des Gesundheitssystems liegt in der Fokussierung auf die Vermeidung von Krankheiten, insbesondere durch eine verhältnisorientierte Gesundheitsförderung. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Lebensumwelt der Menschen und damit auf ihre Gesundheit haben. Zentrale Hebel sind dabei die Schaffung gesundheitsförderlicher Lebens- und Umwelträume sowie die konsequente Integration von Gesundheitsaspekten in alle politischen Entscheidungen („Health in All Policies“). Diese Hebel sind v.a. für urbane Gebiete relevant, da die globale Verstädterung als der „mächtigste Prozess des sozialen Wandels im 21. Jahrhundert“ gilt (WBGU 2016).
Die räumliche Gestaltung beeinflusst maßgeblich, wie Menschen in ihrem Alltag lernen, arbeiten, sich fortbewegen und sich erholen können. Eine gesundheitsförderliche räumliche Gestaltung zielt darauf ab, allen Menschen den Zugang zu sozial-ökologisch nachhaltigen Produktions- und Konsumformen, Mobilitäts- und Infrastrukturen und eben auch zu Gesundheitseinrichtungen – zu ermöglichen. Durch die Schaffung entsprechender Strukturen und Verhältnisse werden den Menschen bestmögliche Chancen für ein ökologisch und sozial nachhaltiges sowie gesundes Verhalten ermöglicht. Urban Public Health adressiert diese räumlich orientierte und umfassende Perspektive.
Gesundheit und Gesundheitsförderung
„Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt gestaltet und gelebt: an den Orten, wo sie lernen, arbeiten, spielen und lieben.“ (WHO 1986)
Die Ottawa-Charta, die durch die internationale Staatengemeinschaft, darunter auch Deutschland, verabschiedet wurde, beruht auf einem ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit. Sie ist eines der zentralen Leitbilder von Public Health. Gesundheitsförderndes Handeln verlangt die Gestaltung politischer, ökonomischer, sozialer, kultureller und ökologischer Faktoren mit dem Ziel einer für alle Menschen gerechten Entwicklung. Dieses Gesundheitsverständnis erfordert die Reflexion der vielfältigen Einflüsse, die sich aus den Interaktionen des Menschen mit seiner physischen, sozialen und ökonomischen Umwelt ergeben.
Die Salutogenese wird als Perspektivenerweiterung zum pathogenetischen Modell der Medizin verstanden. Während in der pathogenetischen Denkfigur vor allem die Entstehung von Krankheiten und die Mechanismen pathogener Prozesse im Vordergrund stehen, zielt die Salutogenese auf die Gestaltung gesundheitserhaltender und -fördernder Prozesse. Dem liegt ein radikal anderes Verständnis von Gesundheit zugrunde: Die Pathogenese versteht Gesundheit dichotom (krank vs. nicht krank). In diesem Sinne ist die Gesundheit die Norm und die Krankheit die Abweichung von dieser Norm. Die Salutogenese hingegen betrachtet Gesundheit und Krankheit als Pole eines gemeinsamen Kontinuums, das sich ständig austariert. Gesundheit wird also nicht als etwas verstanden, das man „hat“ oder „bekommt“, sondern als ein dynamischer Prozess, der sich in unterschiedlichen Kontexten und auf allen gesellschaftlichen Ebenen vollzieht. Diese Perspektive macht Gesundheit zu einem politischen Paradigma, bei dem Entscheidungen in allen Politikbereichen (wie Wirtschaft, Bildung, Verkehr, Landwirtschaft, Umwelt) immer auch gesundheitliche Folgen haben – wie die COVID-19-Pandemie anschaulich demonstriert. Für eine gelingende Transformation von Krankenhäusern zu humanen, menschenorientierten Gesundheitsorten bildet ein solches, auch politisches Gesundheitsverständnis eine zentrale Prämisse.
2.3(Urban) Public Health Perspektive auf den Klimawandel
Gesundheitliche Dimensionen kompakt beleuchtet
Klimabezogene Gesundheitsprobleme betreffen nicht nur Einzelpersonen, sondern die gesamte Bevölkerung und insbesondere benachteiligte Bevölkerungsgruppen. Die tiefgreifenden Transformationsprozesse, die sowohl die Reduktion von Treibhausgasemissionen (Mitigation) als auch die Anpassung an die Klimawandelfolgen (Adaptation) umfassen, erfordern eine erweiterte Perspektive, die über die individuelle kurative Medizin hinausgeht.
Die Analyse der Auswirkungen des Klimawandels folgt bisher sogenannten Klimawirkungsketten. Dabei werden zunächst Klimaänderungen wie Temperaturanstieg, Extremwetterereignisse und Meeresspiegelanstieg als Ausgangsbasis zugrunde gelegt. Die Analyse erstreckt sich dann auf Expositions- und Umweltpfade wie Hitze, Luftverschmutzung und veränderte Vektorübertragungswege, die schlussendlich zu den bekannten gesundheitlichen Folgen wie Hitzschlag, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Atemwegserkrankungen führen. Teilweise werden intermediäre Faktoren wie soziale Verhältnisse in die Wirkungskette integriert.
Es gibt mehrere Gründe, die gegen ein solch enges Verständnis von Klimawandel und Gesundheit sprechen:
Eine lineare, auf Risiken fokussierte Klimawirkungskette lenkt den Blick darauf, dass ein ökologisch und sozial nachhaltiger Umgang mit dem Klimawandel auch gesundheitliche Potenziale besitzt (Mlinarić et al. 2023). Denn Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen des Klimawandels können häufig mit positiven Effekten, sogenannten Co-Benefits, für die Gesundheit verbunden sein. Co-Benefits stellen eine radikal neue Möglichkeit dar, zunächst unpopulär erscheinende Maßnahmen – eine Mobilitätswende mit Umstieg auf aktive Mobilität oder eine nachhaltige, pflanzenbetonte Ernährung – zum Klimawandel zu begründen und zu kommunizieren. Damit können Co-Benefits dazu beitragen, die Umsetzung von Klimamaßnahmen zu beschleunigen und v.a. eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen (WHO 2020).
Darüber hinaus blendet das enge Verständnis die Heterogenität der Klimawirkungen und die Komplexität der Wechselwirkungen und Wirkungspfade aus. Tatsächlich sind die Effekte oft miteinander verknüpft und können sich gegenseitig verstärken, was zu kumulativen Gesundheitsrisiken führt, die mit sozialen Determinanten wie sozioökonomischen Status, Migrationsstatus oder Beruf verknüpft sind.
Weiterhin sind nicht nur Risiken und Belastungen ungleich verteilt, sondern auch die Verfügbarkeit von Ressourcen und die Resilienz von Individuen und Bevölkerungsgruppen.
Handlungserfordernisse im Bereich der Adaptation und Mitigation können auf etablierten Public-Health-Ansätzen und -Lösungen aufsetzen. Hierzu gehören die Umsetzung von Maßnahmen in Lebenswelten, die partizipative Einbindung und Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, die Zusammenarbeit von Akteuren aus Praxis und Wissenschaft, einschließlich Gesundheitsbehörden, Politik und Wirtschaft.
Gesundheitssystem im Kontext des Klimawandels
Klimaschutz und -anpassung betreffen nicht nur bekannte Maßnahmen wie den Ausstieg aus der fossilen Energienutzung, die Kühlung von Hitzeinseln in Städten oder den Umstieg auf erneuerbare Energien. Vielmehr geht es auch um ein breiteres Verständnis von gesundheitsförderlichen Umweltbedingungen. So fordert die Weltgesundheitsorganisation:
„[…] ein Umdenken in der Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, produzieren, konsumieren und regieren. [...] Der Gesundheitssektor muss eine neue Rolle spielen, um diesen Transformationsprozess voranzutreiben“ (WHO 2020, S. 20, eigene Übersetzung)
Der Gesundheitssektor ist folglich ein elementarer Akteur in sozial-ökologischen Transformationsprozessen und muss sich seiner Rolle bewusster werden. Krankenhäuser spielen eine zentrale Rolle in der Anpassung an die anstehenden Transformationen, indem sie nicht nur Prozesse der Krankheitsversorgung ändern, sondern auch ökologische Verantwortung übernehmen und sich aktiv an der Förderung der öffentlichen Gesundheit beteiligen müssen. Denn Krankenhäuser gehören u.a. zu den energieintensivsten Systemen (Bratan u. Ostertag 2022) und es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um zu prüfen, wie sie nachhaltiger – und menschenzugewandter – aufgestellt werden können.
Ein nachhaltiges Krankenhaus zeichnet sich durch viele verschiedene Facetten aus und geht weit über einen niedrigen Energie- und Wasserverbrauch hinaus. Der gesamte ökologische Fußabdruck eines Krankenhauses muss erfasst und gemanagt werden. Die Lieferketten eines Krankenhauses sind lang und komplex und erfordern viel Aufmerksamkeit, um die Nachhaltigkeitsauswirkungen der Herstellung, des Transports, des Verbrauchs und der Entsorgung dieser Produkte zu analysieren und zu ändern (Werner et al. 2022). Aber auch die Behandlungsprozesse bergen viel Optimierungspotenzial (McNeill et al. 2021).
Eine gelingende Umsetzung ist nicht möglich, wenn sie nicht von Beginn an als Führungsaufgabe verstanden und Teil des Organisationsprinzips wird. Umsetzungsbeispiele bietet neben dem „Green Hospital“ von Werner et al. 2022 u.a. das Netzwerk „Health Care Without Harm“, das sich seit mehr als 20 Jahren weltweit für Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen einsetzt. Hier wird Kliniken Zugang zu Handlungsempfehlungen zu Nachhaltigkeitsthemen wie Führung, Chemikalien, Abfall, Energie, Wasser, Transport, Ernährung, Arzneimittel und Beschaffung ermöglicht.
Um den ökologischen Fußabdruck von Gesundheitseinrichtungen zu reduzieren, gibt es verschiedene Hebel, von denen die Gesundheitsförderung der effizienteste und v.a. menschenwürdigste ist, um krankheitsbezogene Leistungen zu senken. Für die direkte Reduktion von Emissionen im Bereich der Krankheitsleistungen sind eine Vielzahl von Ideen und Maßnahmen identifizierbar: Aufbau grüner Infrastrukturen, dekarbonisierte Transportmittel, Umsetzung einer zirkulären Gesundheitsökonomie, koordinierte Pflegeversorgung, integrierte Technologiesysteme („Smart Hospital“) und virtuelle medizinische Versorgung. Die notwendigen weitreichenden Transformationsprozesse müssen von Anfang an systemisch gedacht werden
2.4Systemische Krankenversorgung in urbanen Räumen
Krankenhäuser spielen als zentraler Bestandteil des Gesundheitssystems eine herausragende Rolle, insbesondere auf kommunaler Ebene. Sie zählen wie das Verkehrssystem oder die Energie- oder Nahversorgung zum „Urban Safety Net“. Auch baulich sind Krankenhäuser als öffentliche Einrichtungen von herausragender Bedeutung für die Stadtgesellschaft. Sie wurden früher – ähnlich wie Rathäuser, Theater, Museen – als Wahrzeichen gebaut, die ihre räumliche Umgebung dominieren. Diese identifikationsstiftende Rolle haben moderne Krankenhäuser verloren. Sie sind heute hochkomplexe Funktionsbauten, die insbesondere die Ökonomisierung der Krankheitsversorgung widerspiegeln. Das Krankenhaus hat seine Anbindung an die räumliche Umgebung verloren und ist für die Menschen nur noch schwer zu verstehen. Ursache für diese Entwicklung sind u.a. spezifische Leitbilder der Stadtentwicklung, aber auch das o. g. pathogenetische Krankheitsverständnis.
Die heutige Krankenhausversorgung bedeutet damit sowohl den Ausschluss kranker Menschen aus den innerstädtischen Wohnquartieren als auch den Ausschluss der Öffentlichkeit aus dem Ort Krankenhaus.
Eine Humanisierung der Krankenhäuser („return the hospitals to the people“) konnte selbst durch verschiedene Reformen nicht erreicht werden. Im Gegenteil: Die extreme Ökonomisierung verstärkt eher die Monofunktionalität von Krankenhäusern. Es fehlt bisher eine nachhaltige Vernetzung eigenständiger und dennoch dem Krankenhaus räumlich und funktional angebundener Bereiche, die Unterstützungsleistungen (wie zum Beispiel Selbsthilfe, Reha-Einrichtungen, Hospize, ambulante medizinische Zentren) anbieten.
Für eine umfassend verstandene urbane Krankheitsversorgung bedarf es der Transformation der Krankenhäuser in gesundheitsförderliche, nachhaltige wohngebiets- und gesundheitsbezogene Einrichtungen („Community Health Care Center“). Das bedeutet eine sowohl bauliche als auch funktionale Einbindung des Krankenhauses in die urbane Nachbarschaft, in den Stadtbezirk, in die Stadt. Danach wären für die Planung und Ausgestaltung
Nachhaltigkeit und Resilienz übergreifende Leitthemen,
inter- und transdisziplinäre Entwicklungs, Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse grundlegende Handlungsfelder und
die Digitalisierung mehr als nur ein innovativer Entwicklungsbaustein, sondern für eine systemisch verstandene Gesundheit sogar Grundvoraussetzung.
Das salutogenetische Modell mit seinen fließenden Übergängen zwischen Gesundheit und Krankheit übersetzt in Struktur und Funktion eines Krankenhauses, ermöglicht ein deutlich weiter gefasstes Verständnis von Krankenhaus. So könnten Teile des bisherigen Krankenhauses auch so gedacht, gestaltet und so in das Stadtgebiet als öffentlicher Begegnungsort eingebettet werden, dass hierdurch zentrale sozial(-ökologische) Gesundheitsorte entstehen. Diese umfassen neben hochtechnisierten, spezifischen klinischen Einrichtungen (wie einer Universitätsmedizin) partizipativ angelegte klinisch-medizinische Unterstützungsleistungen sowie öffentliche Räume für verschiedene Anlässe und Bedürfnisse der Stadtbevölkerung. Es würde Übergänge geben von hochtechnisierten, intensivklinischen Einrichtungen hin zu Einrichtungen und Orten, wo sich die Alltagswelten der städtischen Bevölkerung abspielen.
Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in Anbetracht der Herausforderungen durch die gegenwärtigen Megatrends Vernetzung, Klimawandel und Urbanisierung eine ökologische, nachhaltige und humanorientierte Transformation der Krankenhäuser ganz oben auf der Agenda steht. Dies erfordert innovative und systemisch gedachte Ansätze, um das Krankenhaus in ein zukunftsweisenden „Ort der Gesundung und Nachhaltigkeit“ zu transformieren. Dies umfasst eine lokal und regional vernetzte, digital hochentwickelte und agile Einrichtung, in der Teams partizipativ und im Sinne der Salutogenese zusammenwirken. Diese an Menschen und dem Primat der Nachhaltigkeit ausgerichtete Gesundheitsversorgung gilt es zu entwickeln und auf den Weg zu bringen.
Literatur
Bratan T, Ostertag K (2022) Ressourcenschonung im Gesundheitssektor – Status Quo und Handlungsbedarf. In: Kloepfer A (Hrsg) Umwelt und Gesundheit. iX-Forum 1, 6–11
McNeill A, McGain F, Sherman J (2021) Planetary Health Care: A framework for sustainable health systems, Lancet Planetary Health 5, E66–E6. DOI: 10.1016/S2542-5196(21)00005-X
Mlinarić M, Moebus S, Betsch C et al. (2023) Klimawandel und Public Health in Deutschland – Eine Synthese der Handlungsoptionen des Sachstandsberichts Klimawandel und Gesundheit 2023. J Health Monit 8(S6), 61–91 DOI: 10.25646/11771
WBGU (2016) Der Umzug der Menschheit: Die transformative Kraft der Städte. Hauptgutachten Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. URL: https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/derumzug-der-menschheit-die-transformative-kraft-der-staedte (abgerufen am 15.01.2024)
Werner J, Kaatze T, Schmidt-Rumposch A (Hrsg.) (2022) Green Hospital. Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung im Krankenhaus. MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin
WHO – World Health Organization (2020) WHO Global Strategy on Health, Environment and Climate Change. The transformation needed to improve lives and wellbeing sustainably through healthy environments. URL: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/331959/9789240000377-eng.pdf?sequence=1 (abgerufen am 16.01.2024)
WHO – World Health Organization (1986) Ottawa Charta. URL: https://www.bv-gesundheit.org/grundlagen/who-ottawacharta/ (abgerufen am 16.01.2024)
Prof. Dr. rer. nat. Susanne Moebus, MPH
Susanne Moebus ist promovierte Biologin, Professorin für urbane Epidemiologie und Direktorin des 2019 gegründeten Forschungsinstituts für urbane Public Health an der Medizinischen Fakultät der Universitätsmedizin Essen. Das Institut ist die erste Forschungseinrichtung dieser Art an einer Medizinischen Fakultät. Susanne Moebus und ihr Team erforschen mit modernen Methoden sowohl die Zusammenhänge zwischen städtischer Umwelt und Gesundheit als auch die gesundheitsförderliche Gestaltung urbaner Räume. Sie war Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention. Zudem ist sie Mitglied der Steuerungsgruppe des deutschlandweiten Zukunftsforums Public Health (ZfPH) und Leiterin des Forschungsfeldes „StadtGesundheit“ im Kompetenzfeld Metropolenforschung (KoMet) der Universitätsallianz Ruhr.
3Mit Resilienz die Zukunft gestalten
Christian Schuldt
In einer global vernetzten Welt, die für neuartige Dimensionen der Gefährdungen anfällig ist, wird eine neue Zukunftskompetenz zentral: die Fähigkeit, adaptiv auf Krisen zu reagieren. Auch und gerade im Gesundheitssystem werden die 2020er-Jahre zur Dekade der Resilienz.
3.1Einleitung
Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energie, Finanz- und Flüchtlingskrisen, Terrorbedrohungen, wachsende soziale Ungleichheit – und als chronische Superkrise der Klimawandel: In einer global vernetzten und ökologisch verletzten Welt wird der Modus der Krise zum festen Bestandteil einer neuen Normalität. Die Lebensrealität im 21. Jahrhundert ist komplexer, dynamisierter und unvorhersehbarer als je zuvor. Die „Risikogesellschaft“, die der Soziologe Ulrich Beck bereits vor 35 Jahren beschrieb (Beck 1986), hat eine neue, global vernetzte Ebene erreicht. Sie erzeugt vielschichtigere Problemlagen, auch für das Gesundheitssystem.
Vor allem die Corona-Krise hat drastisch vor Augen geführt, wie globale Pfadabhängigkeiten unser gewohntes Leben plötzlich aus den Fugen werfen können. Dabei wurde auch ein strukturelles Prinzip der neuen Netzwerkgesellschaft deutlich: Sie bietet keine langfristig stabilen oder verlässlich berechenbaren Strukturen mehr. Beständigkeit kann unter vernetzten Vorzeichen immer nur punktuell oder phasenweise gegeben sein. Damit sind die Vorstellungen von Eindeutigkeit und Steuerbarkeit, die noch bis ins späte 20. Jahrhundert galten, endgültig passé.
Die Polykrise stellt die interdependente, hyperkomplexe Welt des 21. Jahrhunderts – und damit auch das Gesundheitssystem – nun vor eine existenzielle Frage: Wie sieht ein produktiver Umgang mit Krisen aus, auch mit solchen, die nicht prognostiziert werden können oder noch nicht einmal gedacht sind? Ins Zentrum rückt dabei ein bereits bekannter Begriff – der im Kontext spätmoderner Krisenkonstellationen eine völlig neue Relevanz erlangt: Resilienz.
3.2Systemischer Umgang mit Unsicherheit
Resilienz ist der passende Begriff für die fundamental neue Weise, in der spätmoderne Gesellschaften die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts formulieren und prozessieren. Je unvorhersehbarer die Risikopotenziale werden, umso mehr rückt die Frage nach der Widerstands- und Regenerationsfähigkeit in den Fokus – gesellschaftlich, organisational und individuell. Dieser „Resilient Turn“ zeichnet sich schon länger ab. So bezeichnete etwa das World Economic Forum 2013, das unter dem Motto „Resilient Dynamism“ stattfand, das Resilienzkonzept als einen „21st Century Imperative“ (Huffington 2013).
Zentral ist dabei ein ganzheitlicheres und systemischeres Verständnis von Sicherheit. Je klarer wird, dass sich Bedrohungen und Risiken permanent verändern, umso mehr muss Sicherheit verstanden werden als ein dynamischer, kontinuierlicher Prozess, als eine Variable, die ständig neu ausgehandelt und aufgebaut werden muss, individuell, organisational und gesellschaftlich. Die Corona-Krise und auch die Folgen des Ukraine-Krieges sind kollektive Erfahrungen der Verwundbarkeit, die klarmachen: Jetzt ist die Zeit gekommen für ein Umschwenken auf Adaption und den Ausbau systemischer Schutzfaktoren.
Eine zentrale Voraussetzung dafür ist ein erweitertes Verständnis für die Entwicklungsdynamiken komplexer Systeme. Je mehr die hochkomplexen Herausforderungen der vernetzten Gesellschaft Ungewissheit und Unsicherheit steigern, umso wichtiger werden kluge systemische und intersektorale Kompetenzen und Konstellationen. Auch im Gesundheitssystem lauten die neuen Zukunftsfragen deshalb: Wie können sich individuelle und soziale Systeme gegen Unvorhergesehenes wappnen? Was stärkt die Überlebensfähigkeit in Krisenzeiten? Und was stiftet systemischen Zusammenhalt? Antworten finden sich im paradigmatischen Umschalten auf Komplexität und Adaption.
3.3Die Evolution des Resilienzdiskurses
Um zu verstehen, wie ein komplexes und zukunftsfähiges Resilienzverständnis gestaltet sein muss, das der dynamisierten Netzwerkwelt des 21. Jahrhunderts gerecht wird, hilft zunächst ein Blick auf die Evolution des Resilienzdiskurses. Rückblickend lassen sich dabei vier Phasen nachzeichnen, die einander allerdings überlagern und teilweise bis heute parallel verlaufen.
In der ersten Phase seit den 1950er-Jahren ging es primär darum, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen personalen, familiären und sozialen Schutzfaktoren und der individuellen Gesundheit zu ermitteln. Standen zunächst Ansätze der Stressforschung im Fokus, folgte der eigentliche Durchbruch der Resilienzforschung durch die deutsch-amerikanische Entwicklungspsychologin Emmy Werner: In einer Langzeitstudie untersuchte sie, warum einige Kinder der Hawaii-Insel Kauai, die unter widrigen Umständen aufgewachsen waren, sich später dennoch zu gesunden und selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln konnten (Werner 1977). Die zentrale Erkenntnis der Längsschnittstudie, die über 40 Jahre in regelmäßigen Abständen aktualisiert wurde: Resilienz ist nicht angeboren, sondern kann erlernt werden.
Heute herrscht gemeinhin Konsens darüber, dass persönliche Resilienz auf etwa sieben bis zehn sogenannten Resilienzfaktoren beruht. Dazu zählen Optimismus und Gelassenheit, Netzwerk, Zukunfts- und Lösungsorientierung, Improvisationstalent sowie die Fähigkeiten, in Krisen einen Sinn zu sehen, die Opferrolle verlassen zu können und Verantwortung für die eigene Situation zu übernehmen (Fathi 2014).
In der zweiten Phase ab den 1980er-Jahren verlagert sich der Fokus auf die komplexen Wirkmechanismen der verschiedenen Schutzfaktoren: auf ihre Kontextspezifität, ihre Wechselwirkungen und die Dynamik der daraus resultierenden Entwicklungs- und Anpassungsvorgänge. Die Erkenntnisse aus der ersten Phase bildeten damit die Basis für eine stärkere Konzentration auf die Prozesse der Resilienz und die Frage nach dem „Wie“. Je mehr sich dabei herauskristallisierte, dass Resilienz kein bloßes Persönlichkeitsmerkmal ist, sondern vielmehr vom Lebensumfeld und den individuellen Erfahrungen abhängt, umso mehr verlagerte sich der Fokus der Forschung auf das Ableiten von Prozessmodellen.
Der Ansatz des israelischen Stressforschers Aaron Antonovsky läutete einen Paradigmenwechsel ein. Statt danach zu fragen, wie Krankheiten entstehen (Pathogenese), fokussierte Antonovsky auf die Salutogenese: auf die Frage, wie Gesundheit entsteht (Antonovsky 1979; 1997).
Gesundheit ist demnach kein stabiler Zustand, sondern ein aktiver Aushandlungsprozess, der von internen wie externen Einflüssen abhängt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Sense of Coherence, das Gleichgewicht zwischen Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit und Machbarkeit des eigenen Lebens. Der Einfluss der Umwelt auf die persönliche Resilienz und das neue Verständnis von Gesundheit als einem aktiven Aushandlungsprozess eröffnete einen neuen Blickwinkel auf Resilienz – und verlagerte die Forschung auf die Frage, welche vorbeugenden Maßnahmen eine relevante Rolle spielen.
Eine dritte Phase setzte seit den 1990er-Jahren mit der Erarbeitung und Etablierung von Resilienzförderungsprogrammen ein. Immer mehr geht es seitdem darum, effektive Maßnahmen und Präventionsstrategien zu entwickeln, um Individuen, Organisationen, Infrastrukturen und Ökosysteme zu ermächtigen, sich zu erholen und die eigene Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Das Ziel ist dabei nicht die Prävention von Krisen, sondern ein resilienter Umgang mit den destabilisierenden Effekten, die mit Krisen einhergehen.
3.4Resilienz heute: Bounce forward
Die vierte Phase der Resilienzforschung hat in den 2000er-Jahren begonnen. Sie ist geprägt durch interdisziplinäre Ansätze und Mehrebenenmodelle, die nicht nur psychosoziale und physiologische Faktoren, sondern auch neurobiologische Prozesse betrachten. 2014 wurde das Deutsche Resilienz Zentrum an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gegründet, das neurowissenschaftliche, medizinische, psychologische und sozialwissenschaftliche Ansätze zur Erforschung der Resilienz vereint.
Neuere Forschungen sehen Resilienz nicht als definierbares Set persönlicher Eigenschaften oder förderlicher Umweltbedingungen, sondern betonen Faktoren wie Prozesshaftigkeit, Variabilität, Situationsabhängigkeit und Multidimensionalität. Anstatt die individuelle Widerstandsfähigkeit zu untersuchen, geht es darum, Resilienzkonstellationen zu identifizieren: Wie wirken kollektive und individuelle Resilienz zusammen? Aus dieser Perspektive eröffnen sich auch komplexe Fragen danach, was Städte und ganze Gesellschaften resilient macht. Historisch hat sich der Fokus der Resilienzforschung also zunehmend erweitert: Ging es zunächst darum, die Faktoren herauszufinden, die einzelne Individuen widerstandsfähig machen, dominiert inzwischen die übergeordnete Frage nach resilienten Konstellationen und resilienten Gesellschaften. Übergreifend ist der heutige Resilienzdiskurs dabei von zwei dominanten Definitionsansätzen oder Denkrichtungen geprägt ist (siehe unten): Bereits seit den 1970er-Jahren etabliert ist ein statisch-stabiliätsorientiertes Verständnis, das Resilienz vor allem als Sicherheit und Funktionsfähigkeit definiert („Resilienz 1.0“, bounce back). Erst in jüngerer Zeit an Relevanz gewonnen hat eine evolutionär-innovationsorientierte Perspektive, die Resilienz als dynamische Risikoanpassung und „beständige Unbeständigkeit“ sieht („Resilienz 2.0“, bounce forward).
Was ist Resilienz?
Grundsätzlich bezeichnet Resilienz die Fähigkeit eines Systems, schnell auf akute Krisen oder Rückschläge zu reagieren und sich an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Diskurshistorisch lassen sich dabei zwei zentrale Resilienzansätze nachzeichnen (Manyena et al. 2011; Roth 2020):
Robustheit („Resilienz 1.0“): Das System kehrt nach einer Störung in den Ursprungszustand zurück (bounce back).
Anpassungsfähigkeit („Resilienz 2.0“): Das System adaptiert sich kontinuierlich an veränderte Umweltbedingungen (bounce forward).
Übergreifend spielt das Prinzip der Ambidextrie oder „Beidhändigkeit“ eine zentrale Rolle für die Schaffung und Erhaltung von Resilienz: die dynamische Kombination aus Stabilität (Identität, Sicherheit, Verlässlichkeit) und Flexibilität (Beweglichkeit, Offenheit, Kreativität).
In einer Welt, die von multiplen und oft unvorhersehbaren Krisen geprägt ist, gewinnt der Ansatz der Resilienz 2.0 immer mehr an Relevanz. Schließlich macht erst die evolutionäre Anpassung an neue Umweltbedingungen ein System kontinuierlich leistungsfähiger und langlebiger. Zugleich jedoch ergänzen und bedingen sich beide Ansätze wechselseitig: Ohne Flexibilität fallen Veränderung und Anpassung schwer, ohne feste Verwurzelung bleibt Beweglichkeit ein richtungsloses Mitschwimmen im Strom. Voraussetzung für Resilienz ist also ein vitales Verhältnis von Robustheit und Adaptivität, von Tradition und Innovation, von Regulierung und Dynamisierung.
3.5Komplexität systemisch verstehen
Die Grundlage für einen konstruktiven Umgang mit Störungen und erhöhter Umweltvolatilität bildet ein evolutionäres und systemisches Verständnis von Komplexität. Ausgehend von der Basiserkenntnis, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, richtet sich der Fokus neu aus: Es geht weniger um einzelne Systemelemente als um ihr dynamisches Zusammenspiel und die reflexiven Lerneffekte, die dabei erzielt werden. Resilienz besteht deshalb im Kern darin, „systemrelevante“ Lernkompetenzen zu trainieren.
Eng damit verknüpft ist ein ganzheitliches Verständnis systemischer Vernetzungsstrukturen. Gemäß dem „Gesetz der erforderlichen Varietät“ besteht eine ausgewogene Vernetzungskonfiguration in der Balance zwischen Zentralität und Dezentralität (Ashby 1956). Die Vernetzung eines resilienten Systems ist deshalb weder überkomplex (alles ist mit allem verbunden) noch unterkomplex (Verbindungen sind nur zufällig oder lose), sondern sie nutzt Knotenpunkte, um ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und Variabilität zu schaffen. Das beste Beispiel dafür ist das menschliche Gehirn: Um die Speichersysteme unterschiedlicher Hirnregionen schnell auslesen und prozessieren zu können, sind seine 100 Billionen Synapsen über Knotenpunkte verschaltet. Erst so wird ein agiles Zusammenspiel von Struktur und Diversität möglich.
Das gleiche Prinzip gilt für den Aufbau resilienter Netzwerke in und zwischen sozialen Systemen, der mit steigender gesellschaftlicher Komplexität zentral für die Überlebensfähigkeit wird. Das hat auch die Corona-Krise deutlich gemacht: Je weniger globale Risiken innerhalb von Nationalstaaten zu bewältigen sind, umso mehr verlagert sich die Verantwortung für Zukunftssicherheit zu internationalen Kooperationen sowie zu Unternehmen und Individuen. In diesem Kontext sind auch die Ansätze für ein resilientes Gesundheitssystem zu finden.
3.6Das resiliente Gesundheitssystem
Eine resiliente Gesellschaft ist eine gesunde Gesellschaft. Nur gesunde Individuen können sich an permanente Umweltveränderungen anpassen und auch Krisen trotzen. Lag das Augenmerk in puncto individueller Resilienz lange darauf, zu erforschen, wie Menschen gestärkt aus Lebenskrisen hervorgehen können, ist heute eine „prophylaktische“
Perspektive vorrangig. Angesichts zunehmender psychischer Stresserkrankungen verlagert sich der Blick auf Stressprävention und vorbeugende Gesundheit: auf die Erforschung der Faktoren, die Individuen in Krisenzeiten helfen, nicht zusammenzubrechen.
Die Corona-Krise hat dabei den Schwerpunkt verändert. Seit der Pandemie liegt der gesundheitliche Fokus weniger auf Wellness und Selbstoptimierung, stattdessen ist die Abwesenheit von Krankheit wieder zum zentralen Gesundheitsthema geworden. Und je deutlicher wird, dass mentale und körperliche Gesundheit von zahlreichen äußeren Faktoren abhängen, umso mehr verschiebt sich auch die Verantwortung für Gesundheit hin zu Institutionen und Organisationen – zu den größeren Kontexten, in denen Menschen leben. Für die langfristige Stärkung der gesamtgesellschaftlichen Resilienz spielen Gesundheitssysteme daher eine zentrale Rolle.
Ein wichtiger Bereich ist dabei das Thema Klimaresilienz, schließlich sind gesundheitliche Präventionsmaßnahmen häufig zugleich Klimaschutzmaßnahmen. Angesichts der fortschreitenden Klimakrise rückt diese Schnittstelle zwischen individueller und planetarer Resilienz zunehmend ins Zentrum. Die Verbindung von Klimawandel und Gesundheit ist ein sehr überzeugendes Thema, das jeden Menschen emotional trifft: Sobald uns bewusst wird, dass es bei Themen wie Baumsterben oder Meeresversauerung auch ganz konkret um unsere eigene Gesundheit geht, um das Wohlergehen unserer Familie, sind wir ganz anders betroffen. Wer persönlich und emotional involviert ist, kann anders überzeugt werden und entwickelt einen starken Handlungsdrang.
Medizinischen Fachkräften wird in diesem Prozess eine Schlüsselrolle zuteil, weil sie als „Transformator:innen“ auftreten können, die Menschen überzeugen. „Wir haben eine hohe Glaubwürdigkeit, die im Rahmen der Pandemie stark gestiegen ist“, sagt Prof. Dr. Claudia Traidl-Hoffmann, Medizinerin und stellvertretende Direktorin des Zentrums für Klimaresilienz in Augsburg: „Deshalb müssen wir jetzt sagen: Wir müssen das gemeinsam angehen.“ (Zukunftsinstitut 2021) Das Gesundheitssystem steht dabei allerdings vor einer Art Doppelherausforderung: Zum einen soll es für Patienten und Patientinnen Resilienz herstellen, etwa in Form von Frühwarnsystemen oder der Anpassung von Medikationen bis hin zur Versorgung von vulnerablen Gruppen. Zum anderen ist das Gesundheitssystem selbst einer der größten globalen CO2-Verursacher, muss also den Weg zur CO2 Neutralität einschlagen.
2021 beschloss der Deutsche Ärztetag deshalb, Klimawandel und Gesundheit in die Weiterbildung zu integrieren, auch das gesundheitliche Versorgungssystem wird auf Investitionen in klimafreundliche Geldmittel umgestellt. Das Augenmerk liegt aber auch auf einzelnen Disziplinen: Wie kann beispielsweise die Anästhesie, die klimaschädliche Narkosegase verwendet, klimaneutraler werden? Darüber hinaus wird auch versucht, die Krankenhäuser CO2-neutral zu gestalten – eine der großen Zukunftsherausforderungen, vor denen das Gesundheitssystem steht.
3.7Resiliente öffentliche Räume
Deutlich wird das Zusammenspiel verschiedener Kontexte für eine Steigerung der gesundheitssystemischen Resilienz auch am Beispiel der neuen Resilienzanforderungen an urbane soziale Räume. Auch hier schuf die Pandemie ein Momentum: Sie machte Städte zum Teil eines sozial-ökologischen Experiments, an das Architekt:innen, Stadtplaner:innen, Bürgermeister:innen und Politiker:innen nun anknüpfen können, um die physische und psychische Gesundheit innerhalb von Städten langfristig zu fördern.
Ein Beispiel ist das Vorantreiben von autofreien und fahrradfreundlichen Innenstädten, das gleich doppelt positive Effekte erzeugt: für die Menschen wie für das Klima. Auf solche Winwin-Effekte zielen auch Initiativen wie „10 Minute Walk“, die allen Menschen in US-amerikanischen Städten bis 2050 einen sicheren Zugang zu einem hochwertigen Park oder einer Grünfläche garantieren will, maximal zehn Gehminuten von ihrem Zuhause aus. Eine ähnliche Idee verfolgt das inzwischen populär gewordene Konzept der 15-Minuten-Stadt: Sämtliche wichtigen Bereiche des Lebens sollen innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein. Ganz generell sorgen hyperlokale Strukturen in Städten automatisch für Vielfalt und Redundanz – und schaffen Infrastrukturen, die auch in Notfällen funktionieren und die Vulnerabilität einer Stadt verringern.
An diesem Punkt wird deutlich, dass der eigentliche Kern städtischer Resilienz in der Kraft des Sozialen liegt: im gemeinschaftlichen Zusammenhalt resilienter Communities, die sich besonders gut in belebten Stadtvierteln entwickeln können. Maßnahmen für eine gesteigerte Resilienz verbessern dann auch unmittelbar die Lebensqualität vor Ort. Von elementarer Bedeutung ist dabei auch das Thema soziale Gerechtigkeit. Gerade die Frage, wie Klimaresilienz und soziale Gerechtigkeit vereinbar sind, wird noch viele Aushandlungsprozesse provozieren – etwa wenn es um das Menschenrecht auf Gesundheit geht, an der Schnittstelle zwischen Medizin und Recht. Doch auch progressive Konzepte wie ein bedingungsloses Grundeinkommen sind in diesem Kontext zu verorten, denn die positiven Effekte einer Grundeinkommenssicherheit umfassen auch eine Verbesserung der persönlichen Gesundheit (Llanque 2021).
3.8Unsicherheitskompetenz und Zukunftsmut
In einer Zeit, in der das Zusammenspiel von ökologischen, ökonomischen, sozialen, geopolitischen und technologischen Systemen schwer abschätzbare Risiken erzeugt, wird eine systemische Perspektive ausschlaggebend für eine resiliente Aufstellung des Gesundheitssystems. Angesichts multidimensionaler Krisenphänomene und -potenziale muss sich ein resilienter Gesundheitssektor auch gegen vielfältige denkbare Krisendimensionen wappnen.
Die Basis dafür bildet ein Mindset, das Wandel immer auch als Chance begreift. Im Grunde geht es um die Wiederentdeckung eines uralten Lebensprinzips, das der griechische Philosoph Heraklit schon vor rund 2.500 Jahren formulierte: Panta rhei – alles fließt. In der Ära der multiplen Krisen erlangt dieses Prinzip eine neue Relevanz und Dringlichkeit. Auch das macht deutlich, dass gesundheitssystemische Resilienz künftig sehr viel mehr bedeutet als nur die Anpassung an sich ständig verändernde Gegebenheiten. Sie impliziert auch das aktive, gemeinsame Gestalten von Möglichkeitsräumen: offen, flexibel und zukunftsmutig.
Das neue Resilienzparadigma – der Übergang in den Modus der „Resilienz 2.0“ – markiert dabei einen historischen Bruch mit dem modernen Optimismus der Systemkontrolle. Die über lange Zeit etablierte Vorstellung der festen Einplanbarkeit von Unwägbarkeiten in die Struktur- und Funktionszusammenhänge sozialer, technischer und natürlicher Systeme wird gleichsam auf den Kopf gestellt: Resiliente Systeme sind gerade deshalb zukunftssicher, weil sie im mechanischen Sinne „unsicher“ sind – weil sie ihre inneren Strukturen in Varianz wiederherstellen können. Zur zentralen Voraussetzung für die Schaffung von Zukunftssicherheit wird deshalb die Kultivierung einer grundsätzlichen Unsicherheitskompetenz. Das Sicherheitsmanagement von morgen surft auf den Wellen der Unsicherheit.
Literatur
Antonovsky, A (1979) Health, Stress and Coping. Jossey-Bass San Francisco
Antonovsky, A (1997) Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit. DGVTVerlag Tübingen
Ashby, WR (1956) An Introduction to Cybernetics. Chapman & Hall London
Beck, U (1986) Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp Frankfurt am Main
Fathi, K (2019) Resilienz im Spannungsfeld zwischen Entwicklung und Nachhaltigkeit. Anforderungen an gesellschaftliche Zukunftssicherung im 21. Jahrhundert. Springer Wiesbaden
Huffington, A (2013) Davos 2013: Resilience as a 21st Century Imperative. URL: https://www.linkedin.com/pulse/20130122234855-143695135-davos-2013-resilience-as-a-21st-century-imperative (abgerufen am 24.4.2023)
Llanque, M (2021) Grundeinkommen, made in Gyeonggi. In: enorm 04/2021, 60–63
Manyena, B et al. (2011) Disaster Resilience: A Bounce Back or Bounce Forward Ability? In: Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability 16(5), 417–424
Roth, F (2020) Bouncing forward – Wie Erkenntnisse aus der Resilienzforschung in der Corona-Krise helfen können. URL: https://www.isi.fraunhofer.de/de/blog/2020/resilienz-corona-krise.html (abgerufen am 24.4.2023)
Werner, E (1977) The Children of Kauai. A Longitudinal Study from the Prenatal Period to Age Ten. University of Hawaii Press Hawaii
World Economic Forum (WEF) (2021) The Global Risks Report 2021. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021 (abgerufen am 24.4.2023).
Zukunftsinstitut (Hg.) (2021) Zukunftskraft Resilienz. Gewappnet für die Zeit der Krisen. Frankfurt am Main
Dieser Text basiert auf der Publikation „Zukunftskraft Resilienz“ des Zukunftsinstituts.
Christian Schuldt
Christian Schuldt ist Soziologe, Autor und Zukunftsforscher. Schwerpunkt seiner Forschungen und Publikationen ist der Kultur- und Medienwandel im Zuge der digitalen Transformation. Für das Zukunftsinstitut leitete er die Studie „Zukunftskraft Resilienz“ (Zukunftsinstitut 2021). Seit 2023 ist Schuldt Geschäftsleiter des Thinktanks The Future:Project (thefutureproject.de), der Organisationen auf dem Weg in eine resiliente Zukunft unterstützt.
EXKURS:Unterstützung in Krisensituationen – bürgerschaftliches Engagement als Inkubator für mehr Menschlichkeit
Tim Geldmacher
Schwerwiegende Erkrankungen wie z.B. Krebs ist nicht nur eine medizinische Herausforderung, sondern eine Lebenskrise, die ganze Familien erschüttert. Sie verändert den Alltag, wirft fundamentale Fragen auf und stellt das gesamte soziale Gefüge auf die Probe. In solch dramatischen Zeiten zeigt sich, wie bedeutsam ein tragfähiges Netzwerk aus staatlichen, medizinischen und bürgerschaftlichen Strukturen ist. Dieser Text betrachtet die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements insbesondere im Gesundheitswesen, und nimmt den Essener Verein Menschenmögliches e.V. als prägnantes exemplarisches Beispiel.
Familien in der Krise: die unterschätzte Herausforderung
Die Diagnose Krebs wirkt auf eine Familie wie eine Zäsur: Nichts ist mehr wie zuvor. Dies trifft auf den Erkrankten ebenso zu wie auf seine Angehörigen, vor allem auf die Kinder. Der familiäre Alltag wandelt sich, wird bestimmt durch Arztbesuche und Therapiesitzungen. Nicht nur der Patient ist betroffen, die gesamte Familie muss sich an die neue Realität anpassen. In Deutschland sind jährlich rund 200.000 Kinder von der Krebserkrankung eines Elternteils betroffen. Angesichts dieser hohen Zahl fehlen im Gesundheitssystem tragischerweise gezielte institutionalisierte Unterstützungsangebote für die betroffenen Familien.
Jedes Familienmitglied erlebt die Krankheitssituation individuell, was oft zu einem Gefühl der Überforderung führt. Die Eltern sorgen sich insbesondere um ihre Kinder, die unterschiedlich auf die veränderte Situation reagieren, etwa durch Angst oder Rückzug. Hier ist es entscheidend, den Kindern Unterstützung und Stabilität zu bieten.





























