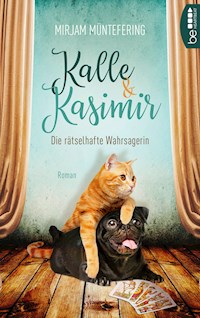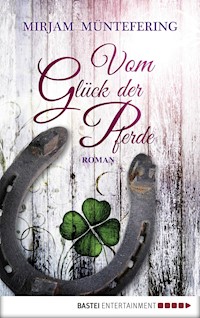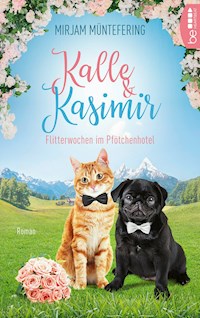4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf den Hund gekommen!
Lara versteht die Welt nicht mehr: Nach zwanzig Jahren Ehe will ihr Mann sie verlassen - für eine Jüngere! Kurzentschlossen packt sie ihre Sachen und flüchtet zu ihrer Freundin nach Usedom. Doch was soll sie nun mit ihrem Leben anfangen? In ihren alten Job, in der Firma ihrer Noch-Schwiegereltern kann sie nicht zurück.
Bald bietet sich ihr jedoch eine einzigartige Chance: Sie soll für zehn Wochen eine Hundetagesstätte als Urlaubsvertretung übernehmen - und das, obwohl sie gar keine Ahnung von den Vierbeinern hat. Das merkt auch Niklas, der ihr unter die Arme greifen soll und leider verdammt gut aussieht ...
Ein Muss für alle, die heitere Liebesromane und Tiere lieben. EBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
GANZ BESONDERS
Über dieses Buch
Lara versteht die Welt nicht mehr: Nach zwanzig Jahren Ehe will ihr Mann sie verlassen – für eine Jüngere! Kurzentschlossen packt sie ihre Sachen und flüchtet zu ihrer Freundin nach Usedom. Doch was soll sie nun mit ihrem Leben anfangen? In ihren alten Job, in der Firma ihrer Noch-Schwiegereltern kann sie nicht zurück.
Bald bietet sich ihr jedoch eine einzigartige Chance: Sie soll für zehn Wochen eine Hundetagesstätte als Urlaubsvertretung übernehmen – und das, obwohl sie gar keine Ahnung von den Vierbeinern hat. Das merkt auch Niklas, der ihr unter die Arme greifen soll und leider verdammt gut aussieht ...
Über die Autorin
Mirjam Müntefering, geboren 1969 im Sauerland, studierte Theater- und Filmwissenschaften sowie Germanistik und arbeitete als Fernsehredakteurin. Seit dem Jahr 2000 schreibt sie Jugendbücher und Romane für Erwachsene. Nachdem sie mehrere Jahre lang eine eigene Hundeschule betrieb, konzentriert sie sich inzwischen ganz aufs Schreiben. Sie lebt mit ihrer Partnerin und ihren Hunden im Ruhrgebiet.
Mirjam Müntefering
Hund aufs Herz
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Clarissa Czöppan
Lektorat/Projektmanagement: Rena Roßkamp
Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock/detchana wangkheeree, © shutterstock/Resul Muslu, © shutterstock/Ivonne Wierink, © shutterstock/homydesign, © shutterstock/Zeljko Radojko, © shutterstock/Kamenetskiy Konstantin, © shutterstock/cynoclub, © shutterstock/Very_Very, © shutterstock/Pawel Kazmierczak, © iStock.com/cmannphoto, © iStock.com/yellowsarah
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4283-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1. Kapitel
»Scheidung?«, wiederholte ich irritiert und sah von der Auftragsbestätigung auf, die ich gerade studiert hatte. »Was meinst du mit Scheidung?«
Marcel betrachtete mich einen Augenblick ungläubig durch seine schwarzgerahmte Markenbrille und seufzte dann. »Lara, soll das heißen, dass du mir gar nicht zugehört hast?«
Er stand in meinem kleinen Büro, dem Schreibtisch gegenüber an den Aktenschrank gelehnt, und wirkte mit einem Mal verärgert.
»Ähm …«, machte ich, blinzelte kurz und legte dann entschlossen die Hände auf den vielversprechenden Auftrag vor mir. »Doch. Natürlich. Du hast gesagt, dass Tatjana aus der Buchhaltung schwanger ist«, sagte ich dann. Denn das war tatsächlich das, woran ich mich gerade noch so erinnern konnte. Verflixt, Marcel wusste doch, dass er mich im Büro besser nicht bei der Arbeit störte. Ich war meist so versunken, dass ich nicht viel mitbekam von dem, was er mir mitzuteilen hatte.
»Aber das ist doch kein Beinbruch«, fuhr ich fort, als ich das bestürzte Gesicht meines Mannes sah. »Sie wird vermutlich ein Jahr Elternzeit nehmen. Das können wir irgendwie überbrücken. Unter uns gesagt, die Arbeit, die sie so täglich wegschafft, könnte ich mit Leichtigkeit noch zu meinen Aufgaben dazu nehmen. Sie scheint ja eher dem gängigen Klischee von vollbusigen Sekretärinnen zu entsprechen.« Ich lachte. Doch zu meiner Überraschung lachte Marcel nicht mit. Sein Gesicht verzog sich lediglich zu einer kläglichen Grimasse.
»Larchen«, sagte er dann. Eigentlich hieß ich Lara, aber von unserer Anfangszeit, auch wenn sie schon lange zurücklag, war diese Koseform meines Namens irgendwie als Rudiment geblieben. Marcel nannte mich immer so.
Er löste sich von dem Aktenschrank und trat an den Schreibtisch heran. Ein paar Sekunden lang starrte er mich an. Mit so viel Ernst, schlechtem Gewissen und Flehen im Blick, wie ich es nur von den Momenten kannte, in denen er mich darum bat, wieder einmal seine Eltern Fritz und Elvira Munter, also meine Schwiegereltern und somit die Begründer und Leiter der Reinigungsfirma PUTZmunter, zu einem Abendessen zu uns einzuladen. Angesichts des tollen, großen Auftrags, der vor mir auf dem Tisch lag und gute Laune machte, wollte ich schon gnädig nicken und kommenden Samstag vorschlagen.
Doch da sagte Marcel: »Das Kind ist von mir, Larchen.«
Jetzt war ich diejenige, die starrte. »Das …?«, bekam ich nur mühsam heraus.
«Das Kind. Tatjana und ich«, sagte Marcel so leise, als befürchtete er, mich durch ein zu lautes Wort vom Stuhl zu fegen. Dazu nickte er langsam.
Das musste ein Scherz sein. Oder ein Traum. Ja, bestimmt träumte ich einen dieser extrem realistischen, grausamen Träume, die uns auch das Unmöglichste plötzlich wie die Wirklichkeit erscheinen lassen. Bis wir schließlich nach Luft schnappend aufwachen und uns nassgeschwitzt, aber grenzenlos erleichtert im eigenen Bett wiederfinden. Neben dem Mann, mit dem wir seit zwanzig Jahren verheiratet sind. Doch so sehr ich mich auch bemühte, mir klarzumachen, dass ich nur träumte, ich wurde einfach nicht wach.
»Es tut mir sehr leid, Larchen«, hauchte Marcel, der mich weiter beinahe hypnotisch beobachtete. »Aber du weißt, wie sehr ich immer Kinder wollte. Du weißt, wie sehr ich es bereut habe, dass wir damals, als wir jung genug waren, die Firma über alles gestellt und unsere eigenen Wünsche und Lebensträume zurückgestellt haben.«
Ich musste schlucken. Wusste ich all das wirklich?
»Das mit Tatjana und mir … das war nicht geplant oder so. Bitte denk nicht, dass ich dich verlassen wollte. Es war nur …« Er rang die Hände. »Es ist einfach passiert. Und als sie mir letzte Woche sagte, dass sie … dass wir …« Sein Gesichtsausdruck wechselte von kummervoll verzogener Miene zu … Freude.
Nein. Das konnte doch kein Traum sein. Nicht mal im Traum wäre ich so stumpfsinnig, von einem Ehemann zu fantasieren, der trotz des soeben ausgesprochenen Scheidungswunsches die Dreistigkeit hätte, vor lauter Freude über seine schwangere Geliebte seine Ehefrau dermaßen anzustrahlen.
Vielleicht las er in meinem Blick ebenso wie ich in seinem. Denn er gab sich einen Ruck und räusperte sich.
«Natürlich steht dir die Hälfte des Hauses zu. Ich werde es belasten und dich auszahlen. Aber selbstverständlich erst, wenn wir für dich eine gute Alternative gefunden haben. Was hältst du von einer hübschen Eigentumswohnung in diesem neuen Komplex mit Blick auf den See? Es sollen noch welche zu haben sein, habe ich neulich gehört. Klar. Die sind nicht billig, aber dafür haben die diesen unglaublichen Blick. Weißt du noch, wie wir im letzten Sommer da spazieren waren und die Baustelle angeschaut haben? Du hast gemeint, was für ein wahnsinniges Glück die Leute haben, die da wohnen werden. Immer den See vor Augen und …«
«Raus!«, sagte ich. Meine Stimme, das konnte ich selbst hören, klang eisiger als die der Schneekönigin.
»Larchen, jetzt reagier doch nicht über«, bat Marcel. »Lass uns in Ruhe darüber reden. Ich …«
»Raus hier!«, schrie ich und griff nach dem Briefbeschwerer. Ein Hochzeitsgeschenk seiner Eltern.
Marcel mag manchmal ein bisschen reaktionslahm sein. Doch in diesem Moment beschleunigte er auf ungeahnte Weise. In der Tür drehte er sich noch mal um. »Nimm doch den Rest des Tages einfach frei und …« Ich hob die Hand. Er schloss schnell die Tür. Der Briefbeschwerer traf mit zerstörerischer Wucht das gerahmte Familienbild an der Wand daneben. Das Glas klirrte und splitterte, der Rahmen hüpfte von der Wand und zerschellte am Boden. Ich starrte vom Schreibtisch aus, hinter dem ich aufgesprungen war, darauf. Der Briefbeschwerer mit dieser dämlichen, im Glas eingeschlossenen roten Rose, den ich wegen seines Symbolwertes zwanzig Jahre in Ehren gehalten und auf meinem Firmenschreibtisch geduldet hatte, obwohl ich ihn scheußlich fand, war noch heil. Echte deutsche Wertarbeit eben.
2. Kapitel
«O Gott, das tut mir so schrecklich leid!«, sagte Sandra.
Sie und ich waren seit vielen Jahren befreundet. Eigentlich seitdem ihr Mann Jürgen und Marcel sich im Tennisklub kennengelernt hatten. Deswegen war sie die Erste, die ich nach meinem überstürzten Aufbruch aus der Firma und der Ankunft zu Hause anrief.
»Ich dachte immer, ihr wärt das ideale Paar. Die gemeinsame Arbeit. Gleiche Interessen. Es hat immer alles so gut gepasst.« Ich konnte sie vor mir sehen, wie sie betroffen den Kopf schüttelte. Ihr Mitgefühl tat mir gut.
»Ach, Sandra. Wir wissen doch beide, dass so ein Eindruck täuschen kann. Was nützen denn gemeinsame Hobbys und der ganze Quatsch, wenn dein Mann hinter deinem Rücken doch eine andere vögelt«, sagte ich bitter.
»Du musst erst mal zur Ruhe kommen«, riet Sandra mir.
Ich nickte, und zugleich fiel mir auf, dass Sandra das ja nicht sehen konnte. »Du hast recht«, schob ich hinterher. »Ich glaube, ich brauche jetzt erst mal etwas Zeit, um einen klaren Kopf zu bekommen. Da drin herrscht nämlich gerade Chaos. Kann ich vielleicht bei euch im Gästezimmer übernachten?«
Es wurde sehr still in der Leitung.
»Sandra?«, fragte ich schließlich mit heiserer Stimme.
Sie räusperte sich. »Tut mir wirklich schrecklich leid, das musst du mir glauben. Aber … bitte versteh, dass ich das nicht einfach so über Jürgens Kopf hinweg entscheiden kann. Wir sind schließlich auch seine Freunde. Jürgen und Marcel in ihrem Männer-Tennis-Klub und so. Verstehst du? Da ist es schwierig, sich in so einer Situation auf eine von beiden Seiten zu stellen.«
Eine heiße Welle schwappte mit einem Mal durch meinen Magen. Es tat geradezu körperlich weh. Ich hätte nicht sagen können, wieso, aber dass sie meiner simplen Bitte nicht nachkommen wollte, schmerzte plötzlich fast ebenso, wie Marcels Eröffnung vorhin im Büro es getan hatte.
»Kapiere«, sagte ich dumpf.
»Du bist doch nicht ärgerlich?«
»Scheiße, nein, Sandra«, erwiderte ich. »Ich bin stinkesauer! Wenn du erst deinen Mann fragen musst, ob ich ›ne Nacht in euerm Gästebett schlafen darf, fahr ich besser zu jemand anderem. Jemandem, der es nicht ›schwierig‹ findet.«
»Ach Lara«, murmelte Sandra bestürzt. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie erleichtert war, als wir kurz darauf das Gespräch beendeten.
♥
Ich versuchte es bei allen.
Jaqueline. Theresa. Jennifer. Sogar bei unserem schwulen Freundespaar Mattes und Tom. Alle waren sie schockiert, betroffen, mitfühlend und verständnisvoll. Doch sobald ich um eine vorübergehende Bleibe für die nächsten Tage bat, bekam ich eine Ausflucht nach der anderen zu hören. Das Gästezimmer wird renoviert. Das Schlafsofa ist total kaputt und lässt sich nicht mehr ausklappen. Die Kinder haben allesamt Frühjahrsgrippe. Kurz: Keiner unserer gemeinsamen Freunde stellte sich in dieser grässlichen Situation als mein Freund heraus. Es war niederschmetternd.
Die Stunden verstrichen. Schließlich näherte sich die Uhrzeit, zu der Marcel gewöhnlich Feierabend machte und aus der Firma nach Hause kam. Würde er überhaupt nach Hause kommen? Oder würde er die neu gewonnene Freiheit dazu nutzen, um gleich bei Tatjana zu übernachten?
Ich jedenfalls wollte nicht riskieren, ihm heute noch einmal zu begegnen. Viel zu viel ging mir durch den Kopf, in dem schieres Chaos herrschte. Damit hatte Sandra recht gehabt: Ich brauchte wirklich dringend Ruhe. Also ging ich ins Schlafzimmer hinüber, nahm einige, wenige Sachen aus dem Kleiderschrank und stopfte sie in meine Sporttasche. Als ich den Schrank wieder schloss, hielt ich einen Moment inne. Aus der verspiegelten Tür blickte mir mein eigenes, momentan ziemlich blasses Gesicht entgegen. Offenbar war ich mir beim Telefonieren häufiger durchs lange braune Haar gefahren – es wirkte zerzaust. Meine ebenfalls braunen Augen waren rotgerändert. Kurz: Ich sah genau so aus, wie ich mich fühlte.
Nachdem ich aus dem Büro gekommen war, hatte ich mich umgezogen. Meine Lieblingsjeans wirkten schon reichlich abgetragen und das T-Shirt verwaschen. Ja, in diesem lässigen Freizeitdress sah ich zwar schlank und sportlich aus. Aber die strengen, teuren Kostümchen, die Tatjana im Büro trug, schoben sich plötzlich vor mein inneres Auge. Ihre Anfang-zwanzig-Frische. Das stets perfekte Make-up mit dem knallroten Kussmund. Das eindrucksvolle Dekolleté.
Ich drehte mich zur Seite und zog das T-Shirt straffer. Längst nicht so gewaltig wie Tatjanas Profil, aber immerhin auch kein Flachland. Dann beugte ich mich zum Spiegel vor und betrachtete genau die kleinen Fältchen, die sich in meinen Augenwinkeln eingenistet hatten. Bisher hatte ich immer selbstbewusst die Meinung vertreten, dass man einer Frau ruhig ansehen durfte, dass sie die Vierzig überschritten hatte. Schließlich war das ein wunderbares Alter – nicht mehr geprägt von einer rastlosen Suche wie die Zwanziger oder dem zwanghaften Durchsetzen-Wollen von Herzenswünschen wie in den Dreißigern. Nein, ich hatte immer gedacht, dreiundvierzig zu sein, sei im Grunde der Idealzustand der emanzipierten, starken Frau von heute.
Was für eine Ironie.
Aber was tat ich hier eigentlich? Wenn ich mich noch länger im Spiegel anstarren würde, liefe ich Gefahr, tatsächlich Marcel zu begegnen. Also tat ich, was sich nicht vermeiden ließ. Mit den nötigsten Sachen in meiner Tasche fuhr ich wieder los.
Ich parkte in der vertrauten, immer leicht schmuddelig wirkenden Straße im Norden der Stadt, gegenüber dem Kiosk.
»Hey, Larri, lässte dich ma wieder blicken!«, grölte Mohammed aus der kleinen Öffnung mit dem Schiebefenster. Ich winkte ihm zu. Er kannte mich seit über vierzig Jahren. Ich hatte früher bei ihm gemischte Tüten und die BRAVO gekauft und ein bisschen für den immer gut gelaunten, glutäugigen Kerl geschwärmt – auch wenn er im Alter meiner Eltern war.
»Wie geht’s? Alles paletti?«, rief er mir jetzt zu.
»Es muss, Mohammed. Muss, oder?«, erwiderte ich.
Er lachte.
In dem Moment öffnete sich hinter mir die Tür des kleinen Zechenhäuschens, und meine Mutter erschien im Türrahmen.
»Wusst ich’s doch: Die Stimme kenn ich! Tach, Mohammed!« Sie drehte den Kopf und rief in den Flur: »Issie wirklich, Heinz!«
Ich nickte Mohammed noch einmal zu und ging dann den schmalen, mit den alten Platten gepflasterten Weg entlang zur Haustür.
»Was schleppst du denn da an?«, wollte meine Mutter wissen und winkte dann ab. »Aber schön, dass du dich mal wieder blicken lässt. Komm rein. Papa und ich essen gerade Abendbrot.«
Ich folgte ihr durch den engen Flur in die Küche, die schon früher das Zentrum des Familienlebens gewesen war, als mein Bruder Thomas und ich noch hier gewohnt hatten.
Mein Vater saß am Tisch und schmierte sich gerade ein Brot. »Spätzken! Dat ist aber ›ne Überraschung!«, dröhnte er und nahm meinen Begrüßungskuss mit einem breiten Grinsen entgegen. »Setz dich doch. Willste auch Gürksken? Hat deine Mutter selbst eingelegt.« Er hielt eingelegte Gurken für den Hauptbestandteil der Ernährung einer Vegetarierin wie mir.
»Papa, ich …«, begann ich.
»Jetzt lass das Kind doch erst mal seine Jacke ausziehen«, unterbrach meine Mutter mich und nahm mir die Tasche ab. Beim Hineinspähen zog sie die Brauen hoch. »Sieht ja aus, als wollteste verreisen?!«
Ich sah sie beide an. Da ich nicht sofort antwortete, füllte eine befremdliche Stille den Raum.
»Mama, Papa«, sagte ich schließlich. »Marcel hat mir heute eröffnet, dass er sich scheiden lassen will.«
Mein Vater hielt in der Bewegung inne, mit der er die Leberwurst auf seinem Brot verstreichen wollte.
Meine Mutter setzte die Tasche auf dem Boden ab und legte die Hand an den Mund. »Aber … Kind …«, hauchte sie.
Das dreiundvierzigjährige Kind vor ihr zuckte mit den Achseln.
»Isset wegen dem Alten?!«, knurrte Papa, das Wurstmesser immer noch in der Hand. »Dem warst du doch noch nie gut genug für seinen feinen Juniorfirmenchefsohn.«
»Nein, es ist …«, begann ich.
«O Gott!«, schluckte meine Mutter dazwischen. »Hat er ›ne andere?«
Ich nickte.
Mein Vater bohrte das Messer in die Wurst. »Pffff, wat soll dat denn für eine sein?! Besser als unsre Lara? So hübsch und gertenschlank und hier oben«, er tippte sich mit einem Finger der freien Hand an die Schläfe, »pfiffiger als alle anderen in der Schule. Und dazu ackert se wie ›n Brauereipferd in der blöden Firma. Wat besseres? Pah! Gibt’s doch im Leben nich!«
Ach Papa. Er hat mich schon immer für das hellste Licht unter der Sonne gehalten. Und wie immer tat sein Beistand gut. Aber leider sprach die Realität eine andere Sprache.
»Sie … na ja, sie ist Sekretärin in der Buchhaltung. Und zwanzig Jahre jünger als ich. Und …« Diesmal musste ich schlucken. »… sie ist schwanger.«
«Von ihm?«, quietschte meine Mutter.
»Ja, sicher«, antwortete ich reflexartig schnell.
»Aber ich dachte, er kann nicht …«, stammelte sie und brach verwirrt ab.
»Mama! Ich hab dir doch schon öfter erklärt, dass es nicht allein an Marcel lag. Wir … wollten am Anfang keine Kinder. Und später – hat es einfach nicht mehr geklappt.« Verflixt. Ich hatte es doch gewusst. Hierherzukommen war keine gute Idee gewesen. Ich suchte Ruhe, um meine Gedanken zu ordnen. Stattdessen musste ich nun meinen Eltern Rede und Antwort stehen.
Meine Mutter murmelte etwas Unverständliches und drehte sich zur Küchenzeile, wo sie herumzuhantieren begann.
«Ach, der kriegt sich schon wieder ein«, brummte Papa und biss von seinem Brot ab. »Dat is die Mitleifkreisis, sach ich immer. Da drehen manche einfach durch. Wat sachste, Hilde?«
»Ach nichts«, nuschelte meine Mutter. »Ich dachte nur gerad, dass ich schon immer der Meinung war, dass Kinder eine Ehe zusammenhalten. Das siehst du ja an uns«, setzte sie an mich gewandt nach.
♥
Nachdem ich das Abendessen mit meinen Eltern überstanden hatte, bei dem ich lediglich eine Tasse Tee herunterbekam, zog ich mich eiligst zurück. Mein Jungmädchenzimmer war inzwischen generalüberholt worden und diente meiner Mutter als Bügelzimmer und Besuch als Übernachtungsmöglichkeit. Ich schnappte mir das Telefon und ließ mich aufs Bett sinken.
Jetzt, da ich eine Bleibe für die Nacht gefunden hatte, dachte ich plötzlich an die einzige Freundin, bei der ich nicht spontan hätte unterkommen können. Weil sie einfach zu weit weg wohnte. Aber dafür war ich sicher, dass ihre Reaktion auf meine Neuigkeiten mich nicht enttäuschen würde: Wiebke.
Als wir vierzehn Jahre alt gewesen waren, hatte ich auf ihre Brieffreundinnen-Suchanzeige in der Poprocky geantwortet, und es war ein lebhafter Briefaustausch daraus geworden. Dem folgten häufige gegenseitige Besuche. Wiebke war gerne zu mir ins Ruhrgebiet gekommen und hatte die großstädtischen Ausflüge genossen. Und ich hatte sie auf Usedom besucht, wo Strand, Wald, Meer und Sonne lockten. Wir waren also seit dreißig Jahren eng befreundet.
Obwohl sie auf dem beliebten Campingplatz Ostseeblick in Trassenheide einen kleinen Lebensmittelladen betrieb, eine Familie mit drei Kindern zwischen neun und fünfzehn Jahren, Ehemann Ole und eine kratzbürstige Katze zu managen hatte, war sie gleich am Apparat.
»Du rufst genau zur richtigen Zeit an!«, freute sie sich, als ich mich meldete. »Die Bande sitzt ausnahmsweise mal geschlossen vor der Flimmerkiste, und ich hab meine Ruhe.«
Ich lachte.
Sie stutzte. »Was ist los, Lara?«, fragte sie besorgt.
Und schon heulte ich wie ein Schlosshund. Es war ein wahres Wunder, dass sie aus meinem geschluchzten Gestammel überhaupt etwas heraushören konnte. Erstaunlicherweise war sie aber zum Kern der Sache innerhalb kürzester Zeit vorgestoßen.
»Es ist einfach passiert?«, wiederholte sie mit einer Stimme, die vor Sarkasmus nur so triefte. »So ein Arschloch! Entschuldige …«
»Kein Problem«, erwiderte ich. Und jetzt mussten wir beide lachen. Mit einem Mal hatte ich das Gefühl, als würden sich die Ketten, die sich seit dem Morgen immer enger um meine Brust gelegt hatten, plötzlich weiten. Ich konnte wieder atmen.
»Das ist wirklich eine riesige Sauerei, in der du da jetzt steckst, Lara. Aber eins verstehe ich nicht richtig: Wieso bist du da zu deinen Eltern gefahren?«, fragte Wiebke schließlich.
Ich musste den Kloß im Hals wegräuspern. »Ob du es glaubst oder nicht, aber offenbar stehen Marcels und meine gemeinsamen Freunde in so einer Situation für mich nicht zur Verfügung.«
»Aber Schätzchen, wieso bist du denn nicht erst mal in ein Hotel gegangen?«, wollte Wiebke wissen und entwaffnete mich mit dieser simplen Logik.
Schon heulte ich wieder los. Darauf war ich doch tatsächlich nicht gekommen.
Wiebke ließ mich weinen, murmelte liebevolle Worte und wartete einfach ab, bis ich mich beruhigt hatte. Dann sagte sie in ihrer typischen aufgeräumten Art: »So, jetzt mal ganz sachlich überlegt: Gibt’s momentan etwas, das du im Ruhrgebiet unbedingt erledigen musst? Wie sieht es aus mit Anwalt und so?«
»Tja, ja, den müsste ich morgen wohl mal anrufen«, schniefte ich.
»Aber davon abgesehen … Was ist mit der Arbeit?«
»Die können mir erst mal gestohlen bleiben!«, brummte ich. Doch der Gedanke an die Firma, an mein Büro, das ich samt kaputtem Familienbild einfach so zurückgelassen hatte, an die kleine Kantine und die Flure, auf denen mir Mitarbeiter begegnen würden, die vielleicht schon seit Längerem von Marcels Affäre wussten, senkte sich wie ein Bleigewicht auf meine Eingeweide.
»Wiebke«, sagte ich in plötzlichem Begreifen, »ich glaub, ich kann da überhaupt nie wieder hingehen. Ich meine, ich kann da noch nicht weiterarbeiten. Tür an Tür mit Marcel und seiner Neuen samt Babybauch.«
»Denk da jetzt erst mal nicht dran!«, meinte Wiebke entschieden. »Darüber reden wir, wenn du hier bist. Uns fällt bestimmt was ein.«
»Wenn ich …?«, wiederholte ich.
«Na, ist doch wohl klar, dass du erst mal zu uns kommst!«, sagte die beste Freundin der Welt mit fester Stimme, die keinen Widerspruch duldete. »Morgen früh fährst du ins Haus, packst zwei Koffer mit deinen liebsten Sachen und kommst rauf!«
Als ich später das Licht löschte und im Dunkeln diesem Tag nachspürte, an dem sich mein ganzes bisheriges Leben geändert hatte, waren es nicht Marcels betretene Miene oder der fliegende Briefbeschwerer, nicht die von angeblichen Freunden am Telefon gemurmelten Entschuldigungen, die den ersten Platz in meinen Gedanken und in meinem Herzen einnahmen. Sondern es waren diese Worte meiner Freundin auf Usedom, die mich einluden und auffingen. Als würde auf der Insel noch mehr auf mich warten als nur ein Ort zum Ausruhen.
3. Kapitel
Am nächsten Morgen tat ich genau das, was Wiebke mir geraten hatte: Ich fuhr in das Haus, in dem Marcel und ich seit unserer Hochzeit gemeinsam gewohnt hatten und das ich bis gestern noch für mein Zuhause gehalten hatte. Als ich die Tür aufschloss, horchte ich kurz hinein. Doch alles war still. Marcel war bestimmt wie üblich längst in der Firma. Als ich zwei Koffer und eine Reisetasche vom Dachboden kramte und den Kleiderschrank nach bequemen Klamotten durchwühlte, in denen ich mich auf der Insel zwischen Sonne, Wind und Meer wohlfühlen würde, ging es mir langsam ein wenig besser.
Das Frühstück mit meinen Eltern war eine kleine emotionale Katastrophe gewesen. Ich wusste ja, dass sie es nur gut meinten. Doch meine Mutter hatte mich wie ein weidwundes Reh beobachtet, und mein Vater hatte zwischen Kaffee und Tageszeitungs-Kreuzworträtsel ständig Bemerkungen wie »Der wird schon wieder schlau! Wart’s nur ab. Nicht lange, und der kommt wieder angekrochen!« hinausgeschmettert.
Ich hatte sie von Herzen lieb und spürte, dass es ihnen ebenso ging. Doch aus dem Alter, in dem sie mir bei meinen Problemen helfen konnten, war ich schon mit siebzehn herausgewachsen.
Und so war ich erleichtert, mich mit dem Packen von meinen zermürbenden Gedanken rund um Marcel und die schwangere Tatjana ablenken zu können. Zwei, drei dicke Pullover wanderten ebenso ins Gepäck wie die Regenjacke und der Südwester, den ich ausschließlich bei meinen Wiebke-Besuchen auf Usedom trug. Aber auch jede Menge T-Shirts waren mit von der Partie, meine Wanderstiefel, Turnschuhe und sogar eine kurze Hose. Es war zwar erst Ende April, aber von meinen vielen Urlauben auf der Insel wusste ich, dass das Wetter dort unberechenbar war – Sturm und Regen ebenso wie der plötzlich hervorbrechende Sonnenschein.
Als ich auch meine Zahnbürste und ein paar Kosmetiksachen zusammengeräumt und im Koffer verstaut hatte, sah ich mich noch einmal gründlich um. Das Bett war gemacht. Aber ich widerstand der Versuchung, mit der Hand unter die Decke zu fahren, um dort eventuell noch dem letzten Rest Wärme nachzuspüren, den Marcel dort hinterlassen haben könnte. Viel zu groß war die Angst davor, dass ich zwischen den Laken nur kühles Nichts finden würde, und die Gewissheit, dass er die letzte Nacht bei seiner Geliebten verbracht hatte.
Mein Herz zog sich bei dem Gedanken zusammen.
Vor der auf antik gemachten Schiefertafel im Flur zögerte ich. Hier hatten wir uns immer gern kleine Nachrichten hinterlassen. Mir kam die Idee, einfach ohne ein Wort aufzubrechen und Marcel in der Ungewissheit zurückzulassen, wohin ich gegangen war.
Doch nachdem ich mich einen Moment in dieser Vorstellung gesonnt, mir seine Sorge und sein Schuldbewusstsein ausgemalt hatte, wurde mir klar, dass er innerhalb von Sekunden auf die Lösung kommen würde.
Also griff ich nach der Kreide und schrieb: »Bin bei Wiebke.« Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.
♥
Ich hatte die Fahrt nach Usedom immer geliebt.
Marcel hatte das nicht verstanden, sondern stets nur von den Staus und Baustellen und der endlosen Fahrt gesprochen. Doch das war mir alles egal gewesen. Die vertraute Strecke bedeutete für mich: Die Reise in meine ganz persönliche Auszeit. Nachmittage am Strand. Gemeinsames Gelächter mit der besten Freundin. Wind in den Haaren und Salzwasser auf der Haut.
Auch heute flog draußen die Landschaft vorbei, und ich fühlte mich, als würde ich Stück für Stück abstreifen und hinter mir lassen, was passiert war. Der Schock über Marcels Eröffnung. Die Gewissheit des monatelangen Betruges. Die Demütigung durch Lüge und Hintergehen.
Und wie um mir zu zeigen, dass ich mit meiner Flucht hierher die richtige Entscheidung getroffen hatte, brach die Wolkendecke plötzlich auf, als ich bei Wolgast auf die Insel fuhr. Ein gebündelter, gleißender Sonnenstrahl fiel direkt vor mir auf die Straße, und als ich hindurchfuhr, musste ich lächeln.
Nach Trassenheide war es von hier aus nicht mehr weit. Und die Fahrt über die Insel war ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich sauste an den Feldern vorbei, lächelte über die im Ruhrgebiet nirgends vorkommenden Vorsicht! Otter-Wechsel!-Schilder und staunte über einen Schwarm Kraniche. Mit heruntergelassener Scheibe schnupperte ich die Inselluft, stets vermischt mit dem Freiheit verheißenden Geruch des Meeres.
Die Straße in Trassenheide, in der Wiebke und ihre Familie wohnten, war mir vertraut wie meine Westentasche. Wiebke hatte mich offenbar erwartet und stürzte aus dem kleinen Ziegelhaus, kaum, dass ich in der Einfahrt gehalten hatte. Als Teenager war sie spindeldürr gewesen, mit wehenden Spaghettihaaren und Sommersprossen rund um die Nase. Letztere waren immer noch da. Doch ihre Haare trug sie jetzt in einer witzig strubbeligen Muss-schnell-gehen-bin-dreifache-Mutter-Kurzhaarfrisur, und jede der Schwangerschaften hatte ein paar Kilo auf ihren Hüften hinterlassen – was ihrem Schwung jedoch keinen Abbruch tat.
»Moin, Ostseekrabbe!«, bekam ich gerade noch raus, bevor sie die Arme um mich warf und mich an sich drückte.
»Meine Ruhrischnecke!«, grinste sie, als sie mich daraufhin auf Armeslänge von sich schob und prüfend ansah.
»Bist du krank, Lara?«, erklang da hinter Wiebke eine helle Stimme. Es war der neunjährige Lasse, der dort herumzappelte.
»Wie kommst du darauf, Seemann?«, fragte ich.
»Mama hat gesagt, du musst zu uns ins Pflege-Gehege. Und so wie sie dich jetzt anguckt, guckt sie mich immer an, wenn ich Halsweh hab und trotzdem an den Strand zum Spielen will«, erklärte der Junge.
»Lasse, davon verstehst du noch nichts«, raunzte Wiebke ihren Jüngsten an. »Jetzt schnapp dir die Tasche hier und bring sie rauf in Inkens Zimmer.«
Sie selbst und ich nahmen jeweils einen der Koffer und trugen sie hinein.
»Hab ich das richtig gehört? Inkens Zimmer?«, erkundigte ich mich vorsichtig.
»Ja, klar«, sagte Wiebke. »Du brauchst einen Raum für dich. Wenn du länger bleibst, kannst du doch nicht auf dem Sofa im Wohnzimmer schlafen, so wie sonst immer.«
Wir ließen die Koffer im Flur stehen und gingen weiter in die gemütliche Wohnküche, wo die Teenagerabteilung, Wiebkes älterer Sohn Sönke und ihre Tochter Inken, gerade dabei war, sich um die Aufteilung ihrer Haushaltspflichten zu streiten.
»Ich wasch den Salat und putze die Möhren, du schälst die Kartoffeln und räumst hinterher das Geschirr in die Spülmaschine«, kommandierte die fünfzehnjährige Inken ihren drei Jahre jüngeren Bruder herum. »So war es abgesprochen. War es doch, oder Mama? Moin, Lara!«
»Moin, ihr zwei!«, nickte ich den beiden zu.
Katze Minka, die entspannt auf der gepolsterten Eckbank gelegen hatte, sah mich, erschrak und stürmte mit gesträubtem Fell davon. Das kannte ich schon. Spätestens übermorgen würde sie schnurrend auf meinem Schoß liegen. Ich fragte mich nur, wieso wir das anstrengende Ritual der Annäherung bei jedem Besuch aufs Neue durchmachen mussten.
Sönke winkte kurz, wandte sich aber dann sofort wieder an Wiebke: »Wieso muss ich die ganzen blöden Aufgaben machen? Kartoffeln schälen und Abräumen? Das ist doch voll unfair!«, beschwerte er sich.
»Entschuldige mal«, bemerkte Inken patzig. »Komm mir bloß nicht mit ›unfair‹! Wer von uns muss denn jetzt auf dem Sofa …«
»Inken!«, zischte Wiebke. Ihre Tochter verstummte gehorsam. Doch ich hatte genug gehört.
»Moment!«, sagte ich und hob die Hände. »Geht es hier etwa darum, dass ich in dein Zimmer ziehen soll, Inken?«
»Das ist vollkommen in Ordnung für sie!«, knurrte Wiebke und warf Inken einen scharfen Blick zu.
Inken zog in ihre Richtung eine Grimasse, doch das Lächeln, das sie mir schenkte, war echt. »Geht schon klar, Lara. Weil du das bist. Aber Sönke muss dafür …«
»Wenn ich das aber gar nicht möchte?«, unterbrach ich sie.
»Lara …«, begann Wiebke.
»Nein!«, sagte ich. Und etwas leiser: »Bitte. Ich komm wirklich gut klar mit dem Schlafsofa. Wir kennen uns doch.« Ich zwinkerte den Kindern zu. Sönke grinste. Und auf Inkens Gesicht zeichnete sich etwas ab, das einer verhaltenen Hoffnung glich.
An Wiebke gewandt setzte ich hinzu: »Weißt du etwa nicht mehr, wie das ist, wenn man Teenager ist und sein eigenes Reich haben will, Ostseekrabbe?«
Die kleine Erinnerung an unsere Anfangszeit, zu der sie sich oft darüber beklagt hatte, mit ihrer älteren Schwester ein Zimmer teilen zu müssen, half offenbar.
»Na gut«, brummte Wiebke schließlich.
»Cool, Lara«, lächelte Inken, war aber schlau genug, ihrer Freude nicht zu temperamentvoll Ausdruck zu verleihen. Sie erinnerte mich oft an Wiebke in diesem Alter. Auf jeden Fall hatte sie extrem feine Antennen für die Befindlichkeiten ihrer Mutter und deren bester Freundin. »Wie geht’s dir denn? Ich mein …?«
»Seit ich auf Usedom bin, wunderbar!«, strahlte ich, um sie zu beruhigen, setzte dann aber rasch hinzu: »Allerdings habe ich noch eine Bedingung.«
»Bedingung?«, echoten alle drei.
»Ja, dafür, dass ihr mich hier bei euch aufnehmen dürft«, erklärte ich und machte ein paar schnelle Schritte zu Sönke hinüber. Ich griff den Sparschäler von der Arbeitsfläche. »Ich bin für Kartoffelschälen und Spülmaschine einräumen zuständig. Denn das sind zufällig die Sachen im Haushalt, die ich wirklich liebe.«
»Echt jetzt?«, ächzte Sönke.
»Das brauchst du doch nicht …«, begann Wiebke. Doch ich hielt das Messer in die Höhe. Und dann deutete ich auf meine Koffer im Flur.
»Alles klar«, grinste sie. »Dann herzlich willkommen bei den Petersens!«
♥
Der Abend bei Wiebke und ihrer Familie unterschied sich so grundlegend vom vorangegangenen bei meinen Eltern, dass ich mir absolut sicher war, mit meiner überstürzten Reise hierher genau das Richtige getan zu haben.
Als Ole von der Arbeit nach Hause kam, drückte er mich an seine breite Brust und murmelte etwas davon, dass Marcel ein »verdammter Idiot« sei und dass ich bei ihnen bleiben könne, solange ich wolle. Mehr sagte er nicht zu meiner Situation.
Und das war auch nicht notwendig. Dass es für ihn selbstverständlich war, dass seine Frau ihre frisch verlassene beste Freundin einfach so auf unbestimmte Zeit bei ihnen einquartierte, sagte mehr als tausend Worte.
Den Kindern war die Freude über meinen unverhofften »Besuch« anzumerken. Und so verbrachten wir ein lustiges Abendessen, bei dem ich es genoss, über die Familie-Petersen-üblichen Scherze zu lachen.
Nur hin und wieder überkam mich mit einem Mal das Gefühl, gar nicht wirklich in meiner Haut zu stecken. Es kam mir vor, als würde ich mich von außen betrachten, wie ich hier mit dieser reizenden Familie zusammensaß. Es war, als würde ich mich an all die vorangegangenen Besuche hier erinnern, bei denen ich mich ebenso willkommen gefühlt hatte. Bei denen jedoch etwas Maßgebliches anders gewesen war: Auch wenn ich für ein paar Tage und Abende mit ihnen ihr Heim geteilt und sie mich in ihre Familie aufgenommen hatten, war mir doch immer bewusst gewesen, dass auch ich selbst ein Zuhause besaß. Ein gemütliches Haus, einen liebenden Ehemann, eine erfüllende Arbeit, die daheim auf mich warteten.
Das war diesmal nicht der Fall.
Und das fühlte sich seltsam falsch und irreal an.
♥
Später, als Ole mit den Kindern in einem der Kinderzimmer Karten spielte, machten Wiebke und ich uns im Wohnzimmer breit und sprachen bei einer Kanne Tee über alles, was nun getan werden musste.
Und da war sie wieder mit voller Wucht präsent: meine komplett veränderte Lebenssituation, in der plötzlich Schlagworte wie Anwalt, Verlust der Arbeitsstelle und Kampf um das gemeinsame Haus oder auch der Umzug in eine eigene Wohnung im Mittelpunkt standen und mir damit deutlich machten, dass ich dieses Mal nicht für einen entspannenden Urlaub auf der Insel war.
Als wir gemeinsam eine Liste aller notwendigen Erledigungen, Anrufe und Fragestellungen erstellt hatten, wie es für die Familienmanagerin Wiebke typisch war, saßen wir eine Weile einfach nur da und starrten auf das bekritzelte Blatt Papier.
»Wie konnte mir das nur passieren?«, hörte ich mich plötzlich fragen. »Warum habe ich nichts gemerkt?«
Wiebke, die dicht neben mir saß, griff nach meiner Hand und hielt sie in ihrer. »Hattest du denn gar keine Ahnung? Ich meine, ist dir nie irgendetwas aufgefallen in der letzten Zeit? Noch längere Arbeitszeiten? Sich häufende Ausflüge des Tennisklubs? Lippenstift am Hemd? Parfüm?«
Ich dachte über ihre Beispiele nach, doch schließlich schüttelte ich den Kopf. »Nichts. Oh mein Gott, Wiebke, meinst du, ich bin eine derart grässliche Ehefrau, dass ich es nicht mal merke, wenn mein Mann mich mit der Sekretärin betrügt?« Ich wollte schlucken. Doch der Kloß in meinem Hals hinderte mich daran.
»Du hast geliebt. Und vertraut«, sagte Wiebke leise. »Ich finde, es zeigt nur, was für ein guter Mensch und was für eine tolle Ehefrau du bist, wenn du keinen blassen Schimmer hattest.«
Sie war wirklich die beste Freundin der Welt, dass sie das so sah.
»Meinst du, dir könnte das auch passieren?«, erkundigte ich mich vorsichtig.
»Mir?«, wiederholte Wiebke skeptisch. »Mrs Kontrolletti? Der Frau, die permanent darauf achten muss, dass ihre Teenagertochter nicht die Schule schwänzt, weil sie es für cool hält? Darauf, dass keines der Kinder zu spät zu einem seiner diversen Kurse oder Sportangebote kommt, dass ihr Mann seine Pullover nicht auf links anzieht, dass alle Rechnungen der Fälligkeit nach sortiert und bezahlt werden, dass immer ausreichend Essen im Kühlschrank ist, dass für den Laden sämtliche Bestellungen pünktlich rausgehen …« Sie brach ab und wandte sich mir mit großen Augen zu. »Ach, du Schreck. Ich klinge wie eine, die sich nicht eine Sekunde entspannen kann, richtig?«
Bei ihrem entsetzten Gesichtsausdruck wusste ich nicht recht, ob ich lachen oder weinen sollte.
»Du klingst wie eine, die jeden Betrug auf Seemeilen im Voraus wittern und der deswegen so was nie im Leben passieren würde«, sagte ich schließlich. Und die Erkenntnis traf mich wie ein Schlag: »Wer weiß, vielleicht hätte ich meine Ehe noch retten können, wenn ich früh genug mitbekommen hätte, was da läuft?«
Wiebke setzte sich aufrechter hin und fasste meine Hand so fest, dass es fast schmerzte. »Lara«, sagte sie. »Du bist ein grandioser Mensch. Und eine der Sachen, die ich an dir wirklich schätze, ist deine Fähigkeiten, in jedem Konflikt auch deinen Anteil daran zu suchen. Aber das hier ist was anderes. Und wenn ich noch einmal höre, wie du dir tatsächlich selbst die Schuld an Marcels körbchengrößengesteuertem Fehltritt mit Folgen gibst, bekommen wir zwei unseren ersten handfesten Streit. Klar?«
Manchmal sind beste Freundinnen einfach durch nichts zu ersetzen.
4. Kapitel
Ich zog den Schal noch ein wenig enger um den Hals, stopfte ihn zurück in den Kragen meiner Jacke und stapfte durch den Sand der Dünen. Obwohl der soeben angebrochene Mai uns derzeit schon jede Menge warmer Tage und Sonnenschein bescherte, war es morgens am Wasser immer noch empfindlich frisch. Das Meer wirkte eisig grau, und die kleinen Wellen, die an den Strand rollten, hinterließen weißen Schaum.
Die Möwen schien das nicht zu stören. Sie kreischten über den Wellen, hüpften nach Futter suchend am Wasser herum oder schaukelten weiter draußen bei schwachem Seegang. Ihr Rufen und ihre halsbrecherischen Flugmanöver faszinierten mich auch nach so vielen Jahren immer noch. Vielleicht auch, weil man sie im Ruhrgebiet nur an den großen Stauseen zu sehen bekam.
In den letzten Tagen hatte ich mir angewöhnt, morgens einen Spaziergang am Strand zu machen. Irgendwie tat es mir gut, wenn der Wind meine Haare zerzauste und die vor Gischt feuchte Luft sich auf meine Haut legte.
Eine Woche war vergangen, seit ich auf Usedom angekommen war. Eine Woche, in der ich damit beschäftigt gewesen war, eine Trennung zu organisieren, die ich gar nicht gewollt und schon gar nicht geplant hatte. Die Telefonate mit unserem Anwalt im Ruhrgebiet waren anstrengend gewesen. Aber nichts im Vergleich zu den Gesprächen, die ich mit Marcel hatte führen müssen. Die Stimmung meines Noch-Ehemannes schwankte nämlich derart, als wäre in Wahrheit er derjenige, der von Schwangerschaftshormonen durcheinandergebracht würde, und nicht die vollbusige Tatjana. Mal erging er sich in Selbstvorwürfen und Entschuldigungen. Dann wieder brodelte in ihm kindlich anmutender Trotz, als wäre sein Fremdgehen meine Schuld gewesen. Als hätte ich allein unsere Kinderlosigkeit entschieden und ihn damit in die Arme einer jüngeren Frau und willigen Mutter getrieben. Beim nächsten Gespräch schien er dann wieder geradezu besorgt und fragte sich laut, was denn nun »mit mir werden« würde.
Er hatte tatsächlich versucht, mich davon zu überzeugen, dass es doch bestimmt machbar sei, dass ich weiterhin in unserer Firma PUTZmunter meiner gewohnten Arbeit würde nachgehen können. Tatjana sei ja sowieso bald in Mutterschutz. Und so wie es klang, freute sie sich jetzt schon darauf, dann in ihrer Mutterrolle ganz aufzugehen. Sprich, sie dachte nicht daran, wieder arbeiten zu gehen, wenn das Kind erst mal da sein würde.
Bei der Klärung dieser Frage brauchte ich noch nicht einmal den Blick meiner zornesbebenden Freundin Wiebke, um sehr klar und deutlich zu formulieren, dass das für mich nicht infrage kam. Na ja, ich drückte es ein bisschen anders aus. So anders, dass Marcel sich seit diesem letzten Telefonat vor zwei Tagen nicht mehr gemeldet hat.
Ich sah aufs Meer hinaus. Am Horizont zog ein großes Schiff vorüber. Wo immer seine Reise auch hinging, ich konnte nur hoffen, dass Kapitän und Steuerfrau besser wussten, wohin sie unterwegs waren, als ich im Moment.
Schon ab dem zweiten Tag meines Aufenthaltes hier hatte ich die Ruhrgebiets-Stellenangebote im Netz durchkämmt. Es gab durchaus ein paar, die mir interessant erschienen – doch die Zeit, in der ich Bewerbungen hatte schreiben müssen, war so lange her, dass es mir vorkam wie ein anderes Leben. Was es ja im Grunde auch tatsächlich war. Daher schreckte ich noch ein wenig davor zurück.
Wiebke fand, ich solle mir doch ruhig Zeit lassen: »Das Mindeste, was er jetzt tun kann, ist doch, für dich aufzukommen, solange du keine neue Arbeit gefunden hast. Nimm dir doch erst mal eine Auszeit. Entspann dich. Mach was Schönes. Und lass ihn gefälligst dafür bezahlen!«, hatte sie gestern Abend noch gewettert.
Natürlich hatte sie recht. Marcel und ich waren gerade mal seit einer Woche getrennt. Ich sollte wirklich nichts überstürzen. In unserem ersten Telefonat, das ich mit ihm von Usedom aus geführt hatte, hatte er angeboten, die nächsten Monate komplett für mich aufzukommen. Doch irgendwie fühlte sich diese Vorstellung nicht richtig an. Auch in unserer Ehe war es mir immer wichtig gewesen, selbst Geld zu verdienen und finanziell zumindest theoretisch unabhängig zu sein. Mich von meinem Mann einfach nur versorgen zu lassen, war mir zuwider gewesen. Und damit würde ich jetzt, nach meiner Ehe, auch nicht mehr anfangen.
Herrje, das waren ja nicht gerade fröhliche Gedanken am Morgen.
Fröstelnd bog ich beim nächsten Pfad ab. Mitten in den Dünen, umgeben von sich wiegendem Strandhafer und mit Blick aufs Meer, hockte ein Häuschen, eine alte Fischerkate. Das kleine Gebäude kannte ich noch aus unseren Jugendtagen. Doch mittlerweile war sein ehemals verwittertes Holz leuchtend weiß und blau gestrichen, und eine Veranda war angebaut worden. Ein schmaler Weg aus dicken Bohlen führte einladend hinüber. Über der Tür war ein Schild mit der Aufschrift STRANDBAR angebracht. Das wirkte sehr urig, und ich hätte gerne einen Blick hineingeworfen, doch die Bar war natürlich um diese frühe Uhrzeit geschlossen. Ich nahm mir vor, ihr demnächst mal einen Besuch abzustatten – auf ein frisch gezapftes Bier. Oje, war es schon so weit mit mir? Alkohol gehörte normalerweise nicht zu den Mitteln, mit denen ich mich tröstete.
Weil ich offenbar dringend einer Aufmunterung bedurfte, wählte ich einen kleinen Umweg durch das angrenzende Waldstück und freute mich an dem einsetzenden Konzert der Vögel, die in den Kiefern und Eichen herumturnten. Das war auch so etwas, das ich an Usedom von Anfang an geliebt hatte: Es war die Insel mit dem größten Baumbestand in ganz Deutschland. Weil ich Bäume liebte, hatten mir die Familienurlaube an der Nordsee in meiner Kindheit nie zugesagt. Die kleinen, verkrüppelten Bäumchen, die sich dort wacker gegen die steife Brise stemmten, hatten mich schon damals eher depressiv gestimmt. Hier auf Usedom aber gab es große, bewaldete Flächen, auf denen ich es liebte, spazieren zu gehen.
Das Piepen, Pfeifen und Singen um mich herum verbreitete einfach gute Laune. Hier war der Frühling deutlich zu spüren, sodass ich schließlich mit einem leisen Lächeln auf den Lippen aus dem Wald trat und die Straße zum kleinen, aber gut sortierten Supermarkt hinüberging.
Wiebke führte in ihrem Laden auf dem Campingplatz wirklich allerhand. Doch als ich sie für das für heute Abend geplante Curry-Gericht nach den entsprechenden Gewürzen gefragt hatte, hatte sie passen müssen und mich zu dem kleinen, inhabergeführten Laden geschickt, den einer ihrer Freunde betrieb.
So hatte mein morgendlicher Spaziergang nicht nur den Zweck, meinen Kopf freizupusten, sondern außerdem ein sinnvolles Ziel.
Vor der Tür des Ladens hatte jemand einen kleinen braunen Hund abgesetzt, der mich frech anglotzte. Weil so früh am Tag sonst kaum jemand unterwegs war, betrachtete ich ihn im Näherkommen genauer. Er hatte rotbraunes, leicht struppiges Fell und Schlappohren. Die schwarze Nase zuckte im Wind, während er mich ebenso intensiv musterte wie ich ihn. Als ich mich näherte, konnte ich auch den Ausdruck auf dem haarigen Gesicht besser erkennen. Und der lag irgendwo zwischen Neugier und … Angriffslust? In diesem Moment fiel mir außerdem auf, dass er gar nicht angebunden war. Er saß ganz ohne Leine und Halsband einfach so da. Ich verlangsamte meine Schritte.
Der Hund hob die Ohren ein Stückchen an.
Hm. Wartete das Tier dort vor der Ladentür womöglich gar nicht auf Herrchen oder Frauchen? Vielleicht war es ein Streuner, der sich hier strategisch günstig positioniert hatte, um die ersten Touristen der Saison in ihre Schranken zu weisen? Ich blieb stehen.
Der Hund erhob sich.
Aha! Hatte ich es also richtig gedeutet! Er machte sich offenbar für einen Angriff startklar.
Ich sah die kleine Straße hinauf und hinunter. Doch es war niemand in Sicht. Auch durch die große Schaufensterscheibe des Supermarktes konnte ich weder frühe Kunden noch den Besitzer Gustav ausmachen.
Der Hund und ich sahen uns an.
Ich tat einen Schritt vor.
Der Hund legte den Kopf schief.
Ich blieb wieder stehen.
Waren Hundebisse nicht irrsinnig gefährlich? Konnte man sich dabei nicht Tollwut und dergleichen holen? Vielleicht wäre es besser, wenn ich den Weg des Klügeren wählen und einfach später noch einmal wiederkommen würde?
Ich tat einen Schritt zurück.
Der Hund tat einen Schritt vor.
Au Scheiße. Und jetzt? Wegrennen kam gar nicht infrage. Auf seinen vier Pfoten wäre mein Verfolger auf jeden Fall schneller als ich, auch wenn er viel kleiner war. Vielleicht würde die Einschüchterungstaktik funktionieren?
Ich ging wieder einen Schritt nach vorne, diesmal einen großen.
Der Hund ging zwei Schritte zurück.
Wow! Das klappte tatsächlich!
Mutig geworden tat ich einen weiteren großen Schritt. Mit dem gleichen Erfolg. So einfach war das also: Ich musste nur ausreichend Selbstbewusstsein und Kampfbereitschaft ausstrahlen, dann würde er mir den Weg zum Currygewürz freimachen.
Noch ein Schritt. Und noch ein Schritt.
In diesem Moment wurde die Ladentür von innen geöffnet, und ein Mann trat heraus. Er war groß und schlank, und sein dunkelblondes Haar stand ihm wirr vom Kopf ab. Er trug einen Jogginganzug, Marke Beim-Joggen-sieht-mich-ja-eh-keiner, und unter dem Arm eine Brötchentüte.
«Guten Morgen«, sagte er. Sein ganzes Gesicht, nein, sein ganzer Körper fragte jedoch noch: »Was um Himmels Willen machen Sie da?« Er sprach es nur nicht aus.
»Seien Sie vorsichtig«, antwortete ich deswegen auf seine unausgesprochene Frage. »Könnte sein, dass der Hund da gefährlich ist.«
Der Fremde, wahrscheinlich etwa in meinem Alter, mit markanten Wangenknochen und blitzenden Augen, sah von mir zu dem Vierbeiner und wieder zurück.
»Dieser Hund da?«, erkundigte er sich. Und obwohl kein anderes Tier weit und breit in Sicht war, zeigte er auch noch drauf.
»Genau der!«, nickte ich.
Hund und Mann sahen sich an.
»Achtung!«, warnte ich ihn. »Ich hab mal gelesen, dass Blickkontakt sie noch aggressiver macht.«
Doch anstatt auf den Jogger loszugehen, begann der kleine Hund plötzlich, mit dem Schwanz zu wedeln.
»Na toll«, rutschte es mir raus. »Bei mir erst einen auf Aufpasser-Hund machen und dann so was. Ich schwöre Ihnen, der wollte mich gerade noch anfallen. Wie der mir schon entgegengeguckt hat. So was hat man doch im Gefühl, oder?« Plötzlich musste ich lachen. »Sie müssen mich ja für eine völlig hysterische Irre halten.«
Der Fremde sah mich kurz an.
Um seine im Grunde sehr sympathischen Augen herum befand sich ein Kranz von Lachfältchen. Allerdings fragte ich mich spontan, woher er die wohl hatte, denn von einem Lachen war keine Spur zu sehen.
»Tja, dann …«, sagte er und macht mir den Weg zur Tür frei. »Danke für die Warnung.«
Damit ging er an mir vorbei. Und nach wenigen Metern fiel er in einen sportlichen Joggertrab. Der Hund warf mir einen letzten, irgendwie vernichtenden Blick zu und galoppierte ihm nach.
Mir dämmerte, dass die beiden wohl zusammengehörten. Ach herrje, da hatte ich mich ja gründlich blamiert. Aber wie konnte man auch so stoffelig sein und dermaßen mit seinem Humor hinterm Berg halten?
Ich blickte dem davontrabenden Kerl und seiner Bestie noch einen Augenblick nach. Doch dann schüttelte ich den Kopf und ging in den Laden.
5. Kapitel
Zehn Tage war ich nun schon auf Usedom. Und langsam machte sich zusammen mit dem Mai der Frühsommer breit auf Usedom.
Wiebke hatte nun jeden Tag von morgens bis abends in ihrem kleinen Laden zu tun, denn immer mehr Touristen trudelten mit Wohnwagen, Wohnmobilen und Zelten auf der Insel ein. Bald schon würde der Campingplatz, wie immer in den Sommermonaten, aus allen Nähten platzen vor urlaubsreifen Meeres- und Strandsüchtigen.
Vormittags half ich meiner Freundin daher gern im Laden. Nachmittags oder am frühen Abend unternahm ich häufig etwas mit Sönke, Lasse und Inken. Wir gingen ins Kino, zur Skaterbahn im Kurpark oder stürmten die Eisdiele. Ich kannte die drei seit ihrer Geburt, und sie waren mir so vertraut, dass ich sie noch nie mit den Augen einer kinderlosen Frau betrachtet hatte. Aber genau das passierte mir nun hin und wieder.
»Weißt du noch, als wir Teenies waren und du immer davon gesprochen hast, dass du später mal sechs Kinder möchtest?«, erinnerte ich Wiebke, als wir eines Morgens in ihrem kleinen Laden am Campingplatz standen und neue Ware in die Regale sortierten. Ich war ganz scharf darauf, ihr bei solchen Erledigungen zu helfen. So hatte ich zumindest ein bisschen das Gefühl, ihr für ihre Gastfreundschaft etwas zurückgeben zu können.
Wiebke hielt kurz inne, ein Paket Zucker in der Hand, und schien in der Vergangenheit versunken. Dann schüttelte sie sich plötzlich am ganzen Körper. »Und das Schlimmste ist: Ich hab’s auch so gemeint!«, grinste sie.
»Ach komm schon«, erwiderte ich neckend. »Tu nicht so. Du bist ein solcher Kinderfan, dass du weitergemacht hättest, wäre Lasses Geburt nicht so schwierig gewesen.«
»Ein Wink des Schicksals«, meinte Wiebke schmunzelnd. »Nein, wirklich, drei reichen voll und ganz. Keine Ahnung, wo ich die Energie für doppelt so viele hernehmen wollte.«
Ich öffnete einen weiteren Karton, der mit Konserven gefüllt war. »Und wenn es nicht geklappt hätte?«, fragte ich sie, plötzlich ernst.
»Du meinst, wenn wir nicht …?«
»Wenn es einfach nicht hingehauen hätte mit eurer kleinen Kinderschar, ja.«
Wiebke schielte zu mir herüber. Sie kannte mich so gut. »Weht der Wind wieder aus dem Ruhrpott? Kann es sein, dass du dich mal wieder in Marcel einfühlen willst?«
»Nein, nein«, beteuerte ich. »Diesmal geht’s wirklich nur um mich. Ich wüsste nämlich gern, ob ich … na ja, ob ich eine gute Mutter geworden wäre? Weißt du, ich frage mich, ob ich diese gewaltige Verantwortung hätte tragen können.«
Wiebke schnaubte. »Natürlich hättest du das! Schließlich hast du in der Firma deiner Schwiegereltern eine ganze Abteilung geleitet. Es ist auch überaus verantwortungsvoll, sich um neue Aufträge für einen ganzen Betrieb zu kümmern und …«
»Das ist nicht dasselbe«, unterbrach ich sie. »Neue Aufträge, auch wenn sie viel Geld einbringen, stehen nicht nachts an deinem Bett und kotzen auf dein Kissen. Sie brechen sich beim Skaten nicht den Arm und brauchen keine Einweisung in Sachen Verhütung – sie verlieben sich nämlich nicht in andere pubertierende Aufträge.« Damit hatte ich nur die letzten kleineren Aufgaben aufgezählt, die Wiebke in ihrer Mutterpflicht zu erledigen hatte. »Ich meine die Verantwortung für etwas Lebendiges. Für einen anderen Menschen. Ich hab ja noch nicht mal ein Haustier«, seufzte ich.
»Du könntest Minka haben«, schlug Wiebke scherzhaft vor. Doch dann wurde sie wieder ernst. »Warum zerbrichst du dir darüber jetzt den Kopf? Was macht es für einen Unterschied, ob du eine gute Mutter geworden wärest oder nicht? Du hast keine Kinder. Punkt. Marcel wird eins haben. Tatsache. Aber das heißt nicht, dass er ein besserer Ehepartner ist als du. Wozu also diese ganzen Gedanken?« Da war sie wieder, meine pragmatische Freundin, die es überflüssig fand, sich wegen Dingen zu grämen, die man eh nicht ändern konnte.
Ich holte tief Luft. »Keine Ahnung. Ich glaube, es hat mich einfach so erschüttert, als er sagte, wie sehr er sich immer Kinder gewünscht habe. Ehrlich, ich hatte davon keine Ahnung. Ja, sicher, früher haben wir mal darüber gesprochen. Da hat er sich dann ausgemalt, wie es später sein würde, wenn wir unsere Position in der Firma gefestigt und Zeit für Nachwuchs hätten. So in der Art: ›Mit unserem Jungen geh ich dann immer auf den Fußballplatz, aber auch in klassische Konzerte! Und unserem Mädchen bringe ich den Umgang mit Werkzeug bei, bastle mit ihr Laternen und all so was.‹ Aber in den letzten Jahren ist das nicht mehr zur Sprache gekommen. Mit keinem Wort. Ich hatte keinen blassen Schimmer, dass er unter unserer Kinderlosigkeit gelitten hat. Und jetzt frage ich mich natürlich, ob er es in voller Absicht verschwiegen hat oder ob wir …«
Es tat weh, das nur anzudeuten.
Wiebke nickte. »Ob ihr vielleicht gar nicht mehr richtig miteinander gesprochen habt?«
Ich senkte den Kopf. Denn im Grunde kannte ich die Antwort doch selbst. »Irgendwie war zwischen Firma und Freizeitgedöns mit unseren Freunden gar keine Zeit mehr nur für uns zwei«, gestand ich. »Solche gemeinsamen Unternehmungen oder intensiven Gespräche, wie du sie mit Ole hast, das gab es bei uns einfach nicht mehr. Dieses einfache und natürliche Miteinander zwischen euch – ihr seid wirklich zu beneiden. Aber das macht wahrscheinlich den Unterschied zu einer wirklich tiefen Liebe aus.«
»Wie bitte?«, quietschte Wiebke. »Drei Kinder aufzuziehen kann mindestens so beziehungszerstörend sein wie die Arbeit Seite an Seite in einem Familienbetrieb.« Wiebke hob die Hand. »Mach nicht so ein Gesicht, ich mein das ganz ernst. Als Lasse noch klein war, kam ich mir manchmal vor, als würden Ole und ich einfach nur in einer Art Wohngemeinschaft zusammenleben, einzig und allein mit dem Zweck, die Kinder so gut es geht aufzuziehen. In der Zeit haben wir beide unsere gemeinsamen Unternehmungen ganz schön vermisst. Romantische Candlelight-Dinner genauso wie unsere Segelausflüge oder endlose Kuschelabende, wilden Sex …« Sie brach ab und blickte kurz mit verklärter Miene vor sich hin. Dann grinste sie: »Wie gut, dass wir das alles wieder hinbekommen haben!«
Ihre Worte hallten eine ganze Zeit in meinem Kopf nach.
Wiebke spürte offenbar, dass in mir etwas Entscheidendes vorging, denn sie sagte nichts weiter. Nach einer Weile kam sie zu mir herüber und legte die Arme um mich. Ich ließ mich von ihr an ihre weiche Brust ziehen und vergrub mein Gesicht an ihrer Schulter, wobei ich mich ein bisschen bücken musste.
»Das ist es ja gerade, Wiebke«, murmelte ich an diesem sicheren Ort beklommen. »Ich fürchte, ich hab all das Schöne und Gemeinsame mit Marcel gar nicht vermisst.«
♥
An diesem Abend mailte ich meine erste Bewerbung an eine Firma in Essen. Die Stelle klang attraktiv. Und ich hoffte, sie würden es nicht so genau damit nehmen, dass ich in meine Aufgaben bei PUTZmunter über die Jahre einfach so hineingewachsen war – ohne vorzeigbare Zeugnisse von wertvollen Weiterbildungen.
Als ich die Bewerbung fertiggestellt hatte, versetze mich die Aussicht auf eine neue, eigene Zukunft in greifbarer Nähe derart in wunderbare Zuversicht, dass ich auf der Stelle noch einige weitere schrieb.
Das dadurch entstandene Hochgefühl hielt am nächsten Morgen immer noch an, und ich unternahm gut gelaunt meinen Spaziergang am Strand. Der Morgen war mild, und die Sonnenstrahlen wärmten bereits. Ich zog meine Schuhe und Socken aus, krempelte meine Jeans auf und lief durch den feuchten Sand. Während ich gegen die Sonne blinzelte, hörte ich plötzlich lautes Flügelschlagen. An der Wasserlinie entlang flog ein Schwanenpaar. Die großen Körper in vollendeter Harmonie nebeneinander, die weiten Schwingen im gleichen Rhythmus schlagend. Der Anblick erfüllte mich mit warmer Zuversicht.
Ganz beseelt davon ging ich zurück. Vor dem so vertrauten Haus der Familie Petersen traf ich die Postbotin.
»Bitte schön!« Sie streckte mir ein paar Briefe entgegen. »Ist auch was für Sie dabei, Frau Munter.«
Für mich? Wer soll mir schreiben, fragte ich mich verwundert.
»Danke!« Noch während ich auf die Haustür zuging, blätterte ich die Umschläge durch und fand meinen Namen. Der Absender war der unseres Familienanwalts.
Ich ging hinein und in die Küche der Familie Petersen. Hier konnte ich mich in Ruhe den Unterlagen widmen, denn die Kinder waren in der Schule, Wiebke im Campingplatzladen und Ole auf der Arbeit.
Ich las mehrmals das Anschreiben unseres Anwalts und die vielen Seiten der vorgeschlagenen Regelung zur Aufteilung unseres gemeinsamen Besitzes durch, machte mir Notizen, recherchierte zu der einen oder anderen Besitzfrage im Internet. Aber mein zukünftiger Exmann hatte scheinbar schon an alles gedacht und im Zweifelsfall einen Vorschlag zu meinen Gunsten gemacht.
Auch wenn ich gerne erneut wütend auf Marcel geworden wäre: In diesen Papieren fand ich nichts, was das hätte begründen können. Außer der Tatsache, dass es diese Papiere überhaupt gab. Am Ende unterschrieb ich überall, wo meine Unterschrift notwendig war.
Als ich die Blätter zurück in den Umschlag schob, dachte ich daran, mit welcher Hoffnung ich gestern Abend noch meine Bewerbungen auf den Weg gebracht hatte. Meine Zuversicht kam mir nun plötzlich vollkommen unbegründet vor. Bei den meisten meiner Schreiben würde ich Wochen oder gar Monate auf eine Antwort warten müssen. Eine furchtbar lange Zeit, die ich doch nicht einfach untätig auf Wiebkes Sofa verbringen konnte!