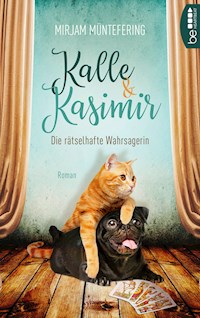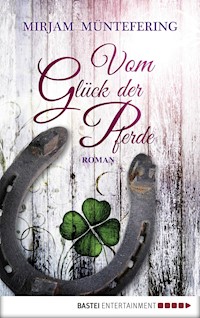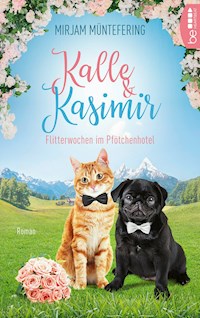16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ulrike Helmer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann man sich auf die Liebe einlassen, obwohl man Brustkrebs hat? Man kann, sagt sich Sascha nach einigem Zögern und stellt fest, dass es trotz Krankheit so vieles gibt, was sie intensiver leben lässt als je zuvor. Da ist das blühende Leben in ihrer Staudengärtnerei, da sind Zwilligsbruder Ben und die ganze Gärtnerfamilie, dazu die ruppige Corinna, und nicht zuletzt gibt es Robyn, die Leiterin der Selbsthilfegruppe… Liebe ist eben auch eine Frage von Mut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mirjam Müntefering
SONNENRÖSCHENWINTER
Roman
ISBN eBook 978-3-89741-960-5
ISBN Print 978-3-89741-418-1
© 2018 eBook nach der Originalausgabe
© 2018 Copyright Ulrike Helmer Verlag, Roßdorf b. Darmstadt
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Atelier KatarinaS / NL
unter Verwendung der Fotografie »Schwere Zeiten«,
© Copyright Soundso. / photocase.de
www.ulrike-helmer-verlag.de
Den sichren Freund erkennen wirin unsicherer Lage
Cicero
Für meine wahren Freundinnen und Freunde und jene Mitglieder meiner Familie, die mir beigestanden haben. Ihr habt mir Kraft gegeben.
Und für die starken Frauen, die ich in der Zeit der Chemo, den Zeiten der OPs und Rehas kennenlernte und die mein Leben bereichert haben. Iris, ein einziges Lächeln kann Freundschaft wecken. Sonja. Barbara. Gudrun. Monika. Claudia. Petra.
Besonders aber für unsre liebe Matz – mit all ihren Cockerchen im Arm auf der Alb. Und für Bettina, die wahrscheinlich mit ausgebreiteten Armen glücklich tanzt. Ich weiß, es geht Euch gut, wo immer Ihr jetzt seid.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Epilog
Nachwort
Prolog
Ich hatte immer geglaubt, die krasseste Zeit, um sich von Grund auf kompromisslos und inniglich zu verlieben, sei der Krieg.
»Es war vollkommen dunkel in der ganzen Stadt«, flüsterte Oma Inge.
Auch in unserem Kinderzimmer brannte nur ein Nachtlicht, weil meine sechsjährige Schwester Anett das noch dringend brauchte. Ich selbst war mit meinen zehn Jahren selbstverständlich schon darüber hinaus. Und mein Bruder Ben erst recht, auch wenn er bloß ein paar Minuten älter war als ich. Aber jetzt war ich froh um den kleinen Lichtschein, der von der lustigen Ente ausging, die auf Anetts Nachttischchen stand. Unsere kleine Schwester schlief schon, selig entschlummert bei der Bilderbuchgeschichte über zwei kleine Häschen, die Oma ihr vorgelesen hatte. Und immer wenn Anett eingeschlafen war, kam Bens und meine Zeit! Denn wir teilten beide die Leidenschaft für die wirklichen, die wahren Geschichten, die Oma zu erzählen hatte. Am liebsten die aus der Kriegszeit in Berlin, wo Opa Fritz und sie aufgewachsen waren.
»Ihr müsst euch vorstellen, dass es verboten war, nach Einbruch der Dunkelheit auf der Straße auch nur ein Streichholz anzuzünden«, raunte sie jetzt.
»Echt? Nicht mal ein Streichholz?«, staunte ich.
»Sonst hätten doch die Feinde in ihren Flugzeugen am Himmel gesehen, wo du bist, Dummi«, sagte Ben, der genau wie ich die Geschichte schon kannte, sich aber im Gegensatz zu mir an alle Details erinnern konnte. Ich selbst fieberte immer nur auf den Kern des Ganzen hin und genoss jede kleine Ausschmückung, bis wir ihn erreichen würden.
»Ganz richtig«, sagte Oma Inge nickend. »Die feindlichen Aufklärer kamen still und leise. Doch sie bedeuteten nie etwas Gutes. Ihnen folgten immer die Bomber. So auch damals in dieser einen gewissen Nacht …«
Wieder machte Oma eine kleine spannungssteigernde Pause und vergewisserte sich, dass Anett weiterhin schlief.
»Die Nacht, in der Opa ausnahmsweise nicht zum Meldedienst, sondern zum Brandschutz eingeteilt wurde?«, versuchte ich ihr auf die Sprünge zu helfen.
»Meldedienst stell ich mir echt krass vor«, murmelte Ben beeindruckt wie immer, wenn wir an diese Stelle kamen. »Mit so ner Binde um den Arm in den Straßen rumflitzen und Bescheid geben, wo ein Haus eingestürzt ist, in dem noch Menschen sind. Opa war der schnellste Melder von allen, oder?«
»Das war er!«, bestätigte Oma stolz. Opa Fritz glänzte heute noch im Sportverein mit seinen herausragenden Leistungen im Sprint und auf der Langstrecke. Beinahe täglich machte er seinen Waldlauf, wie man das Joggen früher noch nannte. »Und dabei waren wir nur wenig älter als ihr zwei jetzt. Dreizehn waren wir. Dreizehn Jahre jung …« Oma Inge versank kurz in ihren Erinnerungen. Das kannten wir. Ben und ich sahen uns an. Sein dunkelbrauner Blick traf meinen dunkelbraunen Blick. Seine braunen Locken fielen ihm in die Stirn, ebenso wie meine es bei mir taten. Bens Anblick war mir so vertraut wie mein eigenes Spiegelbild. Jetzt tauschte ich mit ihm ein verschwörerisches Lächeln.
»Warum sollte Opa Fritz an diesem einen Abend denn nicht beim Meldedienst mitmachen?«, fragte ich ein wenig scheinheilig. Natürlich kannte ich die Antwort. Doch Oma brauchte ihren üblichen Erzählfluss und da gehörte diese Frage einfach dazu.
»Er hatte sich tagsüber beim Herumbolzen mit den anderen Jungs zwischen den Schutthaufen den Fuß verletzt«, erklärte sie uns. »Deswegen wurde er zum Brandschutz auf unserem Dachboden eingeteilt, zusammen mit mir. Ihr müsst wissen: Die Bomber brachten ja nicht nur die zerstörerischen Explosionen, nein, sie warfen auch Brandsätze ab – mitten auf die Dächer der Häuserblocks.«
»Wie viele Häuser hatte denn euer Block in Berlin?«, wollte ich wissen.
Letztes Jahr waren wir mit der ganzen Familie in dieser großen Stadt gewesen. Wir hatten uns den Straßenzug angesehen, in dem Oma und Opa früher gewohnt hatten. Leider hatte ich versäumt, die Haustüren zu zählen. Der Block hatte aber aus so vielen aneinandergereihten Bauten bestanden, dass mir diese Häuserzeile wie eine eigene kleine Stadt erschienen war. Schließlich kannte ich nichts anderes als unser Zuhause in der ländlich anmutenden Stadt, in der wir lebten, etliche Autostunden entfernt von Berlin: die riesige Staudengärtnerei, das Erbe unserer Urgroßeltern, die Oma und Opa in den Fünfzigerjahren übernommen und mit viel Fleiß und Talent zu einem kleinen Imperium hatten gedeihen lassen. Auch ihr einziger Sohn, Papa, war genau wie wir hier aufgewachsen. Der grüne Daumen vererbte sich in unserer Sippe. Noch immer bewirtschaftete die Familie Herzog das gesamte Gelände. Doch auch eine sehr große Gärtnerei war kein Häuserblock. Hier gab es zwar das Wohnhaus mit ausreichend Platz für Oma, Opa, Mama, Papa und uns drei Kinder, aber der Rest des Geländes wurde von Pflanzen, Kompost, Erde, Kieswegen, Bäumen, Beeten dominiert. Dazu kamen die Gewächshäuser, der Packschuppen, die Winterquartiere für die Pflanzen, unzählige Verkaufsbeete und die durch Hecken geschützten Bereiche für die Mutterpflanzen.
Ich liebte unsere Gärtnerei ebenso wie unseren großen Garten, der ans Wohnhaus angrenzte, das viele Grün des Laubes, die bunten Farben der Blüten, der Geruch nach sonnenverwöhntem Boden, feuchter Erde, den Nebel am Morgen, den rotglühenden Horizont am Abend, wenn die Sonne hinter den umliegenden Hügeln verschwand. Doch mein Zuhause schien mir eher geruhsam, längst nicht so aufregend wie die Großstadt aus Omas Geschichten.
»Wie viele Häuser?« Oma Inge überlegte. »Lass es mal dreißig oder vierzig gewesen sein. Vielleicht auch ein paar mehr. Schließlich gab es nicht nur die an der Straße, sondern auch die Hinterhöfe. Und die vielen Häuser hingen alle zusammen. Die Kelleranlagen gingen oft nahtlos ineinander über. Genauso die Dachböden. Und das war genau das, worauf der Feind es abgesehen hatte …«
Ich kuschelte mich etwas tiefer in meine Decke, während Ben sich in seinem Bett aufrecht hinsetzte. Jetzt kam der spannende Teil.
»Stellt euch vor, wenn nur eine einzige Brandbombe das Dach eines dieser Häuser traf, dann breitete sich das Feuer rasend schnell aus. Das konnte das Ende für einen ganzen Block, für das Heim von hunderten von Menschen bedeuten. Deswegen war unser Einsatz auch so wichtig. Wir waren ausgerüstet mit Eimern und Wannen voller Wasser, Schrubbern und alten Lappen. Wenn irgendwo ein Brandsatz durchs Dach schlug, mussten wir hin und ihn löschen. Ich hatte das schon etliche Male getan.«
»Hattest du keine Angst?«, fragte ich atemlos.
Oma nickte langsam. »Angst. Ja, die hatten wir. Aber mit der Angst ist es manchmal sehr seltsam, wisst ihr. Erst denkst du, sie wird immer größer und größer, um dich irgendwann zu ersticken. Aber dann, wenn du einfach tust, was getan werden muss, wenn du trotzdem das Lachen nicht verlernst und das Mitgefühl für andere, dann merkst du, wie die Angst an Macht verliert. Sie wird kleiner und schwächer, sie begleitet dich nicht mehr die ganze Zeit und manchmal … ja, manchmal kann dann trotz der furchtbaren Situation ein kleines Wunder geschehen. So wie in dieser einen gewissen Nacht.«
Ben öffnete den Mund, um irgendetwas zu fragen, doch ich sah ihn an und schüttelte rasch den Kopf. Wenn ich mich nicht täuschte, hatte ich gerade unten am Fuß der Treppe Mamas Stimme gehört. Fehlte gerade noch, dass sie jetzt mitten ins Finale meiner Lieblingsgeschichte platzte! Ben schloss den Mund wieder. Obwohl er der ältere von uns beiden war, tat er oft, was ich vorschlug, denn er war der ruhigere und stillere von uns Zwillingen.
»Als der Fliegeralarm losging, trafen euer Opa und ich uns auf dem Dachboden. Dort war es so groß und leer wie in einem Tanzsaal. Aber nach Tanzen war uns natürlich nicht zumute, obwohl euer Opa ja immer behauptet, dass er schon vom ersten Moment an ein Auge auf mich geworfen hatte.« Mit einem kleinen Schmunzeln zwinkerte Oma uns zu. »Nein, statt zu tanzen und zu flirten, wie man es eigentlich tun sollte in diesem Alter, tränkten wir Lappen mit Wasser, verteilten die Eimer und warteten. Wenn die Bomber kamen, konnte man sie schon lange vorher hören. Es war so ein tiefes Brummen, das man überall im Körper spürte, besonders aber hier.« Sie legte die Hand auf ihren oberen Bauch. »Und dann waren sie da. Es war schrecklich in dieser Nacht! So viele waren es. Wir konnten überall in der Stadt die Detonationen hören. Bumm. Bumm. Bumm. Es nahm kein Ende. Als es am schlimmsten war, kamen die Brandsätze. Ja, es war nicht nur einer in dieser Nacht. Ich weiß nicht, wie viele es waren, die durchs Dach schlugen. Fritz und ich rannten. Seine Fußverletzung war vergessen. Wir rannten und rannten, mit Lappen und Besen. Wir schlugen auf die aufzüngelnden Flammen ein, wir erstickten sie mit Decken, wir löschten sie. Fast dachten wir schon, es sei geschafft. Doch dann …«
An dieser Stelle stockte mir jedes Mal der Atem.
»Vielleicht hatten wir einen Funken übersehen? Plötzlich stand nämlich ein Teil des riesigen Dachbodens lichterloh in Flammen. Ich weiß noch, dass wir uns ansahen. Dieser eine Augenblick, wisst ihr, in dem man sich auch ohne Worte einig ist. Einig darüber, dass wir nicht wegrennen und den Flammen ihren Sieg lassen wollten. Nein, stattdessen nahmen wir alle Eimer und Lappen und zogen in den Kampf. Und ein Kampf war es wirklich, das kann ich euch sagen! Am Ende hatten wir keinen einzigen Tropfen Wasser mehr. Wir schlugen nur noch mit zwei zerlöcherten Decken auf die Flammen ein. Die ganze Zeit über sagte ich mir: Ich bin nicht allein, Fritz ist hier! Ich hatte dieses verrückte Vertrauen, dass wir es zusammen schafften würden. Und siehe da … nach einer Zeit, die uns wie eine Ewigkeit vorkam, gewannen wir die Oberhand. Und dann, am Ende, hatten wir es tatsächlich gemeistert! Die Flammen waren gelöscht. Der Fliegerangriff war vorüber. Es fühlte sich an, als hätte wir zwei allein den Krieg beendet.«
»Die ganzen Häuser wären ratzfatz abgebrannt, wenn ihr nicht gewesen wärt, oder?«, murmelte Ben. Für ihn war dies die Geschichte einer Heldentat, die ihm zu gleichen Teilen Bewunderung entlockte und Gänsehaut bereitete.
»Oh ja, das wären sie wohl«, bestätigte Oma.
Ich ließ Ben in seiner schaurigen Verzückung schwelgen, doch für mich war der Kern von Omas Erzählung ein anderer.
»Wann hast du gewusst, dass du Opa heiraten willst?«, fragte ich sie.
Oma Inge sah mich lächelnd an. »Das weiß ich nicht mehr, Schätzchen. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich, ich hab es sofort gewusst. Gleich in dieser gewissen Nacht. Denn wenn du mit jemandem zusammen so ein riesiges Dach, ach was sag ich, einen ganzen Häuserblock gerettet hast, dann kannst du gar nicht anders als dich einfach in ihn zu vergucken«, schloss sie.
Ehe ich noch weiterfragen konnte, hörten wir leichte, schnelle Schritte auf der Treppe. Mamas Gesicht erschien im Türspalt.
»Was erzählst du den Kindern denn wieder für Sachen?«, fragte sie, als sie unsere erhitzten Gesichter sah.
»Nichts Besonderes«, antworteten Oma Inge, Ben und ich gleichzeitig. Wir wussten alle, dass Mama es nicht gern sah, wenn Oma uns vor dem Schlafen von ihrer Kindheit und Jugend, eben vom Krieg erzählte. Mama wollte lieber, dass Oma uns aus den pädagogisch wertvollen Kinderbüchern vorlas, die sie selbst so sorgfältig auswählte. Ben und ich aber liebten Omas wahre Geschichten und hätten um nichts in der Welt darauf verzichten wollen.
Gegen unsere Einigkeit konnte Mama nichts ausrichten. Sie seufzte tief, ließ es aber für dieses Mal dabei bewenden.
»Hast du nicht neulich deinen starken Kräutertee frisch gemischt?«, wandte sie sich an Oma. »Ich kann ihn nicht finden. Phillip würde eine Tasse davon bestimmt guttun. Er fühlt sich schon wieder nicht wohl.«
»Er arbeitet zu viel«, sagte Oma.
Heute weiß ich, dass die Gärtnerei damals eine elende Plackerei für die Erwachsenen gewesen sein muss. Alle notwendigen Arbeiten verrichteten sie selbst. Sie bereiteten die Erde vor, stellten den Dünger her, gruben um, verteilten den Kompost, suchten die Mutterpflanzen aus, zogen die Stecklinge, sammelten die Samen, kämpften gegen Blattläuse, Pilze und Mehltau, bereiteten die gezogenen Pflanzen für den Verkauf vor und erledigen den kompletten Papierkram. Mehr als ein Job also. Eine Arbeit voller Leidenschaft, die von Sonnenaufgang bis zum späten Abend alle Kräfte beanspruchte, Geschäftssinn genauso wie Wissen über Böden und die verschiedensten Ansprüche der Stauden. Das führte dazu, dass abends meist alle müde waren. Aber Papa war in den letzten Wochen schlapper als alle anderen zusammen.
»Nein, ich weiß nicht, diesmal kommt es mir vor, als sei noch irgendetwas anderes. Aber mit Arzt brauche ich ihm gar nicht zu kommen. Du kennst ihn ja«, sagte Mama. »Siehst du gleich mal nach ihm?«
Oma Inge seufzte, stand auf und beugte sich erst zu Ben und dann zu mir, um uns einen Gutenachtkuss zu geben. »Merkt euch das gut«, raunte sie. »Wenn man erst einmal Kinder hat, kann man nie alt genug werden, um sich nicht mehr um sie kümmern zu müssen.« Aber ich konnte ihrer Stimme ein Schmunzeln anhören. Wir alle wussten, dass sie Papa von Herzen liebte.
»Schlaft schön.«
Sie zog die Tür hinter sich zu.
»Nacht«, brummte Ben, der bereits tief in seine Decke gerutscht war.
»Hm. Nacht«, erwiderte ich.
Während mein Bruder schon kurze Zeit später zu schnorcheln begann, lag ich noch wach im gelben Dämmer des Nachtlichtes.
Ich dachte daran, wie unglaublich cool ich es fand, dass meine Großeltern sich ausgerechnet im Krieg ineinander verliebt hatten. In einer Zeit, in der es doch so unwahrscheinlich war, ausgerechnet so etwas wie Liebe zu finden. Um sie herum kämpften Menschen ums Überleben, viele starben, aber sie … liebten.
Das, fand ich, musste ein kleines Wunder sein.
1
Diese Geschichte endet nicht.
Es ist die Geschichte eines Landes.
Die von mutigen Freunden, von einem weisen Hohen Rat und vom liebevollen Zentrum der Macht.
Das klingt nach einer gewaltigen, nach einer kaum erzählbaren Geschichte – doch in Wahrheit ist sie so schlicht, klein und doch einzig wie jede andere Geschichte, in der das Leben den Tod besiegt.
(Beginn von: »Krieg in Bodiavien« von Ben Herzog)
Der Wind wehte die Samenstände von den Birken herunter. Innerhalb kürzester Zeit waren diese kleinen, nervigen geflügelten Körner überall. Auf den Sitzgelegenheiten und den Sonnenschirmen, auf den Hüten der englischen Reisegruppe und auf den Schalen mit den bereitgestellten Knabbereien. Sie schwammen im Seerosenteich, in den Vogelbädern und den Kaffeetassen der Besucher.
»Ich hab die Schnauze voll«, zischte meine Mutter und warf einen ihrer muffigsten Blicke hinauf zu den raschelnden Blättern. »Im Winter lass ich sie fällen.«
Anett und ich sahen uns kurz an und ich wandte mich ab, bevor wir beide würden grinsen müssen. Mama sagte das jedes Jahr, wenn Birken und Wind gemeinsame Sache machten, um unser Sommerfest in der Gärtnerei zu sabotieren. Aber die Bäume standen immer noch. Wir alle kannten den Grund dafür. Papa hatte sie vor vielen Jahren gepflanzt und so waren sie zu einer Art ständigem Gruß von ihm an uns geworden.
Außerdem bemerkte wahrscheinlich kaum jemand außer unserer perfektionistischen Mutter den kleinen Schönheitsfehler in Form von Millionen kleiner, bräunlicher Stippen.
Es war Mitte August. Zeit für die prächtigsten Sonnenstauden. Der Phlox duftete über die Beete. Der Sonnenhut Rudbeckia nitida, ›Herbstsonne‹, leuchtete strahlendgelb in alle Winkel. An den langen, dünnen Verzweigungen der Prachtkerze, Gaura, taumelten die rosa überhauchten weißen Blüten wie hunderte von nektarbetrunkenen Schmetterlingen. Perovskia, die Blauraute, streckte ihre langen, mit lavendelblauen Blüten übersäten dünnen Arme über den buckeligen Kopfsteinpflasterweg und hüllte alle Vorbeigehenden in mediterrane Träumereien.
Wie jedes Jahr hatten wir die letzten Wochen geschuftet und geackert, um für diesen einen Tag alles herzurichten.
Unsere Schaubeete sahen phantastisch aus. Es war eine Pracht in Pink, Lila und Blau, ebenso wie in flammendem Orange und vorwitzigem Gelb. Und direkt neben dieser Farbexplosion mein Beet, komplett in Weiß komponiert. Strahlende Blüten in Kombination mit Lind-, Gras-, Laubfroschgrün in allen Schattierungen. So lebendig und frisch, dass es an diesem warmen Tag der Magnet für die Besucher war. In Scharen standen sie davor, fotografierten und lugten auf die sorgfältig beschrifteten Schieferetiketten, die Auskunft über die einzelnen Pflanzen gaben.
Ich machte eine kleine Runde vorbei am Getränketisch und sah nach, ob noch alles ausreichend vorhanden war.
»Frau Herzog!«, rief jemand mit hoher, näselnder Stimme und ich sah mich automatisch um. War ich gemeint? Mama? Oma? Meine Schwester Anett? An Tagen wie diesem konnte die Anzahl an Herzoginnen vor Ort ein wenig verwirrend sein. Ich betete für den Tag, an dem wenigstens meine heiratsmuffelige Schwester aus diesem Kreis ausscheiden würde, weil ihr langjähriger Freund Dominik sie endlich vor den Traualtar schleifen und sie bitteschön seinen Namen annehmen würde. Das wurde mit knapp Ende dreißig für Anett doch wohl auch mal Zeit.
»Frau Herzog! Huhu!«, ertönte es erneut.
Drüben, am Eingang des ehemaligen Packschuppens, der heute als großer, behaglich ausstaffierter Verkaufsraum diente, stand eine Frau in fliederfarbenem Kostüm und winkte euphorisch.
Ich seufzte. Manchmal wäre es mir lieber, eine andere »Frau Herzog« wäre gemeint gewesen. Besonders als ich jetzt sah, dass neben dem Bonbonkostüm ein beleibter Kerl mit vor der Brust baumelnder Kamera erschien. Ach je, Dörte Katschmal hatte ihren Fotografen mitgebracht. Es war also mal wieder Zeit für einen Auftritt in der überregionalen Presse.
Hinter Dörte Katschmal tauchte Anett auf und gestikulierte wild unser geheimes Zeichen für »Organisierte Flucht«, welches sie mit einer fragenden Miene versah. Ich schüttelte leicht den Kopf. Einmal musste es ja sein. Dann straffte ich die Schultern und ging lächelnd zu ihnen hinüber.
»Da ist ja unsere Staudenprinzessin!«, krähte Frau Katschmal und raunte ihrem Begleiter etwas zu, woraufhin der sogleich die Kamera vors Gesicht hob und munter drauflos schoss.
Meine Güte! Sie nannte mich tatsächlich immer noch so!
Etliche Besucher richteten ihre Aufmerksamkeit von den Beeten und Verkaufstischen weg auf mich und tuschelten.
»Wie wunderbar, Sie wiederzusehen!« Frau Katschmal reckte mir die Hände entgegen, als sei ich ihre verloren geglaubte Tochter. »Es muss jetzt ein oder zwei Jahre her sein, oder?«
»Vier«, korrigierte Anett. Und das war für meinen Geschmack eine entschieden zu kleine Zahl, wenn es um die Jahre ging, in denen ich Dörte Katschmal nicht Rede und Antwort stehen musste. »Ihr ungefragter Outing-Artikel über meine Schwester liegt jetzt vier Jahre zurück.«
»Vier Jahre! Ach, du meine Güte!«, rief Frau Katschmal, ohne auf Anetts sarkastischen Tonfall einzugehen. »Da wird es aber wirklich Zeit, dass unsere Leser mal wieder etwas Spannendes über Sie erfahren, finden Sie nicht?«
»Na ja …«, brummte ich.
»Können wir uns irgendwo in Ruhe unterhalten?«, fuhr sie fort.
Ich holte tief Luft. »Wissen Sie was? Ich werde Sie erst mal herumführen. Dann können Sie sich einen Überblick verschaffen«, sagte ich. »Fangen wir doch gleich hier vorn an …«
Dörte Katschmal, von Anett nur ›Klatschmaul‹ genannt, nicht nur wegen des symptomatisch in die kleinen Fältchen um ihre Lippen verlaufenden lilaroten Lippenstifts, musste mittlerweile kurz vor der Rente sein. Als Journalistin versorgte sie eine auflagenstarke, überregionale Sonntagszeitung mit neuesten Tratschgeschichten, gern auch mit etwas Dramatik. Kennengelernt hatten wir uns vor sage und schreibe sechsundzwanzig Jahren, als ich siebzehn war. Mir war etwas gelungen, was tatsächlich nur wenigen Gärtnerinnen vorbehalten ist: Ich hatte eine neue Züchtung geschaffen, die auf Anhieb von der Staudensichtung mit den höchsten Bewertungen bedacht worden war. Eine bisher noch nicht da gewesene, hohe in sattem Pink blühende Sorte der Gaura, der Prachtkerze.
Die Fachwelt staunte. Die Presse überschlug sich vor Begeisterung. Allen voran Dörte Katschmal. Ihr zufolge war ich eine Art Wunderkind, eine weibliche Mogli. Jedoch nicht von Wölfen und Panthern im Dschungel, sondern von den Stauden in unseren Gewächshäusern und Beeten aufgezogen. Der Artikel im Klatschblatt brachte uns damals Scharen von neuen Gartenfreunden aus der Umgebung und ganze Busladungen von Besuchern aus ferneren Regionen. Was anderes hätte ich also tun können, außer mich alle paar Jahre auf ein Gespräch mit dieser Nervkuh einzulassen und anschließend vor ihrem journalistischen Auswurf zu bangen?
Im doppelseitigen, bunt bebilderten Märchen vor vier Jahren war der Leitfaden meine sexuelle Orientierung gewesen, von der die Reporterin auf Umwegen erfahren haben musste. Doch das Drama blieb aus; ich hatte mein Lesbischsein schon immer recht unaufgeregt gelebt. Und da ich derzeit als Single durchs Leben ging, hatte ich zumindest in dieser Hinsicht wohl nichts mehr zu befürchten.
Anett stand mir beim Herumschlendern mit den beiden Pressefritzen zur Seite und sprang mir immer dann bei, wenn ich über eine vom Klatschmaul geschickt eingestreute Frage zu meinem Privatleben zu stolpern drohte. Meine Schwester und ich waren beide heilfroh, als wir diese Pflichtübung hinter uns gebracht hatten und die Katschmal samt Kameragefolge wieder vom Hof stolzierte.
»Herrje, ich bin gespannt, was sie da nun wieder daraus zusammenkleistert«, stöhnte ich.
Anett grinste breit und wollte gerade etwas erwidern, als ihr Blick an mir vorbeifiel.
»Ben!«, kreischte sie. Und rannte los.
Tatsächlich. Da drüben neben dem Tisch mit den Erfrischungen stand unser Bruder, zusammen mit Oma Inge und einer jungen Frau an seiner Seite!
Er hatte sich nicht angekündigt. Das tat er nur selten. Stattdessen tauchte er einfach auf und war mit seiner zurückhaltenden, fast schüchternen Präsenz einfach da, als sei er nie fortgegangen. Die ganze Familie war unserer grünen Insel, der Staudengärtnerei Herzog, sehr verhaftet. Nur Ben als erfolgreicher Buchautor lebte zwei Stunden entfernt in einem teuren, schicken Penthouse hoch über Frankfurt, mit schwindelerregendem Blick von der Dachterrasse, ganz ohne Bodenhaftung. Oft war er auch unterwegs und bereiste für Lesungen mit seinen Büchern ganz Europa.
Jetzt flog Anett ihm um den Hals. Er umarmte sie lachend, drückte sie an sich. Sie plapperte sofort auf ihn ein. Für Anett war Ben der bewunderte große Bruder aus Kindertagen geblieben. Während er und ich …
Ich schüttelte kurz den Kopf, als wollte ich eine lästige Fliege vertreiben. Heute keine schweren Gedanken.
Lächelnd ging auch ich hinüber zu ihnen.
»Hi, Ben, wie schön, dass du es geschafft hast«, sagte ich und legte kurz meine Hand auf seinen Arm.
Er wandte sich um und sah mich an. Seine braunen Augen, immer noch den meinen so ähnlich. Sogar das gleiche, feine Grübchen in der einen Wange.
»Hallo Sascha«, antwortete er nur. »Das hier ist Becci.« Ben trat einen kleinen Schritt zurück, so wie es seine Art war. Er tat häufig einen Schritt zurück, um nicht im Vordergrund zu stehen. Vermutlich war er deswegen auch Autor geworden. Um im Zweifelsfall die Bücher vorschieben zu können. Zumal als Kinderbuchautor: Bei seinem jungen Publikum konnte er sicher sein, dass es die Hintergründe zu den spannenden Geschichten oder gar demjenigen, der sie sich ausgedacht hatte, gewiss nicht hinterfragen würde. Er baute darauf, dass seine Bücher für ihn sprechen würden. Im Grund also genau das, was ich auch mit den Pflanzen tat.
Ich wandte den Kopf und sah seine Begleitung zum ersten Mal richtig an. Und mir stockte der Atem. Mich schaute ein Gesicht aus der Vergangenheit an.
Sie war deutlich jünger als wir, vielleicht Anfang zwanzig. Doch das allein war es nicht, was mich so stark an damals erinnerte. Es war ihr streng in einen Zopf gebundenes, fast rabenschwarzes Haar. Es waren ihre saphirblauen Augen hinter den dichten, dunklen Wimpern. Ihr schmaler Mund, den sie durch einen korallenroten Lippenstift hervorhob. Und es war ihr zarter, grazil wirkender Körper, der einer Hochseilartistin hätte gehören können.
All das sah ich im Bruchteil einer Sekunde, in der alles in mir gefror. Als wir uns jetzt anschauten und ihr geschminkter Mund sich zu einem unsicheren Lächeln formte, wurde mir jedoch schlagartig klar, dass ich mich getäuscht hatte. Diese junge Frau sah Corinna ganz und gar nicht ähnlich. Einige Details stimmten überein, ja. Aber es mangelte ihr an etwas ganz Entscheidendem: Sie besaß nicht Corinnas einzigartige, herbe Schönheit, die einem schmerzhaft ins Herz schnitt, wenn man sie zu lange ansah – so viel Zorn und Leidenschaft lag darin. Was ein Herz, das sich Corinna zuwandte, allerdings noch wesentlich schlimmer verletzen konnte als ihre Schönheit, war ihre rasiermesserscharfe Zunge in Kombination mit gnadenloser Ehrlichkeit.
Becci hier hatte nichts davon. Sie war jung, herzig lieb und bewunderte meinen Bruder offensichtlich maßlos.
»Hast du dich schon umgesehen?«, fragte ich sie. »Ich könnte …«
»Oh, nein, nein«, unterbrach mich Oma Inge. Sie hakte sich bei Becci ein, nicht größer und ebenso zart und zerbrechlich wie die junge Frau. »Die Führung habe bereits ich ihr versprochen. Du darfst dich gerne ein bisschen um deinen Bruder kümmern.«
Scheibenkleister. Genau das hatte ich befürchtet.
»Ich besorg dir was vom Häppchen-Büffet«, rief Anett Ben zu und eilte davon. Mitten hinein in eine ganze Busladung voller gartenambitionierter Rentner, die an ihrer hellgrünen Kleidung mit unserem Gärtnereilogo die Fachkraft erkannten und in ein Fragengemetzel verwickelten.
»Es macht dir doch nichts aus, wenn es mit deinem Imbiss etwas dauern wird?«, fragte ich Ben mit einem betont fröhlichen Grinsen. Er blickte immer noch Becci nach, die gerade an Omas Arm im Packschuppen bei den Geschenkartikeln, Seifen und Gartengeräten verschwand. »Du brauchst dir um sie keine Sorgen zu machen«, sagte ich. »Kennst Oma doch. Sie hat gleich erkannt, dass deine Freundin ein bisschen Beglucken braucht.«
Ben wandte den Kopf und sah mich mit einem schiefen Lächeln an. Da erst kam mir der Gedanke, dass seine Sorge womöglich gar nicht Becci gegolten haben könnte … Im gleichen Moment wurde mir klar, dass dies einer der seltenen Augenblicke war, bei der mein Zwillingsbruder und ich allein waren. Natürlich wogte um uns herum das Publikum, unsere Familie und unsere Angestellten. Doch wie auf einer Insel im Meer gab es hier mit einem Mal nur uns beide.
»Was möchtest du gern tun?«, erkundigte ich mich rasch. Mein schweigsamer Zwilling würde das Gespräch nicht eröffnen, soviel war klar. »Soll ich dir die neuen Beete zeigen? Mama hat sich dieses Jahr selbst übertroffen und rund um den Seerosenteich …«
»Ich würde gerne nach hinten gehen«, bat Ben leise.
Nach hinten war ein Begriff, der aus unserer Kindheit stammte. Ich wusste, was er meinte. Im hinteren Bereich der Gärtnerei lagen die Winterquartiere der Pflanzen, die vor den Frösten geschützt werden mussten. Diese Gewächshäuser und die sie umgebenden, durch Hecken geschützten Gartenbereiche der Mutterpflanzen waren für die Besucher nicht zugänglich.
Dort wollte Ben also mit mir hin? In die Stille?
Mir war ein wenig beklommen zumute, während wir nebeneinander über die Kieswege schlenderten, Besuchergruppen auswichen und Gesprächsfetzen aufschnappten, die sich um die richtige Pflanzzeit, zeitgerechte Teilung von etablierten Stauden im Herbst und die Philosophie zu »Beete gießen oder nicht gießen« drehten.
Dies war meine Welt.
Ich hätte gern gewusst, ob auch Ben sich ihr noch verbunden fühlte. Aber ich traute mich nicht, ihn zu fragen.
Als wir unter den dicken Seilen hindurchgetaucht waren, die den hinteren Gärtnereibereich abtrennten, bog Ben nach links ab und betrat das erste Winterquartier.
Hier herrschte jetzt, im Spätsommer, eine erwartungsvolle Ruhe. Ein Berg frischen Komposts, den Dieter letzte Woche schon hierher gefahren hatte, verbreitete den typischen, dunklen Erdgeruch. In einer Ecke stapelten sich Plastikbehälter für die Verkaufspflanzen, nach Größen sortiert. Ich blieb im Eingang stehen. Doch Ben begann, zwischen den erhöhten, aus Beton gegossenen, inzwischen mit einer grünen Patina angelaufenen langen Reihen von Tischen und Stellflächen entlangzugehen.
»Hier war ich schon lange nicht mehr«, sagte er, während er mit den Fingerspitzen über eine Stellfläche strich.
Ich war mir nicht sicher, ob die Worte an mich gerichtet waren oder ob er eine Art leises Selbstgespräch führte. Deswegen antwortete ich nicht. Was selten vorkam.
Als Kinder glichen wir uns auffallend, so wie Geschwister das manchmal tun. Während Anett die blonden Haare und blauen Augen, das Runde und Weiche unserer Mutter geerbt hatte, sahen mein Bruder und ich mit unserem schokobraunen Haar, den dunklen Augen und dem sportlich schlanken Körper unserem Vater ähnlich. Doch damit hatten sich unsere Gemeinsamkeiten bereits erschöpft.
Während ich schon damals bei jedem Wetter draußen herumlief, saß Ben lieber allein für sich drinnen im Packschuppen. Ich genoss die Gesellschaft der Gärtnereikunden, schob die vor Begeisterung quietschende Anett in einem der niedrigen Handkarren herum, von denen unsere Eltern immer hofften, die Kunden würden sie mit Einkäufen pickepacke vollladen, und ging Papa und Opa bei der Vermehrung der Pflanzen zur Hand. Ich konnte Sämlinge perfekt pikieren, bevor ich meinen eigenen Namen schreiben konnte.
Ben aber brütete stundenlang über einem seiner heiligen Schulhefte, in die er kleine Geschichten schrieb. Alles äußerst geheim. Höchstens Oma Inge bekam die sorgsam gehüteten Schriftstücke hin und wieder zu lesen.
War es da ein Wunder, dass unser Vater, von ganzem Herzen Gärtner, einen besonderen Draht zu seiner pflanzenverliebten Tochter entwickelte?
Es war nicht so, dass er mich deutlich vorgezogen hätte und dies durch Geschenke oder sonstige Zuwendungen an mich zum Ausdruck gebracht hätte. Nein, es war einfach die Tatsache, dass Papa kaum zu mir hinschaute, wenn ich vorsichtig die kostbaren Setzlinge in die Verkaufstöpfchen setzte – er vertraute mir und meinem gekonnten Umgang mit den Zöglingen. Und es war seine Art und Weise, bei der Frage »Kommt jemand mit ins Gewächshaus?« in erster Linie in meine Richtung zu lächeln. Einfach, weil immer ich diejenige war, die als Antwort sofort aufsprang, egal, womit ich gerade beschäftigt gewesen war.
Man hätte nicht einmal sagen können, dass unser Vater eine Vorliebe für mich gehabt hatte. Vielleicht war es eher so, dass er sich selbst in mir erkannte. Und ist es nicht das, was die engsten Bänder knüpft?
»Hier standen früher im Winter die Sonnenröschen mit deinem Namen«, stellte Ben jetzt fest und legte beide Hände auf die kühle Steinfläche vor ihm.
»Ja, ist heute immer noch ihr Platz«, stimmte ich ihm zu, erfreut, dass er sich an so etwas erinnern konnte. Zu unserem zehnten Geburtstag hatte Ben sich ein Bonanza-Fahrrad gewünscht. Ich jedoch wünschte mir keine Barbie oder eine Playmobilburg wie andere Mädchen in meinem Alter. Ich hatte höhere Ziele. Gerade hatte ich gelernt, wie der lateinische Name bei Pflanzen zusammengesetzt wurde. Zuerst kam der Name der Gattung, dann die Art, schließlich die Sorte, wobei auch manchmal der Name des Züchters angegeben wurde. So entstanden zum Beispiel Namen wie: Geranium himalayense ›Gravetye‹ oder Astilbe x arendsii ›Augustleuchten‹. Mischlinge aus verschiedenen Sorten wurden als Hybride gekennzeichnet und hatten häufig noch klingende Zusatznamen. Zum Beispiel die Akelei Aquilegia Caerulea-Hybride ›Louisiana‹. Und so hatte ich mir gewünscht, es möge eine Pflanze geben, die nach mir benannt wäre.
»Verrückt, dass Papa sich damals die Mühe gemacht hat, extra für mich pinkfarbene Sonnenröschen zu kreieren, was?«, sagte ich schmunzelnd. »Weißt du noch?Helianthemum-Hybride ›Sascha‹! Ich war so unfassbar stolz! Wir waren mal zusammen hier, du, Papa und ich. Er hat uns alles erklärt. Dass Helianthemum eigentlich keine echte Staude ist, sondern ein Halbstrauch aus der Familie der Zistrosengewächse. Wie der Rückschnitt nach der Blüte aussehen muss. Und dass man anschließend mit Brennnesseljauche düngt. Erinnerst du dich an den Nachmittag? Muss irgendwann im Dezember gewesen sein.«
Ben sah mich an, die Handflächen immer noch auf der nun leeren Fläche vor sich.
»Ich erinnere mich sehr gut«, antwortete er. »Das war kurz vor seinem Tod. Er sagte, wir dürften nie vergessen, dass dein ganz spezielles Sonnenröschen nicht winterhart ist. Wir mussten ihm versprechen, es bei Kahlfrösten unbedingt zu schützen.« In seiner Stimme schwang ein seltsamer Unterton mit. Als halte er dieses Versprechen für so etwas wie einen schlechten Scherz. Etwas, was ein siechender Vater seinen beiden älteren Kindern mit auf den Weg geben wollte, was jedoch für eines von ihnen ohne Sinn und Zweck gewesen war.
Betroffen schwieg ich.
In mir ballte sich die bange Frage zusammen, warum Ben mit mir in diese Stille hatte eintauchen wollen, obwohl dort draußen, keine fünfzig Meter entfernt das Sommerfest tobte.
Hatte er absichtlich genau dieses Gewächshaus gewählt?
Wollte er ausgerechnet hier mit mir reden?
Etwa über damals?
Über Papa und unser Verhältnis zu ihm? Oder sogar … – zum zweiten Mal am heutigen Tag stockte mir der Atem – oder sogar über die Dürre, die sich so plötzlich zwischen uns Zwillingen ausgebreitet hatte wie Dünen fruchtlosen Sandes, die uns immer weiter voneinander wegtrieben?
Ich musste schlucken und wollte mich schon in irgendeine schwachsinnige Bemerkung flüchten, wollte von Dörte Klatschmaul erzählen, als wir vor dem Gewächshaus Schritte hörten. Sie klangen nach schweren Schuhen. Gärtnerschuhen.
Opa Fritz bog um die Ecke.
»Hier seid ihr!«, rief er. »Ben! Junge! Hast deinem alten Gartenzwerg noch gar nicht Hallo gesagt!«
Die fast greifbare Spannung zwischen uns wirbelte zum hinteren Eingang hinaus.
Ben lachte und ging durch die Reihen, um unseren Großvater in den Arm zu nehmen. Opa Fritz war immer begeistert, wenn Ben auftauchte. Da die Partner von Mama und Anett anderen Jobs nachgingen und sich aus den Belangen der Gärtnerei meist heraushielten, fühlte Opa sich stets als einziger Mann gegen eine Überzahl von vier weibliche Familienmitgliedern. Er knuffte Ben freundschaftlich die Schulter.
»Ihr müsst mit nach vorn kommen. Es gibt gleich Inges kalte Gartensuppe«, verkündete er, wirbelte erstaunlich flink für einen fast Neunzigjährigen auf dem Absatz herum und winkte Ben mit sich.
Ich folgte den beiden über die Kieswege und beobachtete, wie Ben mit Opa scherzte und lachte. Schien es nur so oder war mein Bruder über die Unterbrechung unseres Gespräches ebenso erleichtert wie ich?
Ben und Opa entdeckten Oma und Becci und steuerten auf sie zu. Ich verlor sie in dem Gewusel um uns herum aus den Augen. Die Betriebsamkeit schluckte mich, der Veranstaltungstag nahm seinen Lauf. Das Sommerfest war ein voller Erfolg.
Als schließlich alle Gäste gegangen, die Verkaufstische abgeräumt, Teller, Tassen und Gläser ins Haus gebracht waren, blieben wir noch zusammen sitzen. Meine Familie, zu der ich natürlich auch Mamas Lebensgefährten Jochen und Anetts Dominik zählte, und unsere drei Angestellten Marie, Dieter und Elvira, die auf jeden Fall auch mit zum harten Kern meines Lebens gehörten. Wir tranken Wein und bedienten uns an den Leckereien, die vom Tag übriggeblieben waren.
Die Kerzen in den Windlichtern flackerten mit den Flammen im Feuerkorb um die Wette. Mama und Jochen saßen ein wenig abseits unter einer Wolldecke und unterhielten sich mit Becci und Ben.
Verstohlen sah ich immer mal wieder hinüber.
Beccis schwarzes Haar. Ihre strahlend blauen Augen. Das Zarte, das neben meinem großen, sportlich muskulösen Bruder geradezu zerbrechlich wirkte. Sie lächelte viel und ich hörte sie einige Male wirklich nette Sachen zu Mama sagen, über die Gärtnerei, die Beete, den schönen Tag, das Essen. Ihre Freundlichkeit nahm mich für sie ein. Corinna, daran erinnerte ich mich noch gut, wollte nie jemandem gefallen. Sie machte niemals Komplimente und trug meist ein ernstes Gesicht zur Schau.
Der auffälligste Unterschied bestand jedoch darin, dass Becci meinen Bruder ganz offensichtlich anhimmelte. Wenn sie ihn ansah, leuchteten ihre Augen, und wenn sie mit ihm sprach, sang in ihrer Stimme eine feine, leise Melodie mit. Ben sonnte sich in dieser Aufmerksamkeit.
Ich gönnte es ihm, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob es wirklich das war, wonach er suchte.
Anett und ich waren uns immer noch nah, wussten über das Leben der anderen und deren Gefühle genauestens Bescheid. Wir teilten Sorgen genauso miteinander wie die kleinen alltäglichen Freuden. Doch bei Ben hatte ich diesen Kontakt irgendwann auf dem Weg ins erwachsene Leben verloren. Wir riefen einander so gut wie nie an. Immer wenn wir mal die Gelegenheit hatten, miteinander allein zu sein, fanden wir Gründe, um dem auszuweichen. Er war mein Bruder. Mein Zwilling sogar. Aber offenbar spürten wir diese Verbindung beide nicht mehr.
Anett, die offenbar mitbekommen hatte, dass ich zu den anderen hinüberschielte, rutschte nah an mich heran und wisperte mir zu: »Ist das erste Mal seit Jahren, dass Ben eine Freundin mit herbringt.« Dabei warf sie einen unauffälligen Blick hinüber zu der jungen Frau. »Am Anfang hab ich mich echt erschrocken. Sie sieht Corinna ziemlich ähnlich, oder?«
Ich zog in hoffentlich überzeugender Überraschung die Brauen hoch. »Corinna? Tatsächlich? Ist mir nicht aufgefallen.«
Anett kniff die Augen zusammen und musterte mich kritisch.
Sie kannte mich wahrscheinlich besser als sonst irgendwer. Doch trotz unseres heutigen, engen Verhältnisses wusste auch sie nicht, was damals genau geschehen war. Sie wusste nur, was alle wussten und miterlebt hatten: Corinna war zu Abiturzeiten Bens Freundin gewesen. Sie war aus einer anderen Stadt hierhergezogen und in unsere Stufe gekommen. Von Anfang an war sie eine, der alle hinterhersahen. Eine, die überall aneckte. Eine, die stets so wütend wirkte, als sei sie in ihren jungen Jahren schon vom Leben betrogen und permanent auf Rache aus. Sie war so schön, dass es wehtat. Ben hatte in dieser ersten großen Liebe drei Jahre lang auf Wolken geschwebt und war genauso häufig durch die Hölle gegangen. Denn Corinna war kein Mensch, der Harmonie schätzte. Trotz der vielen Auseinandersetzungen war mein Bruder glücklich. Bis zu jenem einen Abend unseres einundzwanzigsten Geburtstages …
»Ich geh rein. Bin vollkommen erledigt«, erklärte ich Anett, bevor sie nachhaken konnte.
Ich sagte allen gute Nacht, verabschiedete mich von Becci und Ben. Der Blick aus seinen tiefen, braunen Augen begleitete mich noch, als ich über das Kopfsteinpflaster hinüber zum alten Gehilfenhaus ging. Vor fünfzehn Jahren hatte ich den Ziegelbau mit Anetts und Opas Hilfe zu einer hübschen kleinen Wohnung umgebaut. Unten ein großer, gemütlich eingerichteter Wohnraum samt offener Küche und angrenzendem Wintergarten, oben ein kuscheliges Schlafzimmer und das moderne Bad mit der altmodischen, auf Krallenfüßen stehenden Wanne. Dort ließ ich jetzt meine Klamotten einfach auf den Boden fallen und drehte die Dusche auf heiß.
Ben hatte bestens ausgesehen. Vielleicht tat Becci ihm wirklich gut?
Ich seufzte. Nun ja, ein bisschen Sex hin und wieder wäre auch für mich mal wieder eine tolle Abwechslung. Seit meiner letzten Kurzzeitbeziehung mit der flatterhaften Paula waren etliche Monate vergangen. Vielleicht sollte ich mal wieder in die Szene eintauchen und mich nach einer umschauen? Der Vorsatz vertrieb ein wenig meine Müdigkeit. Während ich mich einseifte, musste ich grinsen. Vielleicht könnte ich Anett nochmal überreden, mich auf eine Frauenparty zu begleiten und … Ich stutzte. Mit der linken Hand fuhr ich erneut an meiner rechten Brust entlang. Da war der Knubbel, den ich neulich schon einmal gespürt hatte. Aber an dem Tag war mir die Schubkarre mit den Sandsteinen für die neue Trockenmauer umgekippt und als ich noch schnell den Griff fassen wollte, war er mir gegen die Seite geschlagen. Das war doch aber Wochen her. Konnte diese Verdickung immer noch von dem kleinen Unfall stammen?
Ich strich langsam über die weiche Haut. Ja, ganz deutlich war es zu spüren. Ein Knoten von vielleicht einem halben Zentimeter, der tief unter der Haut saß. Verflixt, da würde ich wohl zur Ärztin gehen müssen. Eigentlich hatte ich keine Zeit für so etwas. Der bevorstehende Herbst war eine betriebsame Jahreszeit bei uns. Viele Stauden mussten vermehrt, die Winterquartiere, die Mutterpflanzen geschnitten werden. Aber manche Dinge sollte man besser nicht aufschieben. Es war ja nur eine Stunde Zeit, die ich investieren musste. Danach konnte ich weitermachen wie immer.
2
Unsere drei Freunde, mit denen die Geschichte beginnt, waren ahnungslos.
Es waren die drei Unzertrennlichen, Sentinel, Lymph und Node.
(Aus: »Krieg in Bodiavien« von Ben Herzog)
Macht euch nicht verrückt«, sagte ich, als ich zu Anett ins Auto stieg. Mama mit Jochen, Oma und Opa standen um meinen Wagen herum. Wir versuchten alle, uns durch aufmunterndes Lächeln gegenseitig Mut zu machen.
»Es ist bestimmt nur eine Entzündung im Drüsengewebe. Kein Grund, sich zu sorgen«, erklärte ich wie schon etliche Male zuvor in den vergangenen zwei Wochen.
Es hatte nicht ganz geklappt mit meinem Vorsatz, nach dem Besuch bei meiner Gynäkologin einfach weiterzumachen wie immer. Denn sowohl die Ultraschalluntersuchung bei ihr als auch die Mammografie, die sie für mich daraufhin rasch bei einem Radiologen vereinbart hatte, hatten Anlass zur Besorgnis gegeben: Es befand sich ein etwa sechs Millimeter großer Knoten in meiner rechten Brust auf zehn Uhr. Und die Mammografie hatte einen weiteren, etwas kleineren, schräg darunter gezeigt.
Zum heutigen Biopsie-Termin wollte erst meine ganze Familie mit in die Klinik gefahren. Ich hatte sie gerade noch davon abhalten können. Am liebsten wäre ich allein aufgebrochen, doch Mama hatte so besorgt geschaut, dass ich mich breitschlagen ließ, Anett als Begleitung mitzunehmen. Meine kleine Schwester war schließlich eine Frohnatur. Vielleicht würden wir sogar den einen oder anderen Witz reißen können, um cool zu bleiben.
Zunächst sah es allerdings nicht danach aus. Die Fahrt, der Gang vom Parkplatz hinein in die Klinik, Fahrstuhl, rechter Eingang, Anmeldung hinter der Glastür bei einer freundlich lächelnden Schwester, das alles fühlte sich an, als würde ich durch Nebel gehen.
Anett und ich unterhielten uns über einen neuen Hersteller von Gartenwerkzeug. Handschaufeln, Unkrautstecher, Staudensichel, Scheren und so weiter. Wir waren dabei, die Produkte reihum im Einsatz in der Gärtnerei zu testen. Auf diese Weise würden wir feststellen, ob die Sachen tatsächlich hielten, was sie versprachen und ob wir sie in unseren Verkauf aufnehmen wollten. Wir redeten, als würden wir nur miteinander spazieren gehen. Als säßen wir nicht auf hübschen Designerstühlen vor den Behandlungsräumen. Als warteten wir nicht auf einen Arzt, der gleich Gewebeproben aus meiner Brust entnehmen würde.
Außenstehende hätten vielleicht gefunden, dass wir uns seltsam benahmen, indem wir eben so taten, als sei alles ganz alltäglich. Doch es war die einzige Möglichkeit, die Angst in Schach zu halten.
Als der Arzt uns endlich in sein Besprechungszimmer bat, war mir gleich klar, dass er und ich kein gutes Team abgeben würden. Die flüchtige Geste, mit der er uns die Schwingstühle vor seinem Schreibtisch anbot, begleitete er mit einem Blick in die Unterlagen. Er überflog den Arztbericht murmelnd und sah währenddessen zweimal auf seine Armbanduhr. Dabei wirkte er so fahrig und nervös, als sei er in ärgster Zeitnot. Meine Fragen nach dem Ablauf des anstehenden lokalen Eingriffs beantwortete er knapp. Es war ihm anzumerken, dass er lieber gleich loslegen wollte.
»Wir müssen rausfinden, ob es böse ist«, sagte er abschließend und stand auf. Offenbar in den Glauben, dass wir uns nun auch erheben würden.
Anett war auch tatsächlich im Begriff, aufzustehen. Doch ich blieb sitzen.
»Böse?«, wiederholte ich verwundert und ein wenig gereizt. Seine Stimmung war auf mich übergeschwappt wie heiße Suppe über den Tellerrand. »Ich hatte bisher keine Ahnung, dass Körperzellen irgendwie ›böse‹ oder ›gut‹ sein können.«
»So sagt man eben«, erklärte er mir mit einem gönnerhaften Lächeln, als sei ich ein widerspenstiges Grundschulkind, und kam um den Schreibtisch herum. Dass ich immer noch nicht aufstand, schien ihn zu irritieren.
Ich konnte Anetts besorgten Blick von der Seite spüren. »Sascha?«, sagte sie leise. Hätte sie das nicht getan, hätte ihre Stimme nicht diesen feinen, bittenden Unterton gehabt, ich hätte die Klinik wahrscheinlich unverrichteter Dinge wieder verlassen. Doch die Stimme meiner jüngeren Schwester, ihre seit Tagen so mühsam überspielte Sorge bewirkten, dass auch ich mich erhob. Gemeinsam folgten wir dem Arzt hinüber in den Behandlungsraum.
»Du weißt, was ich von Spritzen halte«, erinnerte Anett mich, als es an die lokale Betäubung ging. »Erwarte bloß nicht, dass ich da hingucke.«
»Kein Problem. Ich wette, es klappt auch so«, erwiderte ich und wir kicherten beide.
»Sie müssen schon stillhalten«, sagte er Arzt.
»Wir können später drüber lachen«, vertröstete ich Anett. Sie biss sich auf die Lippen.
Die Einstiche der Spritze taten nur mäßig weh. Als ich jedoch das Biopsiewerkzeug näher betrachtete, entschied ich, bei dieser Sache lieber auch nicht hinzuschauen. Die Metallröhre, die ins Gewebe glitt, war doch eine Nummer zu groß, um darüber noch schmunzeln zu können.
Jedes Mal, wenn das Gerät ein wenig Gewebe aus meiner Brust stanzte, gab es einen metallischen Knall. Ich sah Anett an.
Ihr Gesicht leuchtete hell in dem abgedunkelten Raum. Sie sah mich an. Bei jedem Knall flatterten ihre Lider. Aber sie schaffte es, nicht zusammenzuzucken.
»Sieht schlecht aus«, sagte der Arzt am Ende. »Ich tippe auf einen G3-Tumor, höchster Grad. Genaues wissen wir natürlich erst morgen mit dem Laborbefund, aber so wie das Gewebe aussieht … Ich hab natürlich schon viel gesehen. Man irrt sich so gut wie gar nicht mehr.«
»Wie meinen Sie das? ›Es sieht schlecht aus‹?«, wollte ich wissen, während die Schwester die Einstiche des Biopsie-Gerätes mit Pflastern versorgte.
Der Arzt war ganz offensichtlich in seinem Element. »Nicht mehr nach Brustgewebe, wissen Sie. Üblicherweise kann man bei gesunden Zellen immer sagen, woher im Körper sie stammen, Brust, Leber, Speiseröhre, beispielsweise.« Ich wollte mir nicht vorstellen, wie um Himmels willen man Gewebeproben von der Speiseröhre nehmen würde, und blinzelte den Gedanken rasch weg. Der Arzt fuhr sowieso schon fort, ohne zu bemerken, welche Bilder seine Worte in meinem Kopf auslösten. »Bei hoch aggressiven Tumoren kann man nicht mehr erkennen, wo das Gewebe entnommen wurde. Und das, was ich da gerade von Ihnen bekommen habe, das könnte alles Mögliche gewesen sein. Ist nur noch Brei, verstehen Sie? Stellen Sie sich besser drauf ein, dass es was Aggressives ist.«
Es war ein paar Sekunden ganz still im Raum. Vorsichtig zog ich meinen BH über und schlüpfte in die Ärmel der Bluse.