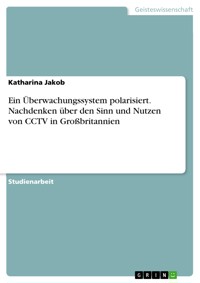12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Mosaik
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Von Lebensrettern, Schutzengeln und Seelentröstern: Hunde und ihre unglaublichen Taten
Sie sind nicht nur des Menschen beste Freunde und tierische Familienmitglieder, sie dienen uns auch unaufhörlich. Jeden Tag machen sie zuverlässig ihren Job, sei es als Jagdhelfer, Herdenschützer, Drogenschnüffler, Blindenführer und noch vieles andere mehr. Meist arbeiten sie dabei im Stillen, von der Öffentlichkeit unbemerkt. Doch manchmal wachsen sie über sich hinaus. Dann werden sie zu Helden und retten Leben.
So wie Swansea Jack, ein Mischling aus Neufundländer und Flat Coated Retriever, der als Rettungsschwimmer mindestens 27 Menschen aus dem Wasser zog. Oder wie Togo, ein Husky, der tagelang durch Schneestürme rannte, um eine Stadt in Alaska mit Medikamenten zu versorgen.
Katharina Jakob erzählt in diesem Buch von 15 wahren Hundehelden-Taten – jede einzelne davon unglaublich und berührend!
Mit wunderschönen Illustrationen von Sarah Heuzeroth.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Hunde sind nicht nur des Menschen beste Freunde und tierische Familienmitglieder, sie dienen uns auch unaufhörlich. Jeden Tag machen sie zuverlässig ihren Job, sei es als Jagdhelfer, Herdenschützer, Drogenschnüffler, Blindenführer und noch vieles andere mehr. Meist arbeiten sie dabei im Stillen, von der Öffentlichkeit unbemerkt. Doch manchmal wachsen sie über sich hinaus. Dann werden sie zu Helden und retten Leben. So wie Swansea Jack, ein Mischling aus Neufundländer und Flat Coated Retriever, der als Rettungsschwimmer mindestens 27 Menschen aus dem Wasser zog. Oder wie Togo, ein Husky, der tagelang durch Schneestürme rannte, um eine Stadt in Alaska mit Medikamenten zu versorgen.
Katharina Jakob erzählt in diesem Buch von fünfzehn wahren Hundehelden-Taten – jede einzelne davon unglaublich und berührend!
Autorin
Katharina Jakob ist Wissenschaftsjournalistin und Buchautorin. Sie schreibt für P.M. und Geo. Auch in Natur, Die Zeit und Dogs hat sie Beiträge veröffentlicht. Zudem ist sie Mitglied bei den Riffreportern, einem Online-Magazin von freien Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten. Ihre Fachgebiete sind vor allem die Erforschung der tierischen Intelligenz und die Mensch-Tier-Beziehung.
Katharina Jakob
Hundehelden
Fünfzehn Geschichten von außergewöhnlichen Hunden und ihren unglaublichen Taten
Mit Illustrationen von Sarah Heuzeroth
Alle Informationen in diesem Buch wurden von der Autorin und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autorin beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe Oktober 2025
Copyright © 2025: Mosaik Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktion: Birthe Vogelmann
Umschlag: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: © Sarah Heuzeroth
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
LG ∙ MW
ISBN 978-3-641-33142-9V001
www.mosaik-verlag.de
Für Merle
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Togo
und die Rettung einer Stadt
Roselle
und der Horror von 9/11
Jo-Fi
Die rechte Pfote von Sigmund Freud
Bo
Ein großes, großes Spiel
Judy
Retten und gerettet werden
Pickles
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort
Red Dog
Ich war überall, mein Freund
Chaser
Das Genie
Killer
Beschützer der Nashörner
Rin-Tin-Tin
Der Hund, der niemals stirbt
Weela
und ihr siebter Sinn
Nora
Die Lebensretterin am Berg
Bobbie
Der Wunderhund
Lucca
An vorderster Front
Swansea Jack
Der Rettungsschwimmer von Wales
Die Quellen
Danke
Vorwort
Während der Arbeit an diesem Buch starb meine Hündin Merle. Sie wurde etwa 15 ½ Jahre alt. Ihr genaues Alter weiß ich nicht, weil sie ein Hund aus dem Tierschutz war. In ihren jungen Jahren hatte sie jemand auf einem Wanderparkplatz zurückgelassen. Ich schreibe das, weil dieses Buch von Hundehelden handelt und Merle meine persönliche Heldin war.
Als sie zu uns kam, litt sie unter unfassbaren Ängsten. Eine schnelle Bewegung reichte schon aus, und sie schrie. Doch von Anfang an brannte etwas in ihr, das stärker war als Angst: unbändige Lebensfreude.
Ich sah, wie sie sich vor allem Neuen fürchtete und wie sie trotzdem genau dort hinwollte, weil sie so neugierig war. In ihrer Erregung gab sie Töne von sich, wie ich sie noch nie von einem Hund gehört habe. Sie konnte aus Angst wie ein Vogel zwitschern, wenn sie vor einer Holzbrücke stand, die sie nicht kannte. Und dann setzte sie eine Pfote auf den Steg, zog die nächste nach, ging hinüber, am ganzen Leib zitternd. Aber sie ging. Kaum war sie auf der anderen Seite, sprang sie herum wie ein Pony. Lachte mich an. Hopste an mir hoch. Ich hörte sie förmlich jubeln: Ich hab es geschafft! Siehst du, ich hab es geschafft! Hab ich das nicht toll gemacht?
»Das hast du ganz toll gemacht«, sagte ich dann und nahm sie in den Arm. Sie drückte sich an mich, schleckte mir über die Nase und stürmte wieder los: schnüffeln, stöbern, weiterziehen.
Merle war der tapferste Hund, der mir je begegnet ist. Ich verneige mich vor ihrem Mut, der ihr erlaubte, ihr langes Leben in vollen Zügen zu genießen, auch wenn die Angst sie nie ganz verließ.
Und ich verneige mich vor allen Hunden in diesem Buch, die ihrerseits Helden waren oder sind. Bo, der Spürhund mit der fantastischen Nase, der vermisste Kinder findet oder alte verwirrte Menschen, hat auch Angst vor allem Neuen. »Er ist ein Schisser«, sagte sein Partner Sergeant David Rowland vom Gastonia Police Department in North Carolina. Doch er sagte das mit einer so zärtlichen Stimme, mit einem so großen Lächeln, dass klar war: Bo darf Angst haben, und er bekommt alle Zeit, die er braucht, um sie zu überwinden.
Alle Hunde in diesem Buch hatten oder haben Menschen an ihrer Seite, auf die Verlass ist. Die sie halten, stützen, motivieren und ihnen so die Möglichkeit geben, Großes zu leisten. Während der Arbeit an diesem Buch habe ich gelernt, dass Heldentaten nicht von allein kommen. Sie entstehen im Team. Selbst der notorische Vagabund Red Dog, der das westliche Australien auf eigene Faust durchstreifte, konnte sich darauf verlassen, dass immer jemand da war, wenn er Hilfe brauchte.
Das Band zwischen Hund und Mensch gehört für mich zum Größten, Wertvollsten und Erstaunlichsten, was es auf der Welt gibt. Ich fühle mich geehrt, von so vielen Helden umgeben zu sein. Es sind viel mehr als nur fünfzehn.
Einleitung
Hunde dienen uns unaufhörlich. Jeden Tag machen sie zuverlässig ihren Job, sei es als Blindenführer, Herdenschützer, Jagdhelfer, Drogenschnüffler und noch vieles andere mehr. Meist arbeiten sie dabei im Stillen, von der Öffentlichkeit unbemerkt. Manchmal jedoch wachsen sie über sich hinaus. Dann werden sie zu Helden und retten Leben.
So wie Swansea Jack, der als Rettungsschwimmer 27 Menschen aus dem Wasser zog. Oder der Schlittenhund Togo, der tagelang durch Schneestürme rannte, um eine Stadt in Alaska mit Medikamenten zu versorgen. Oder Roselle, die ihren blinden Halter durch das brennende World Trade Center führte – über insgesamt 1463 Stufen hinunter ins Freie, kurz bevor das Gebäude in sich zusammenbrach.
Andere Hunde retten keine Menschen, sondern Filmstudios, wie Rin-Tin-Tin, ohne den es die Warner Bros. heute nicht gäbe. Sie brechen Rekorde, schlagen sich mehr als 4000 Kilometer quer durch die USA, um wieder heimzukommen, zurück zu ihren Familien. Sie bringen Nashornwilderer hinter Gitter und revolutionieren die Forschung.
Was in aller Welt lässt Hunde solche Leistungen vollbringen?
Das Schlüsselwort ist: Bindung.
Hund und Mensch gehören unterschiedlichen Spezies an. Und doch binden sie sich in einer Weise aneinander, wie es sie kein zweites Mal auf Erden gibt, nicht unter verschiedenen Arten. Wir betrachten Hunde als unsere Familienmitglieder und trauern um sie wie um enge Angehörige. Vor Kurzem ermittelte ein ungarisches Forschungsteam in einer aufwendigen Studie den Charakter der Hund-Mensch-Verbindung. Das Ergebnis: Sie ist eine Mischung aus Eltern-Kind-Beziehung und bester Freundschaft, nur dass sie weniger Konflikte mit sich bringt. Und manchmal macht sie sogar zufriedener. So wurde die Unterstützung, die Hunde uns geben, von den rund 700 Studienteilnehmenden mehrheitlich höher bewertet als die Hilfe der meisten ihnen nahestehenden Menschen. Dabei sind die Befragten keine Misanthropen. Der größte Teil gab an, gute, stabile Beziehungen mit ihresgleichen zu führen.
Für Hunde wiederum sind wir zum wichtigsten Sozialpartner geworden, wir sind ihm sogar wichtiger als seine eigene Art. Einsame Welpen in einem Raum lassen sich von Menschen schneller beruhigen als von anderen Hunden. Erwachsene Tierheimhunde binden sich schon nach wenigen Minuten des Kennenlernens stärker an eine Person als an einen Artgenossen.
Einer der Gründe für dieses enge Band liegt in unserer langen gemeinsamen Geschichte. Nach heutigem Wissensstand begann die Domestikation des Hundes vor mindestens 17 000 Jahren. Und das ist konservativ geschätzt. Gut möglich, dass sie noch viel weiter zurückreicht, bis zu 40 000 Jahre vor unserer Zeit. Schaf und Ziege, unsere nächstältesten Haustiere, folgten erst mit weitem Abstand. Sie leben seit etwa 11 000 Jahren in menschlicher Obhut: als Menschen sesshaft wurden und mit dem Ackerbau begannen.
Unsere Vorfahren hingegen, die sich den Wölfen zuwandten, zogen noch als Jäger und Sammler durch die Lande. Wie genau sich diese Annäherungen abspielten, wissen wir bis heute nicht. Eine finnische Forschungsarbeit aus dem Jahr 2021 geht davon aus, dass die Menschen der letzten Eiszeit das Fleisch aus ihren Jagdzügen, das sie nicht verwerten konnten, an Wölfe verfütterten. Und damit die Tiere zunächst an sich gewöhnten, um sie danach zu zähmen und zu domestizieren, in einem jahrtausendelangen Prozess der genetischen Veränderung. Bis aus dem wilden Wolf ein Tier entstand, das an die Lebensweise des Menschen angepasst war und ihm zur Hand gehen konnte: als Lastentier, Jagdhelfer und als Wächter des Lagers.
Heute sprechen Forschende von einer Co-Evolution: Hund und Mensch haben sich zusammen weiterentwickelt, zu ihrem gegenseitigen Nutzen. Ohne diese Tiere hätten wir nicht alle Regionen des Planeten besiedeln können. Vor allem die arktischen Gebiete wären uns verschlossen geblieben. Wir brauchten Hunde, die Schlitten zogen und Jäger zu den Robbenlöchern brachten.
Aber es ist nicht nur die Dauer dieser Gemeinschaft, die beide Arten zusammengeschweißt hat, es ist auch ihre Intensität. Hunde übernehmen für uns Aufgaben in einer Bandbreite, wie sie kein anderes Tier leisten könnte. Die meisten dieser Jobs erfordern eine enge Kooperation mit dem Menschen. Hüte- und Treibhunde folgen nicht nur den stimmlichen Kommandos der Hirtinnen und Hirten, sie lesen auch Handzeichen und reagieren auf Augenbewegungen. Servicehunde warnen ihre Menschen vor epileptischen Anfällen, helfen ihnen durch Posttraumatische Belastungsstörungen hindurch oder ermöglichen ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Während der Ursprung der Domestikation noch immer ein Rätsel ist, kennen wir umso besser das Ergebnis. Heraus kam ein Tier, das sich zum besten Menschenkenner entwickelt hat, den es gibt, abgesehen von unserer eigenen Art. Der Hund schlägt den Menschenaffen um Längen – immerhin unser nächster Verwandter im Tierreich –, wenn es darum geht, unsere Emotionen zu deuten. In menschlichen Gesichtern liest er wie in einem Buch. Er kann unsere Absichten durchschauen und auch unterscheiden, ob jemand wirklich etwas weiß oder nur blufft. Er kann einschätzen, was wir hören und was nicht. Ein Hund erkennt uns allein an unserer Stimme, selbst wenn die nur vom Band kommt und mit ähnlich klingenden Stimmen abgespielt wird.
Mit anderen Worten: »Hunde sind das Einhorn unter den Arten, wenn es um die Interaktion mit Menschen geht.« Das sagte der Verhaltensforscher John W. Pilley, der bis zu seinem Tod mit Chaser lebte und arbeitete, dem klügsten bekannten Hund der Welt. Chaser hat die Verhaltensforschung revolutioniert. Sie konnte etwas, das zuvor niemand einem Hund zugetraut hatte: Sie verstand die Bedeutung von Wörtern. Von 1022 Spielzeugen kannte sie jedes einzelne mit Namen und fischte es aus einem Berg anderer Gegenstände heraus. In ihren letzten gemeinsamen Jahren brachte John Pilley ihr sogar die Anfänge des Satzbaus bei. Chaser lernte, dass nicht nur die Wörter selbst, sondern auch ihre Reihenfolge in einem Satz von Bedeutung sind. Dass es also einen Unterschied macht, ob man einen Ball neben einen Teddy legt oder den Teddy neben einen Ball.
Das bewirkt Bindung – wenn sie so tief ist wie die zwischen Hund und Mensch. Deshalb gehen Hunde für uns bereitwillig an ihre Grenzen und viele Male auch darüber hinaus. Sie werden zu Helden oder vollbringen Meisterleistungen. Sie sind es wert, dass ihre Geschichten erzählt werden.
Togo
und die Rettung einer Stadt
»Wir sind Gefangene in einem Kerker aus Eis und Schnee. Das letzte Boot ist weg. Dieser kleine Ort ist jetzt sich selbst überlassen. Wir sind allein im Sturm, in der Dunkelheit und in der Kälte des Nordens.« Nome Chronicle, 1925
Die Hunde hecheln im Takt. Togo, der Leithund, führt sie durch die Nacht. Er nimmt Kurs auf den Norton Sound, die gefährlichste Etappe der ganzen Route. Dort geht es direkt über das Meer, das Eis gilt als extrem tückisch. Seit Stunden heult ein Schneesturm, die Temperatur sinkt stetig, erreicht minus 34 Grad Celsius, sinkt weiter. Der Schlittenhundeführer Leonhard Seppala weiß, dass sie verloren sind, wenn Togo sich jetzt irrt. Sie laufen seit vielen, vielen Stunden.
Dies ist die Geschichte eines Schlittenhundes, der mithalf, eine Stadt vor dem Tod zu bewahren. Im Januar 1925 grassierte in Nome im äußersten Nordwesten Alaskas die Diphtherie. Die Stadt brauchte dringend ein Serum gegen die Seuche. Täglich stieg die Zahl der Erkrankten, vor allem die Kinder starben, manche innerhalb von wenigen Stunden. Doch Nome war vom Eis umschlossen, kein Schiff, kein Flugzeug gelangte dorthin. Noch nicht einmal Straßen gab es. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten nur eine Chance: Schlittenhunde, die ihnen das Serum brachten. So wie Togo einer war, der als Leithund mit seinem Gespann die längste und gefährlichste Etappe übernahm. In nur vier Tagen rannte er 420 Kilometer. Trotz seines fortgeschrittenen Alters von zwölf Jahren.
Hundeland Alaska
Dabei grenzt es an ein Wunder, dass Togo überhaupt Schlittenhund wird. Als Welpe sortiert Leonhard Seppala ihn aus. Seppala ist ein berühmter Musher in Alaska, wie die Schlittenhundeführer genannt werden. Seine Tiere züchtet er selbst. Aber dieser Kleine da, dieser Togo, taugt nichts. Er ist kränklich und zugleich rauflustig. »Der soll mal Schoßhündchen werden, als Schlittenhund ist er nicht zu gebrauchen«, sagt der Musher eines Abends zu seiner Frau. Und es stimmt: Togo ist angeschlagen. Immer wieder leidet er an Halsentzündungen. Wenn sich sein Rachen infiziert, kann er kaum atmen. Seppalas Frau Constance macht dem Welpen dann Halswickel und wiegt ihn im Arm, damit er leichter Luft bekommt. Doch was soll so ein Tier im Haus eines Mushers? Schlittenhunde müssen stundenlang laufen können und ein hohes Tempo halten. Während sie rennen, atmen sie die klirrend kalte Luft ein, von minus zwanzig Grad oder noch kälter. Zughunde können also nur gesunde, robuste Tiere sein, die vor Kraft strotzen. Im Alaska der 1920er-Jahre sind sie die wichtigste Verbindung zur restlichen Welt, sobald der Winter anbricht. Und der dauert so nah am Polarkreis sieben Monate lang.
Vor allem Nome ist abhängig von seinen Hunden. Um 1920 liegt keine Stadt auf dem amerikanischen Kontinent nördlicher als diese. Sie befindet sich isoliert am Rand der Beringsee, ohne eine Verbindung über Land. Im Oktober verlässt das letzte Versorgungsschiff den Hafen und kommt erst im späten Frühjahr wieder. Wer in dieser Zeit des Stillstands etwas braucht, muss den Schlittenhunde-Trail nutzen, der von Nome bis zu den ersten eisfreien Häfen führt. Deshalb besitzt nahezu jeder der 1430 Einwohner ein eigenes Gespann. Die Hunde sind meistens Huskys oder Malamutes. Sind sie nicht im Einsatz, stromern sie frei durch die Stadt. Sie bevölkern die Front Street, lungern vor den Geschäften herum, streunen über den Strand, jaulen die Nächte hindurch. Aber niemand stört sich daran, die Tiere haben Narrenfreiheit. Mehr noch: Sie genießen Respekt. Wer abfällig über einen Leithund spricht, muss mit Handgreiflichkeiten rechnen. Ein Anwalt aus Nome erwirkt sogar einen Freispruch für seinen Husky, der 28 Schafe gerissen hat. Alaska sei nun mal ein Hundeland, urteilt das Gericht. Die Schafe müssten auf sich selbst aufpassen.
Dass Nome so hundenärrisch ist, liegt nicht zuletzt an der Entstehung der Stadt. Sie blüht auf in den Zeiten des Goldrauschs, im nahen Flusslauf werden Goldnuggets gefunden. Doch ohne Hunde keine Boomtown. Sie transportieren Menschen, Frachtgüter, die Post. Und oft genug retten sie Leben. Sei es, dass jemand sich im Schneesturm verläuft und gefunden werden muss. Sei es, dass ein Musher sich irrt und ein falsches Kommando gibt. Ein guter Leithund muss den Befehl ignorieren und selbst entscheiden. Denn nur er kann spüren, wie brüchig das Eis unter den Pfoten ist oder an welcher Stelle sich Schollen lösen. Er ist das Gehirn des Gespanns und bringt es sicher nach Hause. Wer ein solches Tier besitzt, platzt fast vor Stolz. Um nichts in der Welt würde er es hergeben.
Der Hundeflüsterer irrt sich
So einen Leithund hätte auch Leonhard Seppala gut gebrauchen können. Die Tiere, die jetzt seine Gespanne anführen, kommen allmählich in die Jahre. Stattdessen wird 1913 Togo geboren, als einziger Welpe des Wurfs. Die Seppalas leben mit ihrer kleinen Tochter und drei Dutzend Sibirischen Huskys einige Kilometer außerhalb von Nome. Der Musher fährt Rennen, von denen er die meisten gewinnt. Aber noch ist er nicht der »König der Trails«, wie man ihn später nennen wird. Denn Seppala hat zwar einen siebten Sinn für Hunde, doch im Jahr 1913 lässt der ihn erst einmal im Stich. Stirnrunzelnd blickt der Musher auf Togo. Was ist nur los mit diesem Tier?
Kaum spannt Seppala die anderen Huskys vor den Schlitten, dreht der Kleine durch. Er attackiert den Leithund, der schon im Geschirr dasteht, beißt ihm in die Ohren, in die Hinterläufe, bringt die anderen dazu, sich in den Leinen zu verheddern. Bis Seppala eines Tages die Geduld verliert und Togo zu einer Bekannten bringt, die sich ein Haustier wünscht. Ein guter Platz, denkt Seppala. Dort kann der Hund vor dem Kaminfeuer liegen und sich den Bauch kraulen lassen. Muss keinen Schlitten ziehen, keine anderen Tiere dulden und wird seine Halsschmerzen los.
Doch Togo hat ein Problem, das Seppala, der Hundeflüsterer, nicht sieht: Er ist dramatisch unterfordert. Keine drei Wochen später bricht er aus seinem neuen Zuhause aus. Er springt durch das geschlossene Fenster im Erdgeschoss und rennt die ganze Strecke zu Seppala zurück, und das sind etliche Kilometer. Mit blutendem Gesicht und Glasscherben in den Pfoten. Der Musher traut seinen Augen kaum, als er den verletzten Hund vor der Haustür findet. Aber er schickt ihn nicht wieder weg. In sein Tagebuch schreibt er: »Wer seiner Familie so ergeben ist, hat es verdient zu bleiben.«
Wochen später wagt Seppala ein Experiment. Er streift dem Junghund ein Geschirr über und spannt ihn vor den Schlitten, direkt vor die Kufen, wo er Togo am besten im Blick hat. Für ein so junges Tier ist das eine unmögliche Position. Hier laufen die wheel dogs, die stärksten und größten Hunde, die am meisten Kraft haben. Ein Husky von acht Monaten kann das nicht leisten. Aber in Togo vollzieht sich eine eindrucksvolle Verwandlung. Kaum trägt er das Geschirr, wird er ruhig. Er bleibt auch reglos stehen, als Seppala die Leinen befestigt. Und dann, auf Kommando, läuft er los mit dem Gespann. Zieht konzentriert den Schlitten und macht alles richtig. Hält die Schleppleine straff gespannt, bleibt in der Spur, setzt seine Hinterpfoten genau in den Abdruck der vorderen. Und da endlich begreift der Musher, wen er vor sich hat: den perfekten Schlittenhund.
Im Lauf dieses Trainings korrigiert Seppala mehrmals Togos Position. Der Hund rückt im Gespann immer weiter nach vorn. Bis er schließlich an der Spitze läuft, als Leithund. Insgesamt rennt Togo an seinem ersten Tag wahnwitzige 125 Kilometer, und immer noch will er weiter. Dabei gelten schon 48 Kilometer als anspruchsvolle Tagesleistung. Seppala hinter dem Schlitten ist starr vor Verblüffung. »Das ist der geborene Leithund«, schreibt er am Abend in sein Tagebuch.
Zu viele Mandelentzündungen
Im Winter 1924 bricht in Nome die Diphtherie aus, zunächst unbemerkt. Curtis Welch ist fünfzig Jahre alt und der einzige Arzt der Gegend. Der nächste befindet sich knapp 650 Kilometer weiter südlich. In seinem kleinen Krankenhaus arbeitet er mit vier Krankenschwestern zusammen, die sich mit seiner Einsilbigkeit arrangiert haben. Denn Welch ist menschenscheu, Gespräche strengen ihn an. Doch als Arzt ist er tüchtig. Jeden Sommer geht er akribisch die Medikamentenbestände und Materialien durch und bestellt in der Hauptstadt Juneau nach, was ihm fehlt. So auch im Juli 1924. Das Serum gegen die Diphterie muss dringend aufgestockt werden. Im Vorratsschrank stehen nur noch Restbestände, und die sind abgelaufen.
Pünktlich hat das letzte Versorgungsschiff im Oktober alles mitgebracht, was auf Welchs Liste stand, die Arzneien, die Tupfer, den Äther, die Zungenspatel. Bloß nicht das neue Serum. Aus unerfindlichen Gründen ist es nicht mitgekommen. Welch ist zwar beunruhigt, aber er weiß auch, dass er in seinen achtzehn Jahren als Arzt in Nome noch nie einen Diphtheriefall erlebt hat. Und so wird es auch diesmal sein.
Dann häufen sich die Mandelentzündungen, ausgerechnet vor Weihnachten. Und stets sind Kinder betroffen. Da ist das siebenjährige Mädchen, das in einem bedenklich entkräfteten Zustand ist und sehr hohes Fieber hat. Welch macht sich Sorgen wegen der vielen Kinderfeste, die in Nome Tradition haben. Die Kleinen scharen sich um Santa Claus und werden mit Süßigkeiten beschenkt, singen in Schulchören und in der Festhalle. Nach den Feiertagen wird er reichlich zu tun haben.
Und genau so kommt es, nur sehr viel schlimmer als befürchtet. Vier Tage nach Weihnachten ist das kleine Mädchen tot. Um Neujahr sterben zwei weitere Kinder. Wenn Welch mit seinem Arztkoffer eintrifft, kann er schon an der Tür feststellen, wie schlimm es um die Kleinen steht. Er riecht den süßlich fauligen Geruch aus ihrem Hals, blickt in ihre hochroten Gesichter, sieht, wie sie um Atem ringen. Aber noch immer denkt er an Mandelentzündungen. Vielleicht ist es auch eine neue Krankheit, die er nicht kennt? Diphtherie darf es nicht sein. Er hat kein Serum gegen diese Seuche, die, wenn sie einmal um sich greift, eine ganze Stadt auslöschen kann.
Mitte Januar endet mit einem Schlag jede Hoffnung. Welch blickt in einen Kinderrachen und erkennt die typischen grauen Beläge der Diphtherie. Wie aus dem Lehrbuch. Auch dieses Kind überlebt nicht. Welch weiß jetzt, dass die Stadt auf eine Epidemie zusteuert und er auf schnellstem Weg frisches Serum braucht. Das, was er im Krankenhaus hat, reicht vielleicht für sechs Patienten – falls es überhaupt noch wirkt.
Der geschockte Gemeinderat verhängt eine Quarantäne über die Stadt. Niemand darf jetzt noch das Haus verlassen, Kirche, Schule, Läden bleiben geschlossen. Welch schickt Telegramme nach Juneau und in die anderen Städte:
»Eine Diphtherie-Epidemie ist fast unvermeidlich STOP
Ich benötige dringend eine Million Einheiten Diphtherie-Antitoxin STOP«
Doch selbst wenn sich in Windeseile so viel Serum zusammentragen ließe: Wie könnte es nach Nome gelangen, und vor allem wann? Welch und die Mitglieder des Gemeinderats rechnen aus, wie lange ein Hundeschlitten unterwegs wäre. Es ist niederschmetternd. Von der letzten Bahnstation bis nach Nome sind es noch 1085 Kilometer. Ein Gespann braucht rund 25 Tage für diese Strecke. Doch so viel Zeit hat die Stadt nicht.
Es muss anders gehen.
»Leonhard Seppala«, sagt ein Mitglied des Gemeinderats. Und: »Eine Hundestaffel.«
Der Plan zur Rettung
Im Januar 1925 ist Leonhard Seppala 47 Jahre alt und der bekannteste Musher Alaskas. Er gilt nun als »König des Trails«, weil er alle anderen Schlittenhundeführer an Schnelligkeit übertrifft. Doch das gelingt ihm erst, seitdem Togo sein Leithund ist. Der inzwischen alte Husky hat sich den Ruf einer Legende erarbeitet. Selbst mit zwölf Jahren ist er noch immer bärenstark, schnell und hellwach. Auch besitzt er ein extremes Gespür für den Trail. Kein anderer Hund, von dem Seppala weiß, kann so zuverlässig Gefahren wittern. Mit Togo bricht der Musher einen Rekord nach dem anderen, vor allem auf Marathonstrecken. Fast 90 000 Kilometer sind sie miteinander gelaufen. Der Leithund kennt jede Geländeformation in Alaska. Er zieht den Schlitten übers Gebirge und durch die Totenstille des Landesinneren, das in manchen Wintern wie unter einem Leichentuch liegt, vor allem dann, wenn ein sogenannter Whiteout auftritt. Dann breitet sich fahlweißer Dunst aus, Himmel und Erde verschwimmen in eins, Landmarken lösen sich auf, und man fährt wie durch Milch. Ein Mensch kann darin komplett die Orientierung verlieren. Togo aber riecht die Fährte der anderen Hunde, die vor ihm den Trail genommen haben, und läuft wie auf Schienen.
Und dann sind da die Routen übers vereiste Meer. Nome liegt am Norton Sound, einem Arm der Beringsee. Die meisten Musher gehen kein Risiko ein und wählen den Weg längs der Küste, nicht die Überquerung. Denn das Eis auf dem Sound gilt als kaum berechenbar. Es kann jäh in Schollen zerbrechen, die aufs Meer hinaustreiben, wenn der Wind ablandig weht. Befindet sich ein Gespann in solchen Momenten auf einer Scholle, sitzt es in der Falle. Wie eine Robbenkolonie treiben Mensch und Hunde Richtung Ozean, unfähig, den immer größer werdenden Spalt zwischen Eis und Wasser zu überwinden. Alles, was ihnen bleibt, ist die Hoffnung, dass der Wind wieder dreht und sie an Land zurückschiebt.
Doch Seppala und Togo kürzen stets über den Norton Sound ab, wenn der Hund anzeigt, dass das Eis begehbar ist. Instinktiv findet er die einfachste und zugleich sicherste Route. Auf dem Norton Sound übernimmt Togo die Führung, und es ist ganz egal, wie alt er inzwischen ist: Seppala hat die Gewissheit, dass ihm und den anderen Hunden nichts geschehen wird, solange Togo an der Spitze läuft.
Startschuss
Es ist so weit. Der Plan steht. Statt eines Gespanns, das mehr als drei Wochen bis Nome braucht, werden viele Musher die Strecke in Etappen abfahren. So kann das Serum ohne Unterbrechung weitergereicht werden, Tag und Nacht, und die Transportzeit verkürzt sich auf etwa acht bis zehn Tage. Eine bessere Option haben sie nicht.
Wirklich nicht? Den Bürgermeister treibt eine kühne Idee um. Mit einem Flugzeug, das aus Fairbanks startet, wäre das Serum in sechs Stunden in Nome. Sechs Stunden! Wie viele Menschenleben könnten gerettet werden, vor allem die von Kindern. Die Seuche käme zum Erliegen, bevor sie richtig um sich greift. Auch hat es im Winter bereits einen Testflug nach Nome gegeben. Es wäre eine Möglichkeit, theoretisch.
Aber nicht in der Realität. Im Januar 1925 liegt ein arktisches Hochdruckgebiet über dem Landesinneren von Alaska und beschert der Region die schlimmste Kälte seit fast zwanzig Jahren. Und noch immer sinkt das Thermometer. Es zeigt bisweilen schon Minusgrade von siebzig Grad Fahrenheit an, das sind etwa 56 Grad Celsius unter null. Ein Flugzeug-Cockpit steht aber offen, der Pilot sitzt im Freien. Eine Unmöglichkeit bei dieser Kälte. Der Testflug fand damals bei milden Temperaturen statt und war sehr kurz. Welcher Pilot übernähme so ein Himmelfahrtskommando? Und was, wenn ein Schneesturm losbricht? Keine Seltenheit an der Küste der Beringsee. Stürzt die Maschine ab, ist das Serum verloren und mit ihm Nome.
Der Bürgermeister wird überstimmt, die Hundestaffel in Gang gesetzt. Nenana liegt im Osten des Landes, dort endet die Bahntrasse. Bis dahin lässt sich das Serum per Zug verschicken. Ein gutes Dutzend Schlittenhundeführer soll an festgelegten Streckenposten warten und die Sendung etappenweise nach Nulato bringen, eine Stadt schon weit im Westen. Dort wartet dann hoffentlich Leonhard Seppala. Er wird sich von Nome aus nach Nulato vorarbeiten, während die Staffel ihm von Osten entgegenkommt. Weil er der schnellste aller Fahrer ist, übernimmt er knapp die Hälfte der Strecke. Rund 350 Kilometer sind es von Nome bis nach Nulato. Sobald Seppala das Serum hat, muss er auf gleichem Weg wieder zurück. Das ist nicht nur die längste Etappe von allen, sondern auch die riskanteste. An der Küste gerät er womöglich in einen Blizzard, seit Tagen schon kündigt sich der Schneesturm an. Und dann geht es auch noch über das Meereis des Norton Sounds.
Es ist ein tollkühner Plan, und jeder weiß es. Aber Seppala ist sich seiner Sache sicher und rechnet mit acht Tagen Fahrt für sich und sein Gespann. Wenn alles gut geht, kann er Doktor Welch in rund einer Woche die Ampullen in die Hand drücken.
Damit fällt der Startschuss für das, was später als »Serum Run to Nome« in die Geschichte eingehen wird. Und wie so oft in der Geschichte wird es nicht der Held sein, der am Ende die Lorbeeren erntet. Sondern der Glückliche, der zur rechten Zeit am rechten Ort ist. Mit einem Wort: der falsche Hund.
Planänderung
Am Abend des 27. Januar trifft das Serum wie vorgesehen an der Bahnstation von Nenana ein. Wie gefährlich das ganze Unterfangen ist, zeigt sich gleich bei der ersten Etappe. Ein Musher namens Bill Shannon hat die Ladung übernommen und fährt direkt los, mitten hinein in die arktische Nacht. 84 Kilometer liegen vor ihm, und er überlebt sie nur knapp. Die extreme Kälte raubt ihm fast das Bewusstsein. Immer wieder taumelt er vor den Hunden her, um warm zu werden, und spürt doch, dass sein Körper schneller auskühlt, als er ihm Wärme zuführen kann. Nur mit äußerster Willenskraft widersteht er der Versuchung, sich in den Schnee zu legen, um einzuschlafen. Mit schweren Frostschäden im Gesicht erreicht er sein Ziel. Auf dem Schlitten liegen sterbend drei seiner Hunde. Ihre Lungen haben sich mit Blut gefüllt.
Eine Regel besagt, dass ab minus vierzig Grad Celsius kein Schlittenhund mehr laufen soll. Die Gefahr von Lungenschäden wird dann zu groß. Aber die Hunde der Staffel sind einer noch weit grimmigeren Kälte ausgesetzt, manchmal bis zu fünfzig Grad Celsius unter null. Einige Tiere werden den Rettungseinsatz nicht überleben, nicht nur die drei von Bill Shannon.
Doch am Morgen des 27. Januar ist Leonhard Seppala guter Dinge, als er mit zwanzig Huskys Nome verlässt. Tief im Schlitten verborgen liegt der Proviant für die Hunde, getrockneter Lachs. Für ihn hat seine Frau gekochte Bohnen, Hackfleisch und Zwieback eingepackt. Der Schlitten ist nur leicht beladen, um schneller voranzukommen. Trotz der Quarantäne findet sich auf der Front Street eine kleine Menschenmenge ein, die dem Gespann zuwinkt, als es in Richtung Strand fährt. Dort beginnt der Trail. In Nome sind die Temperaturen noch erträglich, etwa minus 29 Grad Celsius. Und die Hunde laufen wie Nähmaschinen in einem gleichmäßigen Takt. Allein der aufziehende Blizzard macht Seppala Sorgen. Sie sollten nicht auf dem Norton Sound sein, wenn er losbricht.
Aber auch hinter ihm braut sich etwas zusammen. In Nome zählen sie inzwischen 28 an Diphtherie Erkrankte und fünf Tote. Die Restbestände des abgelaufenen Serums sind aufgebraucht, und Curtis Welch kann das Sterben nur noch lindern, nicht mehr aufhalten. Der Gemeinderat, der Bürgermeister, der Doktor und auch der Gouverneur unten in Juneau erkennen gerade den Webfehler in ihrem Plan. So schnell Seppala und seine Hunde auch sein mögen, sie können nicht pausenlos laufen, nicht so wie die Staffel. Zwischendurch müssen sie schlafen. Und das sind wertvolle Stunden, die verloren gehen. Kurzerhand wird das Konzept geändert. Seppala soll jetzt nur noch bis Shaktoolik fahren, das ist eine Siedlung auf der anderen Seite des Norton Sounds. Dort soll er das Serum erhalten und wieder umkehren. Stillschweigend gehen die Planer davon aus, dass Seppala dann erneut übers Meereis fährt, eine Strecke, die viele Kollegen kein einziges Mal in ihrem Leben gewagt haben. Sobald Seppala wieder drüben ist, soll eine neue Staffel weitermachen. Zwei Musher werden sich die restlichen 200 Kilometer teilen.
Bleibt das Problem: Wie erfährt Seppala von der Änderung des Plans? Eine telegrafische Verbindung gibt es auf seiner Strecke nicht. Wo er sich im Augenblick befindet, weiß kein Mensch.
Übers Meer
Sie stehen am Ufer des Norton Sounds. Am Morgen des 31. Januar erreichen Seppala, Togo und die anderen Hunde die winzige Siedlung Isaac’s Point. Die Passage über das Meer beginnt hier. Vor ihnen breitet sich das Packeis aus bis zum Horizont. Sie haben knapp 180 Kilometer in vier Tagen zurückgelegt, weniger als gedacht. Sind sie in einen Whiteout geraten? In eine schattenlose Welt aus undurchdringlichem Weiß, das alle Konturen verschluckt? Niemand weiß, was das Gespann aufgehalten hat.
Am Isaac’s Point muss Seppala eine Entscheidung treffen. Sein Leithund hat bereits das andere Ufer im Blick, trotz des aufkommenden Schneetreibens. Togo ist die Ruhe selbst. Doch die swing dogs winseln. Das sind die Hunde, die hinter dem Leithund laufen, energiegeladene, junge Huskys. Aber nichts fürchtet ein Schlittenhund mehr als einen Blizzard mit seinem ohrenbetäubenden Geheul und dem wirbelnden Weiß, das die Welt ringsum verschluckt. Seppala spürt in seinem Rücken, wie der Wind zunimmt. Immer wieder rüttelt eine Bö am Schlitten. Das Hauptproblem ist die Richtung, aus der der Wind weht. Er kommt ablandig aus dem Osten. Das träge Eis hat schon begonnen, sanft zu schaukeln. Wenn sich jetzt Schollen lösen, treibt der Wind sie aus dem Norton Sound hinaus, weg von der Küste.
Der Musher tut, was er schon viele Male getan hat. Er überlässt Togo die Entscheidung. Er stellt sich hinter den Schlitten, gibt das Kommando zum Aufbruch und sieht, wie sich sein Leithund nach vorn wirft. Das Gefährt setzt sich mit einem leichten Rauschen in Bewegung. Togo nimmt Kurs auf den Norton Sound, die anderen Hunde folgen. Es geht über das Meer, so hat es der Leithund beschlossen. Sie haben Rückenwind, sie kommen rasch voran. Immer wieder wirbelt eine Bö den Schnee auf, der über der Eisfläche liegt. Messerscharfe Kristalle fliegen allen in die Augen. Über den Gesichtern der Huskys bilden sich Masken aus Eis.
Auf der anderen Seite des Norton Sounds wartet ein Musher auf Seppala. Das Serum ist tief in seinem Schlitten verstaut. Der Musher heißt Henry Ivanoff und hat die undankbare Aufgabe, Leonhard Seppala abzupassen, der ja nicht weiß, dass er gar nicht mehr bis Nulato fahren muss. Ivanoff wartet außerhalb der Siedlung Shaktoolik mitten auf dem Trail. Und je mehr Zeit verstreicht, desto mehr Zweifel beschleichen ihn an seinem Auftrag. Was, wenn er vergeblich wartet? Seppala ist doch der Schnellste von allen. Gut möglich, dass er bereits vor Stunden hier vorbeigekommen ist und nun längst wieder ostwärts fährt, Richtung Nulato. Das Schneetreiben ist mittlerweile so dicht, dass dem Wartenden die Luft wegbleibt, er atmet Schnee ein, schluckt Schnee, kann kaum die Augen offen halten. Der Blizzard entfaltet sich zu voller Stärke. Sein Heulen dröhnt in den Ohren. Einmal stößt eine Bö ums Haar Ivanoffs Schlitten um. Und da passiert es auch schon. Die Hunde setzen zum Sprung an, weil ein Rentier in nächster Nähe den Weg kreuzt. Die Leinen verheddern sich, die Huskys prallen auf- und ineinander, rollen kopfüber in Schneewehen, ziehen den Schlitten hinterher, der zur Seite kippt und mit ihm das Serum. Es ist ein einziges, riesiges, heilloses Chaos, in das Henry Ivanoff da hineingeraten ist, mitten im Sturm.
Und genau in diesem Moment, als der Musher alle Hände voll zu tun hat, um die Leinen zu entwirren, fährt wie ein Schatten aus dem Nichts Seppala mit seinem Gespann vorbei.
»Halt!«, schreit Ivanoff aus vollem Hals. »Das Serum!!«
Seppala ist schon nicht mehr zu sehen. Noch einmal gellend und mit geballten Fäusten: »Das Serum! Das Serum! Ich hab es hier! Seppala!«
Aus dem wirbelnden Schnee taucht erst Togo auf, dann folgen die anderen Schlittenhunde. Dann der Musher. Er stoppt den Schlitten und kämpft sich durch die Böen vor zu Ivanoff, der noch immer aus Leibeskräften brüllt.
Togo rennt
Bislang haben die Ampullen mit dem Antitoxin die rasende Fahrt und alle hektischen Wechsel, das Auftauen in den Wärmestuben und das erneute Einfrieren unterwegs ohne Bruch überstanden. Jetzt liegen sie unter dem schwindenden Proviant für die Hunde in Seppalas Schlitten, dick in Felle gewickelt.
Vielleicht ist es klug, denn der Blizzard bläst weiter von Osten, bald wird das Packeis gar nicht mehr befahrbar sein. Vielleicht ist es aber auch nur blanker Wahnsinn: Seppala wendet das Gespann wieder in Richtung Norton Sound, will sofort zurück. Er weiß, wie erschöpft die Hunde sind. Seit Nome sind sie 275 Kilometer gelaufen, mit nur wenigen kurzen Unterbrechungen. Seit dem frühen Morgen hatten sie gar keine Pause mehr. Ein bisschen Schlaf in Shaktoolik würde ihnen guttun. Auch zerrt das Tosen des Schneesturms an ihren Nerven. Einer der Hunde stemmt die Vorderpfoten beim Wenden in den Schnee, will nicht weiter. Seppala blickt in seine aufgerissenen, verzweifelten Augen. Aber Henry Ivanoff hat berichtet, wie schlimm es um Nome steht. Und dass es deshalb eine Änderung im Ablauf gegeben hat und Seppala gar nicht mehr nach Nulato fahren soll. Sondern sofort wieder zurück.
Nome hat keine Zeit zu verlieren.
Die Hunde sind am Ende ihrer Kraft.
Der Schneesturm. Die Nacht. Das hinaustreibende Packeis.
Zu Hause die fiebernden Kinder.
Seppala hat eine kleine Tochter namens Sigrid. Sie ist acht Jahre alt. Das größte Risiko, an der Diphtherie zu sterben, tragen Kinder von ein bis zehn Jahren.
Der Musher holt aus dem Schlitten getrockneten Lachs. Zerbeißt ihn in Stücke, füttert jeden einzelnen Hund aus der Hand und redet beruhigend auf ihn ein. Die Tiere kauern jetzt im Schnee, haben ihre Ruten über die Schnauzen gelegt, nehmen mit schimmernden Zähnen das Futter entgegen. Sie schmatzen. Und dann legt sich ganz allmählich so etwas wie Gelassenheit über das Rudel.
Was macht der Leithund? Er zeigt keinerlei Regung.