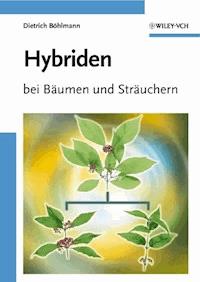
43,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Kreuzungen zwischen verschiedenen Arten gibt es nicht nur im Tierreich (wie Maultier, Maulesel), sondern auch in hohem Maße bei den Holzgewächsen. Lange wurden die Hybriden aus den gängigen Gehölzführern ausgeklammert, obwohl sie so essentiell für die Forstwirtschaft und den Gartenbau sind. Auf diesem Gebiet ist dieses Buch das einzige Werk, das die Erkennungsmerkmale aller 130 Hybridenarten sowie ihrer Eltern tabellarisch auflistet und vergleichend gegenüber stellt. Daher ist eine exakte Bestimmung, auch mit Hilfe des ausführlichen Bildmaterials, garantiert. Jede Hybride wird in ihrer botanischen und forstwirtschaftlichen Bedeutung in einem begleitenden Text beschrieben. Tabellen mit charakteristischen Merkmalen ergänzen die durchgehend farbigen Fotos von Blättern und Früchten. Seinen aktuellen Bezug erhält dieses Übersichts- und Bestimmungsbuch durch seine einzigartige Auflistung und Darstellung aller Hybriden und ihrer Eltern. Es schließt eine wichtige Lücke in der gartenbaulichen und forstlichen Literatur, so dass es nicht nur die Bestimmung, sondern auch für die Auswahl und Nutzung der Hybriden für Aufgaben in der Land- und Forstwirtschaft zu Rate gezogen werden kann. Unverzichtbar für jeden Botaniker, Forstwissenschaftler, Pflanzenzüchter und Studenten der Forstwissenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Contents
Wie kommen Hybriden zustande und ihre Benennung
Hybridisierung und ihre Grenzen bei Gehölzen
Teil 1: Arthybriden bei Nadelbäumen
Abies x dahlemensis
Abies x insignis
Abies x vilmorinii
Juniperus x pfizeriana
Larix x eurolepis
Picea x mariorika
Pinus x rhaetica
Pinus x rigitaeda
Pinus x schwerinii
Taxus x media
Teil 2: Gattungshybriden bei Nadelbäumen
X Cupressocyparis leylandii
X Cupressocyparis notabilis
X Tsugapeuce jeffreyi
Teil 3: Gattungshybriden bei Laubgehölzen
X Amelosorbus raciborskiana
X Crataemespilus grandiflora
X Fatshedera lizei
X Mahoberberis aquisargentii
X Mahoberberis miethkeana
X Mahoberberis neubertii
X Sorbopyrus auricularis
X Sycoparrotia semidecandra
+ Crataegomespilus dardarii
+ Crataegomespilus potsdamiensis
+ Laburnocytisus adamii
Teil 4: Arthybriden unter den Laubgehölzen
Acer x campictum
Acer x conspicuum
Acer x rotundilobum
Aesculus x carnea
Aesculus x hybrida
Aesculus x marylandica
Akebia x pentaphylla
Alnus x pubescens
Alnus x spaethii
Aronia x prunifolia
Berberis x frikartii
Berberis x hybrido-gagnepainii
Berberis x media
Berberis x mentorensis
Berberis ‘Red Tears’
Berberis x ottawensis
Berberis x rubrostilla
Berberis x stenophylla
Betula x intermedia
Buddleja x weyeriana
Callicarpa x shirasawana
Caragana x sophoraefolia
Catalpa x erubescens
Chaenomelis x superba
Citrus x paradisi
Colutea x media
Corylus x colurnoides
Corylus x vilmorinii
Crataegus x hiemalis
Crataegus x prunifolia
Daphne x mantensiana
Deutzien
Deutzia x carnea
Deutzia x elegantissima
Deutzia x lemoinei
Deutzia x magnfca
Deutzia x rosea
Deutzia x wilsonii
Forsythia x intermedia
Gaultheria x wisleyensis
Gleditsia x texana
Hamamelis x intermedia
Juglans bixbyi
Juglans x intermedia
Juglans x sinensis
Laburnum x watereri
Ligustrum x ibolium
Liriodendron-Hybride
Lonicera x purpusii
Magnolia x loebneri
Magnolia x soulangiana
Mahonia x media
Mahonia x wagneri
Malus x micromalus
Malus x moerlandsii
Malus x robusta
Malus x soulardii
Malus x zumii
Nothofagus x leonii
Osmanthus x fortunei
Platanus x hispanica
Populus x berolinensis
Populus x canadensis
Populus x canescens
Populus x generosa
Populus x rasumowskiana
Populus x rouleauiana
Populus x wilsocarpa
Hybridaspe
Prunus x amygdalo-persica
Prunus x cistena
Prunus x fontanesiana
Pterocarya x rhederiana
Quercus x deamii
Quercus x heterophylla
Quercus x hickelii
Quercus x hispanica
Quercus x libanerris
Quercus x ludoviciana
Quercus x richteri
Quercus ‘Pondaim’
Quercus x rosacea
Quercus x tabathiana
Quercus x turneri
Quercus x turneri ‘Pseudoturneri’
Ribes x gordonianum
Ribes x succirubrum
Robinia x ambigua
Salix x calliantha
Salix x dichroa
Salix x finmarchia
Salix x friesiana
Salix x holoseriacea
Salix x laurina
Salix x reichhardtii
Salix x rubens
Salix x smithiana
Salix x subaurita
Salix x wimmeriana
Sorbus x hybrida
Sorbus intermedia
Sorbus latifolia
Sorbus x thuringiaca
Syringa x chinensis
Syringa x henryi
Syringa x josiflexa
Syringa x persica
Syringa x prestoniae
Syringa x swegiflexa
Tilia x euchlora
Tilia x moltkei
Tilia x vulgaris
Ulmus x hollandica ‘Dampieri Aurea’
Vaccinium x intermedium
Viburnum x rhytidophylloides
Verzeichnis von aufgefundenen und erzeugten Hybriden bei Gehölzen1)
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Roloff, A.
Bäume
Lexikon der Baumbiologie
Hardcover
ISBN: 978-3-527-32358-6
Roloff, A., Weisgerber, H., Lang, J.
U. M., Stimm, B., Schütt, P. (Hrsg.)
Enzyklopädie der Holzgewächse
Handbuch und Atlas der Dendrologie.
Aktuelles Grundwerk
1994
Loseblattwerk in Ordner
ISBN: 978-3-527-32141-4
Reeg, T., Bemmann, A., Konold,
W., Murach, D., Spiecker, H. (Hrsg.)
Anbau und Nutzung von
Bäumen auf
landwirtschaftlichen Flächen
Prozessorientierte Labortechnik für
Studium und Berufsausbildung
2009
Hardcover
ISBN: 978-3-527-32358-6
Autor
Prof. Dr. Dierich Böhlmann
Emeritierter Ordinarius der Technischen Universität Berlin
Beymestr 8 A
12167 Berlin
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.deabrufbar.
© 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 9783527323838
Epdf ISBN 978-3-527-66144-2
Epub ISBN 978-3-527-66143-5
Mobi ISBN 978-3-527-66142-8
Wie kommen Hybriden zustande und ihre Benennung
Geläufig ist die Bastardkreuzung zwischen Pferd und Esel, aus dem das Maultier hervorgeht, welches als Lastenträger in Gebirgen sehr geschätzt ist. Hybriden im Nutztierbereich gehen aus der Kreuzung ingezüchteter Linien der Art hervor, wie bei Hochleistungshühnern und –Schweinen. Gleiches ist auch üblich bei Mais, Stiefmütterchen und Orchideen. Die Kreuzungen zweier Arten sind demnach Bastarde, entweder interspezifische bei einer Kreuzung von Arten der gleichen Gattung oder intergenerische beim Zustandekommen der Kreuzung von Arten aus verschiedenen Gattungen, was wesentlich seltener gelungen ist, als die Kreuzung nahe verwandter Arten.
Die Kennzeichnung der Bastarde (geläufiger und gebräuchlicher ist das Synonym Hybride und Hybridisation) erfolgt durch das Multiplikationszeichen x.
Handelt es sich um interspezifische Bastarde, so besteht der botanische Name der Nachkommen aus dem Gattungsnamen, einem folgenden x und einem Epitheton (ein Fachterminus für den zweiten Teil des binären wissenschaftlichen Namens).
Beispiel:
Tilia x vulgaris
hervorgegangen aus
Tilia cordata x Tilia platyphyllos
Die Aufführung der Eltern, der Kreuzungspartner, werden, sofern bekannt, in Klammern hinter die Hybride gestellt, wobei alphabetisch verfahren wird (wie oben ausgeführt) oder bei zweihäusigen Arten oder Arten, die vormännlich oder vorweiblich erblühen, die empfangende Mutterart vor den männlichen Pollenspender gestellt bzw. das weibliche Zeichen hinzugefügt. Dazwischen wird noch das Namenskürzel des Züchters oder Benenners eingefügt (vgl. Hybrid-Tabellen)
Sehr oft, vor allem im englischsprachigen Bereich, werden die Hybriden wie Sorten mit einfachen Anführungsstrichen und ohne Nennung der Eltern geschrieben, wie z. B. Berberis ‘Red Tears’. In den Niederlanden wird das kennzeichnende x für Hybriden in Klammern hinter das Epitheton gestellt, wie z. B. Acer conspicuum (x).
Die durch die Hybridisation nicht immer vorhandenen Allelen im Chromosomensatz bedingen sehr oft nur die Erzeugung steriler Samen, es sei denn, es tritt eine Polyploidisierung ein bzw. es werden apomiktisch Samen gezeugt. Die gemischten, u. U. vorteilhaften Anlagen können dann nur durch vegetative Vermehrung weitergegeben werden.
Neueste molekulargenetische Untersuchungen bei polyploiden Rosen der Caninae-Gruppe (Hundsrosen) haben ergeben, dass der ursprüngliche Genomanteil eines Primärbastards allein die Samenerzeugung steuert und dadurch die Hybridsterilität überspielt. Andere, eingekreuzte Genomanteile werden weitergegeben und bleiben dadurch nur an der Merkmalsabänderung beteiligt [1]. Dieser bisher festgestellte einzigartige Vererbungs- und Samenerzeugungsablauf muss nicht einmalig bleiben, was künftige Forschungen an weiteren Hybriden beweisen müssten.
Die gleichen Forscher [2] heben hervor, dass Hybridisierungen im Pflanzenreich mit nachfolgenden Polyploidisierungen im Evolutionsprozess eine gewichtige Rolle spielen (vgl. heutige Getreide und viele weitere Nutzpflanzen) und nicht nur ein Nebeneffekt im Evolutionsfortschritt bilden.
Da aus der Hybridisierung sofort oder später verschiedene Sorten hervorgehen können, wird dem Sammelepitheton eine Sortenbezeichnung angefügt, die in halben Anführungszeichen gesetzt, groß und nicht kursiv geschrieben wird.
Beispiel:
Virburnum x bodnantense ‘Dawn’
hervorgegangen aus
Virburnum farreri x Virburnum grandiflorum
Bei intergenerischen Bastarden wird der botanische Name der Nachkommen im Allgemeinen aus Teilen des Namens beider Elter-Gattungen gebildet, aber das Multiplikationszeichen vorangestellt. Es folgt ein Epitheton.
Beispiel:
X Cupressocyparis leylandii
hervorgegangen aus
Cupressus macrocarpa X Xanthocyparis nootkatensis
Multigenerische Bastarde, d.h. das Kreuzungsprodukt mehrerer Gattungen wie bei Orchideen, sind bei Gehölzen noch nicht erzeugt worden.
Pfropfchimären sind keine geschlechtlich erzeugten Bastarde, sondern kommen aus der Verwachsung zweier erblich verschiedener Pfropfpartner zustande. Gehören die Pfropfpartner derselben Gattung an, so folgt bei botanischer Namensgebung auf den Gattungsnamen ein Pluszeichen.
Beispiel:
Syringa + correlata
hervorgegangen aus
Syringa x chinensis + Syringa vulgaris
Entstammen die beiden Pfropfpartner verschiedenen Gattungen, so wird der Name aus Teilen der Gattungsnamen beider Pfropfpartner gebildet, welchem das Pluszeichen vorangestellt wird und dem ein Epitheton folgt. Er muss sich jedoch von demjenigen abheben, welcher für intergenerische Bastarde gilt, wie beim folgenden ersten Beispiel.
Beispiel:
X Crataemespilus gillotii
hervorgegangen aus
Crataegus monogyna x Mespilus germanica
aber
+ Cratae
go
mespilus dardarii
hervorgegangen aus
Crataegus monogyna + Mespilus germanica
und
+ Labur
no
cytisus adamii
hervorgegangen aus als Pfropfbastarde
Chamaecytisus purpueus + Laburnum anagyroides
Enthalten die Nachkommen unterschiedliche Gewebeanteile beider Pfropfpartner, so zeigt sich dies in unterschiedlicher Blatt- bzw. Blütenausprägung. Sie werden dann als unterschiedliche Sorten bezeichnet.
Beispiel:
+ Crataegomespilus potsdamiensis ‘Monecto’
hervorgegangen aus
Crataegus laevigata ‘Pauli’ + Mespilus germanica,
mit nur geringen Außengewebeanteilen von der Mispel
+Crataegomespilus potsdamiensis ‘Diecto’
hervorgegangen aus
Crataegus laevigata ‘Pauli’ + Mespilus germanica,
aber mit mehr Außengewebeanteilen von der Mispel
Alle hier angeführten Bastarde/Hybriden werden ausführlich beschrieben
Literatur
1 Ritz, C.M., Schmuths, H., Wissemann, V. (2005): Evolution by reticulation: European dog roses by multiple hybridization across the genus Rosa. Journal of Heredity. 96 (1): 4–14.
2 Wissemann, V. u. Ritz, C.M. (2005): The genus Rosa (Rosoideae, Rosaceae) revisited: molecular analysis of nrITS-1 ans atpB-rbcL intergenic spacer (IGS) versus conventional taxonomy. Botanical Journal of the Linnean Society. 147: 275–290.
Hybridisierung und ihre Grenzen bei Gehölzen
Artbastarde können auch ohne Zutun des Menschen in der Natur entstehen, zumal heute, wo viele Pflanzen und unter ihnen Gehölze weltweit verbracht und z. B. in Botanischen Gärten und Arboreten, aber auch als Zierpflanzen in Parks und Gärten angepflanzt werden. Hier können nahe verwandte Arten gelegentlich bastardisieren, ohne dass die Nachkommen besonders auffallen. Am natürlichen Standort wird die Artkreuzung allerdings durch unterschiedliche Blühzeiten, durch physiologische und genetische Inkompatibilitäten, d. h. Unverträglichkeiten und unterschiedlichen Chromosomensätzen eingeschränkt oder verhindert. Auch Anfälligkeiten gegen Krankheitserreger wie parasitische Bakterien oder Pilze können u. U. eine erfolgreiche Bastardisierung sofort wieder unterbrechen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























