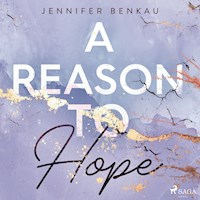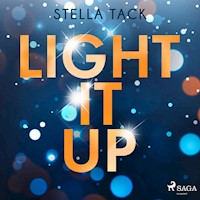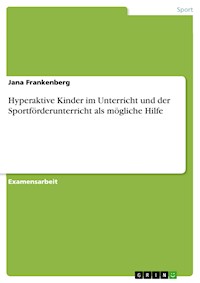
Hyperaktive Kinder im Unterricht und der Sportförderunterricht als mögliche Hilfe E-Book
Jana Frankenberg
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Didaktik - Sport, Sportpädagogik, Note: 2,0, Universität Osnabrück, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Rahmen der Vorüberlegungen zu meiner Examensarbeit habe ich mir über viele pädagogische Handlungsfelder Gedanken gemacht. Da ich seit meinem Studienbeginn die Problematik der Lern- und Erziehungsprobleme heranwachsender Kinder mit zunehmendem Interesse verfolge, möchte ich mich auch in meiner Arbeit diesem Thema widmen. Erste, sehr spannende Einblicke bekam ich in diversen Seminaren, die sich mit dieser Thematik beschäftigten. Hinsichtlich des Gedankens, mit diesen Problemen auch in meiner späteren Berufspraxis konfrontiert zu werden, entschied ich mich dafür, die Lebens- und Lernsituationen von Kindern mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten näher zu betrachten. Mein Anliegen ist es, ihre Situation besser zu verstehen, um ihnen dann in meinem späteren Berufleben eventuell effektive Hilfestellungen anbieten zu können. Die Problematik von ADHS- Kindern ist schon seit langem ein zentraler Bestandteil schulpädagogischer Handlungsräume, die im Rahmen einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen nicht vernachlässigt werden darf. Neben der Bearbeitung des ADH- Syndroms werde ich des Weiteren noch genauer auf den Sportförderunterricht in der Schule eingehen, der lediglich als „eine“ mögliche Hilfe verhaltensauffälliger Kinder angesehen werden kann. Auf die Problematik der Hyperaktivität bin ich im Zusammenhang mit meinem Fachpraktikum Anfang des Jahres gestoßen. In meiner damaligen ersten Klasse befand sich ein Junge, der immer wieder durch übermäßige Impulsivität, ständige Unruhe und einen ausgesprochenen Bewegungsdrang in der Gruppe auffiel. Bei einem Gespräch mit der Klassenlehrerin erfuhr ich wenig später, dass der Junge unter Umständen das ADH-Syndrom haben könnte. Eine genaue Diagnose stand zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Laut Anamnese und Aussagen der Eltern sind bestehende Auffälligkeiten im Vorschulalter (Kindergarten) noch nicht behandelt worden. Erst im Rahmen der schulischen Unterrichtssituationen bemerkte die Klassenlehrerin bei ihm jene Auffälligkeiten, auf die ich im Laufe meiner Arbeit noch genauer eingehen werde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus, Bachelor und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINFÜHRUNG
1.1 Zur Themenauswahl
1.2 Aufbau der Arbeit
1.3 Zur Relevanz des Themas
2 HYPERAKTIVITÄT
2.1 Allgemeine Begriffsklärung
2.2 Definitionsversuche
2.3 Historischer Abriss
2.4 Mögliche Ursachen
2.4.1 Genetische Faktoren
2.4.2 Organische Faktoren
2.4.3 Ökologische Faktoren
2.4.4 Psycho- soziale Faktoren
2.4.5 Störung der sensorischen Integration der Sinne
2.4.6 Veränderte Kindheit
2.5 Welche Symptome zeigen hyperaktive Kinder im Alltag?
2.5.1 Welche Symptome kommen in der Schule hinzu?
2.5.2 Wie sollte ein Lehrer mit einem hyperaktiven Kind im Unterricht umgehen?
2.6 Die Diagnose
2.7 Verschiedene Therapieformen
2.7.1 Verhaltenstherapie
2.7.2 Kinderpsychotherapie
2.7.3 Logopädie
2.7.4 Ergotherapie
2.7.5 Spieltherapie
2.7.6 Psychomotorik
2.7.7 Medikamentöse Behandlung
2.7.8 Familientherapie
3 SPORTFÖRDERUNTERRICHT ALS SPEZIELLE THERAPIEFORM IN DER SCHULE
3.1 Was ist Sportförderunterricht?
3.2 Warum Sportförderunterricht in der Schule?
3.2.1 Verändertes Gesundheitsverständnis
3.2.2 Veränderte Kindheit
3.3 Entstehungsgeschichte des Sportförderunterrichts
3.4 Aufgabenbereiche und Zielsetzungen
3.5 Zielgruppe
3.6 Die Auswahl der Kinder
3.7 Inhaltsbereiche
3.7.1 Wahrnehmungsförderung
3.7.2 Motorische Wahrnehmung
3.7.3 Soziale, emotionale und kognitive Förderung
3.8 Organisatorische und didaktische Überlegungen
4 PRAKTISCHER TEIL
4.1 Beschreibung der Schule
4.2 Zur Auswahl der Kinder für den Sportförderunterricht
4.3 Eine Beschreibung der Sportfördergruppe an der Schule
4.4 Entwicklungsgeschichte eines ADHS- Jungen von der Geburt bis heute
4.5 Auffälligkeiten des ADHS- Jungen im Unterricht
4.6 Möglichkeiten des Sportförderunterrichts in Hinblick auf seine Auffälligkeiten
4.7 Eine Sportförderstunde zum Thema Sozialverhalten
4.7.1 Verhalten des ADHS- Jungen in dieser Stunde
4.8 Eine Sportförderstunde zum Thema Körperschema
4.8.1 Verhalten des ADHS- Jungen in dieser Stunde
4.9 Kurzfristige Auswirkungen des Sportförderunterrichts im regulären Unterricht
4.10 Langfristige Veränderungen durch den Sportförderunterricht seit Schulbeginn
4.11 Eine Zusammenfassung der praktischen Beobachtungen
5 FAZIT
6 QUELLEN UND LITERATURVERZEICHNIS
6.1 Literaturverzeichnis
6.2 Internet Quellen
6.3 Zusätzlich verwendete Literatur
1 EINFÜHRUNG
1.1 Zur Themenauswahl
Im Rahmen der Vorüberlegungen zu meiner Examensarbeit habe ich mir über viele pädagogische Handlungsfelder Gedanken gemacht. Da ich seit meinem Studienbeginn die Problematik der Lern- und Erziehungsprobleme heranwachsender Kinder mit zunehmendem Interesse verfolge, möchte ich mich auch in meiner Arbeit diesem Thema widmen.
Erste, sehr spannende Einblicke bekam ich in diversen Seminaren, die sich mit dieser Thematik beschäftigten. Hinsichtlich des Gedankens, mit diesen Problemen auch in meiner späteren Berufspraxis konfrontiert zu werden, entschied ich mich dafür, die Lebens- und Lernsituationen von Kindern mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten näher zu betrachten. Mein Anliegen ist es, ihre Situation besser zu verstehen, um ihnen dann in meinem späteren Berufleben eventuell effektive Hilfestellungen anbieten zu können.
Die Problematik von ADHS- Kindern ist schon seit langem ein zentraler Bestandteil schulpädagogischer Handlungsräume, die im Rahmen einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung an Grundschulen nicht vernachlässigt werden darf. Neben der Bearbeitung des ADH- Syndroms werde ich des Weiteren noch genauer auf den Sportförderunterricht in der Schule eingehen, der lediglich als „eine“ mögliche Hilfe verhaltensauffälliger Kinder angesehen werden kann.
Auf die Problematik der Hyperaktivität bin ich im Zusammenhang mit meinem Fachpraktikum Anfang des Jahres gestoßen. In meiner damaligen ersten Klasse befand sich ein Junge, der immer wieder durch übermäßige Impulsivität, ständige Unruhe und einen ausgesprochenen Bewegungsdrang in der Gruppe auffiel. Bei einem Gespräch mit der Klassenlehrerin erfuhr ich wenig später, dass der Junge unter Umständen das ADH- Syndrom haben könnte. Eine genaue Diagnose stand zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Laut Anamnese und Aussagen der Eltern sind bestehende Auffälligkeiten im Vorschulalter (Kindergarten) noch nicht behandelt worden. Erst im Rahmen der schulischen Unterrichtssituationen bemerkte die Klassenlehrerin bei ihm jene Auffälligkeiten, auf die ich im Laufe meiner Arbeit noch genauer eingehen werde.
Bezüglich meiner Examensarbeit erinnerte ich mich an diesen Jungen und fragte mich, inwieweit sich Diagnosestellung und Verhaltensauffälligkeiten in der Zwischenzeit entwickelt haben mochten. Ich nahm Kontakt zur Klassenlehrerin auf und erfuhr, dass zu diesem Zeitpunkt bereits eine gefestigte Diagnose des ADH- Syndroms feststand. Er nahm des Weiteren seit ca. einem halben Jahr regelmäßig einmal in der Woche am Sportförderunterricht der Schule teil, welcher ihm helfen soll, sich im Alltag und in der Schule besser zurecht zu finden.
Da ich mich, wie bereits erwähnt, an der Universität schon sehr viel mit dem Sportförderunterricht beschäftigt habe, interessiert mich in diesem Zusammenhang besonders, inwieweit dieser Unterricht durch praxisrelevante Förderstrukturen Einflüsse auf das psycho- motorische Verhalten und die Persönlichkeitsentwicklung des Jungen nehmen kann.
Aufgrund dieser Überlegungen entschied ich mich im Rahmen meiner Examensarbeit für eine theoriegeleitete Arbeit, welche anhand eines erfahrungsorientierten Vorgehens (Beobachtungen des Jungen im regulären Unterricht und im Sportförderunterricht) erörtert und analysiert werden soll.
1.2 Aufbau der Arbeit
In meiner Arbeit möchte ich mich als erstes mit dem ADH- Syndrom beschäftigen. Hierzu werde ich einleitend die Entwicklung der verschiedenen Begrifflichkeiten dieser Störung erläutern, da die Begrifflichkeit zu diesem Thema sehr undurchsichtig sowie vielfältig ist und sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert hat. Anschließen werden sich Definitionsversuche, die nur wenige von sehr vielen darstellen, welche jedoch die Thematik und Problematik meiner Meinung nach sehr gut beleuchten. Ein kurzer historischer Abriss soll Kenntnisse darüber vermitteln, wann das Syndrom zum ersten Mal in der Fachliteratur auftauchte und welche Vermutungen es bis heute noch über seine Ursachen gibt. Im nächsten Punkt möchte ich mich dann mit diesen Vermutungen beschäftigen. Ich werde verschiedenste Theorien komprimiert vorstellen, um einen Überblick darüber zu geben, welch widersprüchliche und verschiedene Ansichten es über die Ursache eines Syndroms gibt, welches bis heute noch so unerforscht ist. Des Weiteren wird eine Beschreibung der Probleme folgen, die das ADH- Syndrom Kindern von der Geburt bis hin ins Schulalter bereitet und welche speziellen Probleme noch im Schulalltag hinzukommen. Ich möchte sodann auf einen Punkt eingehen, der mich persönlich besonders interessiert, da er Einblicke in die Möglichkeiten vermittelt, wie ein Lehrer/eine Lehrerin mit einem hyperaktiven Kind in der Klasse umgehen sollte. Da ich selber überhaupt nicht weiß, an welche Grenzen man mit so einem Kind im Unterricht stößt und wie man am besten darauf eingeht, ist es für mich sehr aufschlussreich zu erfahren, welche Tipps einem Lehrer im Umgang mit ADHS an die Hand gegeben werden. Anschließend werde ich auf die Frage eingehen, wer eine Diagnose stellen sollte und wie und mit welchen Methoden diese Feststellung allgemein erfolgen sollte. Daraus resultierend möchte ich mich mit verschiedenen Therapieformen und ihren Zielen beschäftigen. Ich werde dazu die gängigsten Formen kurz erläutern, auf die medikamentöse Therapie etwas genauer eingehen und mich dann dem Sportförderunterricht als möglicher Therapieform in der Schule widmen. Den Sportförderunterricht werde ich im nächsten Punkt sehr genau erläutern, da er eine der Therapiemethoden in der Schule ist, mit der ich mich in meiner späteren Berufpraxis beschäftigen möchte. Zu Beginn möchte ich hierzu einige Definitionsversuche geben, erläutern, warum es den Sportförderunterricht in der Schule überhaupt geben sollte und in Bezug darauf auf das veränderte Gesundheitsverständnis und die veränderte Kindheit eingehen. Ein kleiner historischer Exkurs soll darstellen, wie sich der Sportförderunterricht an Schulen entwickelt hat, seit wann es ihn gibt und wie er sich seitdem weiterentwickelt hat. Anschließend möchte ich die Ziele und Aufgaben des Sportförderunterrichts erläutern, seine Zielgruppen nennen, auf die Auswahl der Kinder für den Unterricht eingehen und seine Inhaltsbereiche anführen. Hierzu werde ich mich auf die drei großen Inhaltsbereiche, die Wahrnehmung, die motorische Förderung sowie die emotionale, soziale und kognitive Förderung von Kindern beziehen. Abschließend werde ich zu diesem Punkt einige didaktisch-methodische Überlegungen zum Sportförderunterricht an Schulen anführen, um dann zum praktischen Teil meiner Arbeit zu kommen.
Für meinen praktischen Teil werde ich an der „Grundschule am Hagenberg“ in Bad Iburg einen ADHS- Jungen einer zweiten Klasse beobachten. Ich möchte herausfinden, welche Probleme der Junge aufgrund des Syndroms im Schulalltag bekommt und möchte meine eigenen Beobachtungen im Laufe des praktischen Teils mit denen in der Literatur vergleichen. Vorab werde ich kurz die Schule vorstellen, erklären, warum es dort den Sportförderunterricht gibt, bzw. warum es an der Schule möglich ist Sportförderunterricht zu erteilen. Anschließend erläutere ich wie man dort die Kinder für den Sportförderunterricht auswählt und werde die Sportfördergruppe beschreiben, an der der Junge teilnimmt. Eine kurze Entwicklungsgeschichte des Jungen von der Geburt an bis heute, welche ich mit Hilfe der Eltern erstellen möchte, soll einen kleinen Überblick darüber geben, wie sich das problematische Verhalten des Kindes im Alltag äußert. Andersherum möchte ich auch erläutern, welche besonderen Talente dieser hyperaktive Junge hat und inwieweit er anderen Kindern in seiner Entwicklung oft voraus ist. Danach werde ich den Jungen im Schulalltag beobachten und konkret auf die Probleme und Auffälligkeiten eingehen, die sich dort zeigen um mir dann drei für ihn markante Auffälligkeiten herauszugreifen. Diese möchte ich dann näher erläutern. In Bezug auf diese Auffälligkeiten werde ich mir überlegen, wie man als Lehrerin den Sportförderunterricht gestalten kann, damit der Junge seine Schwierigkeiten im Unterricht besser kompensieren kann. In Zusammenarbeit mit seiner Lehrerin werde ich ein bis zwei Stunden für den Sportförderunterricht planen, in denen gezielt auf seine Auffälligkeiten eingegangen werden soll. Diese Stunden werde ich protokollieren und das Verhalten des Jungen in den Stunden dokumentieren. In den darauf folgenden Tagen werde ich den Jungen erneut im regulären Unterricht beobachten um festzustellen, ob ihm die Inhalte im Sportförderunterricht in irgendeiner Weise helfen können sein problematisches Verhalten zu verbessern. Ich werde versuchen gezielt auf seine markanten Auffälligkeiten zu achten jedoch auch sein gesamtes Verhalten dabei nicht außer Acht zu lassen. Ich möchte am Ende der Beobachtung zu einem Ergebnis kommen, welches mir Aufschlüsse darüber vermittelt, inwieweit der Sportförderunterricht einem hyperaktiven Zweitklässler helfen kann, sein problematisches Verhalten in der Schule und eventuell auch im Alltag zu verbessern. Ein Gespräch mit der Klassen- und Sportförderlehrerin soll danach verdeutlichen, welche Veränderungen durch den Sportförderunterricht auf langfristige Weise zu erzielen sind und welche Fortschritte der Junge seit seiner Einschulung gemacht hat. Eine Zusammenfassung meiner Beobachtungen soll dies am Ende des praktischen Teils verdeutlichen.
Zum Abschluss meiner gesamten Arbeit werde ich im Fazit anhand einer kurzen Zusammenfassung meine Meinung darlegen. Ich werde versuchen mir durch die in der Literatur gewonnen Kenntnisse eine Meinung darüber zu bilden, warum der beobachtete Junge hyperaktiv ist und welche Therapieformen meines Erachtens nach für ihn sinnvoll sind. Außerdem ist es mir wichtig, in meiner Arbeit abschließend darauf einzugehen, welche Bedeutung das Lehrerverhalten im Umgang mit hyperaktiven Kindern im Unterricht hat.
1.3 Zur Relevanz des Themas
Die weltweit häufigste kinderpsychiatrische Diagnose lautet zurzeit Aufmerksamkeitsstörung mit und ohne Hyperaktivität. In Deutschland sind inzwischen rund 500.000 (2-6%) Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren betroffen. Diese Kinder sind impulsiv, störend, unaufmerksam und unruhig (vgl. Skrodzki: „Purzelbaum und Trampolin- Hilfen bei ADHS“, In: Zimmer/Hunger: „Wahrnehmen, Bewegen, Lernen- Kindheit in Bewegung“, 2004, Seite 54). Sie stoßen in allen Lebensbereichen auf erhebliche Schwierigkeiten und müssen lernen ihr Störverhalten zu kompensieren.
Auch eine Untersuchung des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit, die schon vor 20 Jahren veröffentlicht wurde, zeigte bei 15,8% aller untersuchten achtjährigen Grundschüler eine psychiatrische Auffälligkeit (vgl. Schiffer: „Warum Huckleberry Finn kein Ritalin brauchte“, In: Zimmer/Hunger, 2004, Seite 261). Hierbei wurde insbesondere eine hypermotorische Symptomatik festgestellt und es erscheint bemerkenswert, dass der Fernsehkonsum bei den psychiatrisch auffälligen Kindern deutlich höher war als der der nicht auffälligen Kinder (vgl. ebd., Seite 261). Unter diesem Aspekt lässt sich der Bogen zur „Veränderten Kindheit“ spannen, in der die Kinder von heute ihre freie Zeit sitzend vor dem Fernseher oder dem PC verbringen und sich zunehmend weniger bewegen oder Sinneserfahrungen im freien Spiel sammeln.
Obwohl das hyperkinetische Syndrom mittlerweile als die international bestuntersuchteste Störung in der Kinderpsychiatrie gilt ( etwa 6.000 publizierte Studien (vgl. Neuhaus: „Das hyperaktive Kind und seine Probleme“, 1996, Seite 12)), ist die genaue Ursache bis heute nicht geklärt. Ebenso wenig ist die daraus resultierende Frage geklärt, ob es plötzlich so viele Kinder mit einer hyperkinetischen Störung gibt oder ob es unter Umständen eine „Modediagnose“ ist, um Erziehungsfehler der Eltern zu vertuschen (vgl. ebd., Seite 12). Aufgrund der fehlenden Ursachenklärung kann man auch nicht genau sagen, inwieweit man die Störung behandeln kann und diese Tatsache bereitet in jeglicher Hinsicht viele Probleme.
Im Hinblick auf die erschreckend hohen Zahlen der Kinder, die heute unter dem Syndrom leiden, der Tatsache, dass die Ursache noch nicht geklärt ist und dem daraus resultierenden Fakt, dass man nicht genau weiß, welche Behandlungsmethode die richtige ist, halte ich es, insbesondere für Pädagogen, für äußerst wichtig sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Pädagogen stoßen in der Schule, im Kindergarten oder in sonstigen Einrichtungen auf Kinder mit den verschiedensten Problemen und da es aufgrund der Unterschiede und Vielfältigkeit der Schwierigkeiten kein Patentrezept für die richtige Behandlung gibt, ist es sehr schwer, den Kindern mit den richtigen Methoden gegenüber zu treten.