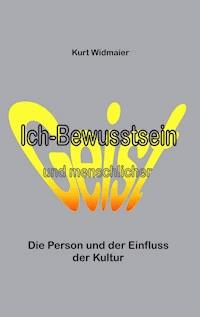
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Verbindungen und Gemeinsamkeiten der Erkenntnisse mehrerer Wissenschaften, die sich mit der Psyche, dem Geist oder dem Gehirn befassen, sowie spirituellen Aussagen lassen darauf schließen, dass das menschliche Bewusstsein eine innere Struktur besitzt, die nicht nur auf seiner biologischen Entwicklung beruht, sondern die auch von der Kultur geprägt wird, in der ein Mensch aufwächst. Die Interaktionen mit dem sozialen Umfeld bewirken in der frühen Kindheit unmerkliche Veränderungen in der Psyche und im Bewusstsein. Neben psychologischen Erkenntnissen weisen vor allem spirituelle Quellen darauf hin, dass unser Wohlbefinden dadurch stärker beeinflusst wird als wir meinen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1.1 Grundgedanken und Thesen
1.2 Intuitive Erfahrung und objektive Erkenntnis
1.3 Aufbau der Abhandlung
Berichte über spirituelle Erfahrungen
2.1 Gemeinsamkeiten in den Berichten
2.2 Nahtod-Erfahrungen
2.3 Die Schöpfungsgeschichte der Bibel
Erkenntnisse der Philosophie
3.1 Vernunft und Erkenntnisvermögen
3.2 Objektive Erkenntnis
Erkenntnisse der Psychologie
4.1 Das Unbewusste
4.2 Archetypen
4.3 Die Individuation
4.4 Empathische Beziehungen
Erkenntnisse der Verhaltensbiologie
5.1 Evolution als erkenntnisgewinnender Prozess
5.2 Der menschliche Erkenntnisapparat
5.3 Mechanismen des Erkenntnisapparats
Erkenntnisse der Kognitionswissenschaften
6.1 Ursachen für das Wachstum des Großhirns
6.2 Die Evolution des menschlichen Bewusstseins
6.3 Die Ausprägung des Bewusstseins bei Kindern
6.4 Zweierlei Erkenntnisvermögen
6.5 Ich-Bewusstsein und Kultur
6.6 Die Bedeutung des Ich-Bewusstseins für den Menschen
Konzepte aus der Perspektive des Systemdenkens
7.1 Grundstrukturen des Ich-Bewusstseins
7.2 Soziale Systeme und Bewusstseinssysteme
7.3 Die Ausprägung der Persönlichkeit
7.4 Lebensfähige Systeme
Erkenntnisse der Gehirnforschung
8.1 Bestandteile des Nervensystems
8.2 Veränderungen im Laufe der Evolution
8.3 Grundfunktionen des Nervensystems
8.4 Evolutionäre Mechanismen im Gehirn
8.5 Komplexe neuronale Strukturen
8.6 Emotionen und Gefühle
8.7 Sozialverhalten und Nervensystem
8.8 Gedächtnis
8.9 Kognitive Leistungen
8.10 Reaktions- und Verarbeitungszeiten
8.11 Bewusstsein
Das Ich-Bewusstsein aus dem Blickwinkel der spirituellen Erfahrung
9.1 Interpretation spiritueller Aussagen
9.2 Bestätigung einiger wissenschaftlicher Erkenntnisse durch die spirituelle Erfahrung
9.3 Überlegungen zu den neurophysiologischen Korrelaten einzelner Aspekte der spirituellen Erfahrung
9.4 Überlastungen des physiologischen Apparats
9.5 Zusammenfassung der Aussagen
Die Diskussion über die Willensfreiheit
10.1 Der freie Wille aus neurobiologischer Sicht
10.2 Der freie Wille aus gesellschaftlicher Sicht
10.3 Weshalb haben wir den Eindruck, dass wir frei entscheiden?
Wege zur Selbst-Wesensschau
11.1 Die geistige Übung
11.2 Wirkungen der spirituellen Erfahrung
11.3 Hinweise auf Erlebnisberichte
Anhang
Anmerkungen zu den verwendeten Begriffen
Grundlegende Begriffe der Abhandlung
Begriffe nach Carl Gustav Jung
Begriffe nach Konrad Lorenz
Inventarium der Vernunft nach Immanuel Kant
Quellentexte zur spirituellen Erfahrung
Literatur- und Quellenverzeichnis
Stichwortregister
Vorwort
Als ich vor einigen Jahren damit begann, einige Erkenntnisse über den menschlichen Geist in schriftlicher Form zusammenzufassen, war mir der tiefere Grund für mein Interesse an der Thematik noch nicht bewusst. Erst bei einem Vortrag des amerikanischen Psychologen Chuck Spezzano mit dem Titel „Burnout“ fiel mir das Ereignis wieder ein, das dieses Interesse hervorrief.
Chuck Spezzano vertritt unter anderem die Ansicht, dass sich alle Menschen in ihrer frühen Kindheit etwas vornehmen, das sie nicht für sich, sondern für andere Menschen oder das Leben insgesamt verwirklichen wollen. Um zu verdeutlichen, was er damit meinte, erzählte er die Geschichte eines kleinen Jungen, der von einem automatisch schließenden Garagentor eingeklemmt wurde, und nach diesem Unfall mehrere Stunden zwischen Leben und Tod schwebte. Einige Zeit nach seiner Genesung eröffnete der Junge seiner Mutter, dass er eigentlich lieber gestorben wäre, weil es an dem Ort, zu dem er gelangte, so schön war. Aber ein alter Mann sagte ihm, dass er noch eine Aufgabe zu erfüllen hätte, nämlich den Menschen von seiner Erfahrung – einer sogenannten Nahtod-Erfahrung – zu berichten.
Als ich diese bewegend erzählte Begebenheit anhörte, fiel mir wieder ein, was ich mir als Kind vorgenommen hatte. Der Anlass war eine alltägliche Situation, wie sie in ähnlicher Art und Weise wohl viele Kinder erleben. An einem schönen Sommertag, den ich meinen Bedürfnissen folgend verbrachte, erledigte ich eine mir gestellte Aufgabe nicht, weil sie mir im Vergleich zu anderen Tätigkeiten nicht besonders wichtig schien. Weil es nicht das erste gleichartige Versäumnis war, kam es wie es kommen musste: Zur Strafe wurde ich schon am späten Nachmittag ins Bett geschickt.
Nachdem die Wut über die meiner Ansicht nach ungerechte Behandlung verraucht war, dachte ich darüber nach, was ich falsch gemacht hatte. Dabei wurde mir klar, dass Erwachsene offenbar manche Forderungen, die von außen an sie herangetragen werden, über ihre inneren Bedürfnisse stellen. Um das bewerkstelligen zu können, müssten sie sich – so empfand ich – von ihrem innersten Kern entfernen, wodurch unausweichlich die direkte Verbindung zu ihren psychischen Kräften verloren ginge.
Die Auswirkungen auf unser seelisches Wohlbefinden schienen mir so bedeutsam, dass ich den Erwachsenen meine Einsicht unbedingt mitteilen musste. Weil mir aber geeignete Anknüpfungspunkte fehlten, um meine Einsicht zu vermitteln, und weil ich noch nicht genau verstand, weshalb Erwachsene in dieser Weise agieren, befürchtete ich, nicht ernst genommen zu werden. Deswegen nahm ich mir vor, mich nicht sofort zu äußern, sondern erst dann, wenn ich dazu in der Lage wäre wie ein Erwachsener zu denken und zu argumentieren.
Obwohl die Erinnerung an dieses Vorhaben nach und nach verblasste, machte es sich – wie ich jetzt weiß – indirekt in Form wechselnder Interessen bemerkbar, die mich zu verschiedenen Erkenntnissen und Aussagen mehrerer Wissenschaften, der Philosophie und der Religionen führten.
Erwachsene wissen, dass es im gesellschaftlichen Zusammenleben immer wieder Situationen gibt, in denen die Bedürfnisse, Interessen und Wünsche mehrerer Personen oder Institutionen in Einklang gebracht werden müssen. Wenn sie Konflikte vermeiden oder zum Wohlergehen anderer Menschen beitragen wollen, müssen sie hin und wieder Kompromisse machen und ihre Bedürfnisse oder Intentionen zurückstellen.
Kinder erwerben derartige Verhaltensweisen nach und nach aufgrund schmerzhafter Erfahrungen in Konfliktsituationen. Indem sie lernen, ihre Aufmerksamkeit auf äußere Erfordernisse und Ereignisse zu richten, gelingt es ihnen zunehmend, solche Situationen zu umgehen. In der Folge verändert sich unmerklich die Art des inneren Erlebens. Es entwickelt sich eine Geisteshaltung, die Geschehnisse in den tieferen Schichten des Geistes ausblendet.
Deswegen entgeht uns, wie subtile Anspannungen, verdrängte Emotionen und unbewusste Konflikte unser Wohlbefinden, unser Denken und unser Handeln beeinflussen. Wie mir eine innere Erfahrung vor einigen Jahrzehnten gezeigt hat, können die mit dieser Geisteshaltung verbundenen Blockaden aufgelöst werden, so dass wir wieder Einblicke in das innere Geschehen gewinnen. Wenn das gelingt, erleben wir einen nicht für möglich gehaltenen inneren Frieden.
Diese Aussagen lassen sich weder unmittelbar einsehen, noch auf einfache Weise wissenschaftlich erklären. Wie sie zustande kommen, kann allenfalls durch die gemeinsame Betrachtung vieler Erkenntnisse und Erfahrungsberichte, die den menschlichen Geist aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten, einigermaßen plausibel werden. Wer mehr darüber erfahren möchte, findet in der nachfolgenden Abhandlung einige Hinweise und Auszüge aus verschiedenen relevanten Veröffentlichungen.
Allerdings darf man nicht zu viel erwarten, denn Erkenntnisse oder Berichte über eine Erfahrung können die Erfahrung selbst nicht vermitteln. Außerdem entfernt uns das begriffliche Denken, das wir einsetzen müssen, um wissenschaftliche Aussagen nachvollziehen zu können, in gewisser Weise vom Geschehen in den tieferen Schichten unseres Geistes anstatt uns ihm näher zu bringen. Da wir jedoch über keine geeigneteren Methoden zur Wissensweitergabe verfügen ist es nötig, auf sprachliche Äußerungen zurückzugreifen, um auf die Existenz der inneren Wirklichkeit aufmerksam zu machen, und Hinweise zu geben, wie sie erfahren werden kann.
Viele Menschen haben durch ihre Geduld, ihre Unterstützung, ihr Vorbild oder ihre Veröffentlichungen direkt oder indirekt dazu beigetragen, dass ich mir dieses Wissen aneignen konnte. Allen diesen Menschen bin ich dankbar.
1 Einleitung
In der Abhandlung sind Erkenntnisse und Konzepte mehrerer Wissenschaften, Erfahrungsberichte sowie einige spirituelle Aussagen zusammengefasst, die den menschlichen Geist und das menschliche Bewusstsein aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Das Augenmerk liegt dabei nicht auf der vollständigen oder detailgetreuen Wiedergabe der oft sehr umfangreichen Quellen, sondern auf deren Berührungspunkten, Gemeinsamkeiten und Verbindungen.
Weil die jeweiligen Wissenschaften bzw. Perspektiven auf unterschiedlichen Bezugssystemen mit ihren spezifischen Begrifflichkeiten basieren, fügen sich die Beiträge weder nahtlos aneinander, noch erschließen sich die Zusammenhänge immer unmittelbar. Berührungspunkte, Gemeinsamkeiten und Verbindungen ergeben sich deswegen häufig nicht aus passenden sprachlichen Formulierungen, sondern zeigen sich anhand gleichartiger Muster, Elemente oder Strukturen in den jeweils relevanten Aussagen.1
Bei gemeinsamer Betrachtung der Beiträge zeichnet sich meiner Ansicht nach indirekt ab, dass es in der menschlichen Psyche eine Wirklichkeit gibt, die sich der Introspektion normalerweise entzieht.
1.1 Grundgedanken und Thesen
Als menschlicher Geist wird nachfolgend die Gesamtheit aller Funktionen, Mechanismen und Prozesse bezeichnet, die das bewusste und unbewusste psychische Geschehen in einem Menschen hervorrufen oder begleiten. Ein Teil dieser Funktionen, Mechanismen und Prozesse erzeugt das bewusst wahrnehmbare seelische und gedankliche innere Geschehen. Sie bilden den Bewusstseinszustand2 erwachsener Personen, der Ich-Bewusstsein genannt wird, weil seine Inhalte mit der Vorstellung verknüpft sind, dass sie von einer Person, einem Ich, erlebt werden.3
Die Abhandlung geht von der wissenschaftlich weitgehend akzeptierten These aus, dass die geistigen Funktionen und das Bewusstsein ebenso wie die physische Welt und das Leben im Laufe der Evolution entstanden sind. Wenn also das Ich-Bewusstsein eine Errungenschaft der Evolution ist, muss es eine innere Struktur aufweisen, die auf seiner biologischen und kulturellen Entwicklung beruht. Es müsste sich analog zu den Strukturen des Körpers, z.B. der Organe, im Mutterleib und in der Kindheit parallel zur körperlichen Entwicklung und unter dem Einfluss des sozialen Umfelds ausprägen.4
Diese Schlussfolgerung legt die These nahe, dass jeder Mensch mit einem Bewusstseinszustand auf die Welt kommt, im folgenden Wesen genannt, wie ihn in ähnlicher Form auch andere höhere Säugetiere besitzen. Erst im Laufe der frühkindlichen Entwicklung bildet sich das Ich-Bewusstsein, wobei sich nach und nach die Art des bewussten Erlebens verändert. An diese Veränderungen erinnern sich erwachsene Menschen normalerweise ebenso wenig wie an Ereignisse in ihrer frühen Kindheit. Diese Eigenheit des Bewusstseins wird als frühkindliche Amnesie bezeichnet.
Weil das Ich-Bewusstsein auf dem Wesen aufbaut, können Erwachsene diesen Zustand erneut erleben, allerdings nur, wenn sie dazu alle ihre geistigen Kräfte einsetzen.5 Der Vorgang, der zu seiner Wahrnehmung führt, Selbst-Wesensschau oder spirituelle Erfahrung6 genannt, ist überwältigend und wohltuend zugleich. Diese Erfahrung lässt sich mit Worten nur unvollkommen beschreiben, weil sich das Wesen grundlegend von unserem gewohnten Bewusstseinszustand unterscheidet.7
In der Selbst-Wesensschau weitet sich das Bewusstsein, ohne dass die im Laufe des Lebens erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten verloren gehen. Dabei offenbaren sich Zusammenhänge, die im Zustand des Ich-Bewusstseins verborgen sind. Insbesondere werden einige Aspekte des menschlichen Geistes wahrgenommen, die im Ich-Bewusstsein nicht isoliert, sondern in den Bewusstseinsstrom integriert erscheinen.
Die wissenschaftlich verwertbaren Einsichten sind zwar in Anbetracht der Komplexität der Funktionen und Leistungen des Gehirns verschwindend gering. Sie bieten jedoch Anhaltspunkte, die dazu beitragen können, die innere Struktur des Ich-Bewusstseins besser zu verstehen.8
1.2 Intuitive Erfahrung und objektive Erkenntnis
Weil in die Abhandlung auch Erkenntnisse einfließen, die sich aus der Introspektion bzw. der Interpretation spiritueller Quellen ergeben, stellt sich die Frage, inwieweit die Ergebnisse der Betrachtung in wissenschaftlicher Hinsicht ernst genommen werden können. Eine individuelle Erfahrung kann ja nicht als Kriterium herangezogen werden, um wissenschaftliche Aussagen zu bestätigen oder zu verwerfen. Als objektiv gelten Erkenntnisse nur dann, wenn sie jederzeit durch Wiederholung von Experimenten oder gedanklicher Tätigkeit verifizierbar sind.
Obwohl die intuitive Erfahrung einzelner Personen also nicht zur Bestätigung wissenschaftlicher Thesen dienen kann, so kann sie dennoch zu objektiven Erkenntnissen führen. Eine Hypothese ist als wissenschaftlich zu betrachten, wenn sie nicht im Widerspruch zu allgemein akzeptierten objektiven Erkenntnissen steht, selbst wenn bei der Formulierung der Aussagen das Instrumentarium fehlt, deren Korrektheit ausreichend zu belegen.9 Der Fortschritt in Wissenschaft und Technik ermöglicht ja vielleicht die Bestätigung bzw. die Widerlegung zu einem späteren Zeitpunkt.
1.3 Aufbau der Abhandlung
Die Aussagen der Abhandlung könnten besser nachvollzogen werden, wenn es gelänge, ein einigermaßen verständliches Bild der Selbst-Wesensschau zu vermitteln. Leider ist das nur unzureichend möglich. Einen gewissen Eindruck bieten einzelne Aspekte dieser Erfahrung, über die mehrere Quellen übereinstimmend berichten. Einige dieser Aspekte sind im nächsten Kapitel zusammengestellt.
Es folgen mehrere Kapitel, in denen Erkenntnisse über das Ich-Bewusstsein – jeweils aus der Perspektive eines Zweigs der Wissenschaft – in knapper Form zusammengefasst werden. Die Reihenfolge dieser Kapitel orientiert sich an der zeitlichen Reihenfolge des Erscheinens der betreffenden Veröffentlichungen. In den ersten beiden Kapiteln wird das Ich-Bewusstsein unter phänomenologischen Gesichtspunkten betrachtet, zuerst überwiegend aus der Außensicht, der Vernunft und dem Erkenntnisvermögen, dann aus der Innensicht, der menschlichen Psyche. Daran schließen sich Überlegungen an, weshalb der menschliche Erkenntnisapparat im Laufe der Evolution entstanden ist, in welchen Schritten sich das menschliche Bewusstsein entwickelt haben könnte, und was Kinder lernen müssen, bis sie in vollem Umfang über intellektuelle Leistungen verfügen. Danach werden Strukturen und Operationsweisen des Ich-Bewusstseins unter dem Blickwinkel der Systemtheorie beleuchtet. Den Abschluss bildet die Beschreibung einiger Mechanismen des Gehirns, auf denen wichtige Funktionen und Leistungen des menschlichen Bewusstseins basieren.
Anschließend werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Verbindung gebracht zu spirituellen Aussagen sowie Einzelheiten, die sich in der Selbst-Wesensschau offenbaren. Als Schlussfolgerungen ergeben sich einige Thesen zum Aufbau des Ich-Bewusstseins.
Nach einem kurzen Exkurs zur Diskussion über den freien Willen wird im abschließenden Kapitel auf einige der überaus positiven Wirkungen der spirituellen Erfahrung hingewiesen.
1 Im Sinne eines pattern matching
2 Der Begriff Bewusstseinszustand hat sich eingebürgert, obwohl es sich bei genauerer Betrachtung eher um einen andauernden Prozess handelt.
3 Allgemeine Begriffe wie Geist, Selbst, Ich werden in der Literatur – und deswegen auch in nachfolgend zitierten Textstellen – unterschiedlich und teilweise abweichend von der hier benutzten Definition verwendet.
4 Die allgemeinen Mechanismen der Evolution, aus denen sich diese Aussagen ableiten, werden im Kapitel „Erkenntnisse der Verhaltensbiologie“ erläutert.
5 Eine rein willentliche Anstrengung reicht dazu nicht aus; siehe Hinweise im abschließenden Kapitel.
6 Synonyme sind unter anderem mystische Erfahrung und Erleuchtung.
7 Eine gewisse Vorstellung von dessen Andersartigkeit vermitteln z.B. die Überlegungen zweier Neurowissenschaftler, die diese Erfahrung gemacht haben: siehe Dr. med. Eben Alexander: Blick in die Ewigkeit, Anhang B, Seite 251-256 sowie J.C. Eccles in K.R. Popper, J.C. Eccles: Das Ich und sein Gehirn, Teil II, Kapitel E7, Abschnitt 49, Seite 430.
8 Dass die spirituelle Erfahrung etwas zum Verständnis des Bewusstseins beitragen kann, gerät zunehmend ins Blickfeld der Gehirnforschung; siehe beispielsweise Wolf Singer, Matthieu Ricard: Hirnforschung und Meditation – Ein Dialog.
9 Einzelheiten siehe Abschnitt „Objektive Erkenntnis“ im Kapitel „Erkenntnisse der Philosophie“
2 Berichte über spirituelle Erfahrungen
Leider geben Beschreibungen der spirituellen Erfahrung deren Inhalte nur unvollkommen wieder, weil Menschen ihr inneres Erleben, ihre Gefühle und Empfindungen nicht direkt vermitteln können. Die Situation ist vergleichbar mit dem Versuch, jemandem den Geschmack von Kaffee erklären zu wollen. Dies gelingt nur näherungsweise: Wenn man wissen will, wie Kaffee schmeckt, muss man ihn trinken. Weil sich aber die Selbst-Wesensschau – im Unterschied zu Kaffee – nicht einfach erzeugen lässt, bleibt Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, nur die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse sprachlich zu formulieren.
Einige dieser Berichte zählen zu den ältesten Überlieferungen der Menschheit und bilden die Grundlage der großen Weltreligionen.10 Das Wissen, dass es sich um eine Erfahrung handelt, die jeder Mensch machen kann, hat sich meist nicht in den Hauptströmungen der Religionen, sondern eher in weniger bekannten Nebenlinien erhalten. Der Grund ist wohl darin zu suchen, dass sich Menschen, die die Selbst-Wesensschau nicht erlebt haben, nur an den schriftlich gefassten Überlieferungen orientieren können. Weil jeder umfangreiche Text Spielräume für Interpretationen bietet, sind im Laufe der Zeit aus ein und derselben Lehre oftmals unterschiedliche Glaubensrichtungen entstanden.
Eine andere, auf den ersten Blick vielleicht überraschende Quelle stellen Berichte von Personen dar, die dem Tod nahe gewesen und wieder ins Leben zurückgekehrt sind, sogenannte Nahtod-Erfahrungen. Wie später erläutert wird, dürften Nahtod- und spirituelle Erfahrungen auf ein und demselben inneren Vorgang beruhen, der aber in unterschiedlichem Ausmaß erlebt werden kann.
2.1 Gemeinsamkeiten in den Berichten
Es fällt schwer, in den Quellen Übereinstimmungen zu entdecken, weil erstens jede Beschreibung der Selbst-Wesensschau nur einen von vielen möglichen Blickwinkeln auf die Erfahrung darstellt, weil zweitens die Quellen aus verschiedenen Kulturkreisen mit ihren spezifischen Begriffen und Symbolen stammen, und weil drittens in den Berichten häufig Vergleiche zu Gegenständen verwendet werden, die dem jeweiligen Lebensumfeld bzw. Erfahrungshintergrund entnommen sind.
Wenn nachfolgend von Gemeinsamkeiten die Rede ist, bedeutet das nicht, dass die aufgeführten Elemente in allen Beschreibungen vorkommen, denn die Berichte gehen jeweils nur auf eine Auswahl von Aspekten des inneren Erlebens ein.
Die mit der spirituellen Erfahrung verbundenen Gefühle sind überwältigend. Es wird von „tiefem inneren Frieden“, „grenzenloser Gnade“ etc. gesprochen.
Der Durchbruch zum Wesen tritt unvermutet ein. Wenn der Geist dazu reif ist, können ein überraschender Laut, ein Lichtreflex, ein starker seelischer Schmerz, ein überraschender Ausspruch etc. die Selbst-Wesensschau auslösen.
Es wird davon berichtet, dass die Trennung zwischen Außen- und Innenwelt verschwindet, was auch als „Einssein“ mit allem Seienden beschrieben wird.
In verschiedenen Berichten werden Lichterscheinungen erwähnt, die mit der Erfahrung verbunden sind, wie z.B. der „brennende Dornbusch“ (Berufung Mose) oder das „Kreisen des Lichts“ (Daoismus).
Weitere, einigermaßen gesicherte Aussagen aus den Berichten abzuleiten, erfordert tieferreichende Interpretationen.11
2.2 Nahtod-Erfahrungen
Der Psychiater Raymond A. Moody befragte ca. 150 Personen, die dem Tode nahe waren und dabei eine nicht alltägliche Erfahrung machten. Diese Personen hatten Mühe, ihr Erlebnis adäquat zu beschreiben: „Die Erfahrungen derjenigen, die dem Tode nahe gekommen sind, fallen aus unserer gemeinschaftlichen Erfahrungswelt heraus, sodass die Vermutung nahe liegt, dass die Betreffenden bei der Wiedergabe ihrer Erlebnisse wohl auf einige Schwierigkeiten sprachlicher Natur stoßen werden. Genauso ist es auch. Die Beteiligten bezeichnen ihr Erlebnis einhellig als unsagbar, also als «unbeschreiblich».“12
Trotz dieser grundsätzlichen Schwierigkeit enthalten die Erzählungen erstaunlicherweise übereinstimmende Einzelheiten: „[…]; dennoch ist nicht zu übersehen, dass die verschiedenen, diese Erfahrung schildernden Berichte sich untereinander auffallend ähneln. Die Übereinstimmung zwischen den vorliegenden Berichten geht in der Tat sogar so weit, dass mühelos etwa fünfzehn Einzelelemente herausgeschält werden können, die […] beständig wiederkehren.“13
Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt der Krebsarzt Jeffrey Long, der eine umfangreiche Studie über Nahtod-Erfahrungen (NTE) durchführte, die er mit Unterstützung von Paul Perry veröffentlichte. Im Rahmen dieser Studie füllten einige hundert Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Religionen über das Internet einen umfangreichen Fragebogen aus. 613 dieser Berichte wurden in einem Bewertungsverfahren als echt eingestuft. „Keine zwei Nahtoderfahrungen sind gleich. Untersucht man jedoch viele Nahtoderfahrungen, so zeigt sich ein Muster bestimmter Elemente, die gemeinhin bei einer NTE auftreten. Diese Elemente treten üblicherweise in übereinstimmender Reihenfolge auf.“14
In der Untersuchung haben sich zwölf Elemente herauskristallisiert, die besonders häufig genannt werden. Sie sind nachfolgend – absteigend nach der Häufigkeit der Nennungen – aufgelistet, wobei zur Verdeutlichung einiger Aussagen zusätzlich die Formulierung der jeweils gewählten Antwort angegeben ist:
Intensive und überwiegend positive Gefühle und Empfindungen („Unvorstellbarer Frieden oder Heiterkeit“: 76,2%)
Lösung des Bewusstseins vom Körper (75,4%)
Schärfere Sinne („Höheres Bewusstsein und Aufmerksamkeit als normal“: 74,4%)
Erfahrung eines mystischen oder strahlenden Lichts (64,6%)
Das Gefühl, Zeit oder Raum haben sich verändert (60,5%)
Rückkehr in den Körper („Waren Sie an der Entscheidung zur Rückkehr in Ihren Körper beteiligt, oder haben Sie bemerkt, dass eine solche Entscheidung getroffen wurde?“ Mit „Ja“ antworteten 58,5%).
Begegnung mit mystischen Wesen oder verstorbenen Verwandten oder Freunden (57,3%)
Erfahrung besonderen Wissens („Hatten Sie das Gefühl, als hätten Sie besonderes Wissen, so z.B. über die universale Ordnung und/oder deren Zweck?“ Mit „Ja“ antworteten 56,0%)
Eintritt in unirdische Welten („Kam es Ihnen so vor, als beträten Sie eine andere, nicht-materielle Welt?“ Mit „Ja“ antworteten: 52,2%)
Hineingehen in oder Hindurchgehen durch einen Tunnel (33,8%)
Auftreffen auf eine Grenze oder Barriere (31,0%)
Lebensrückschau (22,2%).
15
Die große Übereinstimmung in der Nennung dieser Merkmale ist überraschend, wenn man bedenkt, dass die Erlebnisberichte von Menschen verschiedener Kulturkreise stammen, und dass sich eine nonverbale Erfahrung nur mit einer gewissen Unschärfe in sprachlichen Formulierungen ausdrücken lässt.
Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei der Nahtod-Erfahrung um ein Ereignis handelt, das von allen Menschen im Kern gleichartig erlebt wird, wenn auch in unterschiedlicher Tiefe. „Im Allgemeinen sieht es so aus, als ob diejenigen, die «tot» gewesen sind, reichhaltigere und vollständigere Erlebnisse mitzuteilen hätten als die, die den Tod nur gestreift haben, und diejenigen unter ihnen, die längere Zeit «tot» gewesen sind, gelangen tiefer als die Menschen, bei denen es nur kurze Zeit gedauert hat.“16 Dasselbe gilt auch für die spirituelle Erfahrung, denn in einigen Quellen wird darauf hingewiesen, dass die Selbst-Wesensschau in unterschiedlicher Tiefe erlebt werden kann.17
2.3 Die Schöpfungsgeschichte der Bibel
Die im Alten Testament enthaltenen Geschichten sind wahrscheinlich über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende mündlich überliefert und erst zu späteren Zeitpunkten in Schriftform gefasst worden. Man kann davon ausgehen, dass die Bibel im Wesentlichen das zum damaligen Zeitpunkt allgemein akzeptierte Wissen, nicht nur des Stammes Israel18, enthält. Die Verfasser des Alten Testaments schrieben alles auf, was in ihrer Vorstellungswelt für die nachfolgenden Generationen erhaltenswert schien. Es gab keine Trennung der Wissenschaften in Literatur, Geschichte, Naturwissenschaft etc., wie wir sie heute kennen.
Am Anfang eines solchen Universalwerkes, wie es die Bibel darstellt, würde man eine Zusammenfassung des damaligen Verständnisses zur Entstehung der Welt erwarten. Ein derartiges Weltbild vermittelt die Schöpfungsgeschichte.
Mehrere Anzeichen deuten darauf hin, dass sich die Schöpfungsgeschichte aus zwei ursprünglich getrennten Geschichten zusammensetzt. Dies wird bspw. deutlich an den unterschiedlichen Begriffen, die für Gott verwendet werden: die Bezeichnung für Gott wird von Martin Luther im zweiten Teil mit „Gott, der Herr“ anstelle „Gott“ übersetzt, um diesen Unterschied hervorzuheben. Außerdem wird die Erschaffung des Menschen zweimal beschrieben: am sechsten Tag19 und bei der Erschaffung des Gartens Eden20.
Wie ist es dazu gekommen? Mir scheint schlüssig, dass beide Texte zu unterschiedlichen Zeiten oder an unterschiedlichen Orten entstanden, und dass diejenigen Personen, die die Bibeltexte zu einem Buch zusammenfügten, beide Sichtweisen als zutreffend und als sich ergänzend betrachteten, also weder auf die eine noch auf die andere Geschichte verzichten wollten.21
Der erste Teil liefert meiner Meinung nach eine Erklärung für die Entstehung des Universums, während der zweite Teil mit symbolischen Mitteln das innere Erleben eines die Welt erkennenden Subjekts beschreibt.
2.3.1 Das Universum
Der erste Teil der Schöpfungsgeschichte befasst sich mit der äußeren Welt, dem Universum und den Objekten, die es enthält. Das Universum war der Geschichte zufolge nicht immer da, sondern es ist erschaffen worden, und zwar schrittweise im Verlauf der Zeit. Der Begriff Tag wird in der Schöpfungsgeschichte meiner Ansicht nach im Sinne von Zeitabschnitt verwendet, denn von einem Tag kann eigentlich erst gesprochen werden, wenn es die Sonne gibt, also ab dem vierten Tag.
Diese Grundvorstellungen sowie die Reihenfolge, in der die Objekte der Welt nach dem ersten Teil der Schöpfungsgeschichte entstanden sind, finden sich auch im heutigen, viel differenzierteren naturwissenschaftlichen Weltbild – mit einer Abweichung: Die Pflanzen wurden nach der Schöpfungsgeschichte am dritten Tag vor Sonne und Mond geschaffen. Diese Vertauschung könnte damit zusammenhängen, dass damals einige wissenschaftliche Erkenntnisse noch nicht bekannt waren, insbesondere dass die Sonne ein Fixstern wie Milliarden anderer Sterne ist, und dass Pflanzen das Sonnenlicht zur Fotosynthese nutzen und daher zum Wachstum brauchen.
Von dieser Ausnahme abgesehen werden die grundsätzlichen Aussagen des objektiven Weltverständnisses der Schöpfungsgeschichte auch heute noch als zutreffend betrachtet. Durch den Fortschritt der naturwissenschaftlichen Erkenntnis sind die Vorstellungen über den Ablauf der Evolution zwar immens verfeinert, aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt worden. Dieser Erkenntnisprozess ist allerdings nicht abgeschlossen, denn auch heute noch gibt es ungeklärte Fragen, z.B. wodurch das Universum entstanden ist und welche Prozesse und Mechanismen zur Entwicklung des Lebens geführt haben.
Der Gott des ersten Teils ist unter diesem Blickwinkel eine schöpferische Kraft, die das Universum und seine Gesetzmäßigkeiten geschaffen hat, aber selbst nicht erschaffen worden ist. Es handelt sich um eine Entität, die sich mit dem menschlichen Vorstellungsvermögen nicht erfassen lässt. Schon die unumgängliche Verwendung von Begriffen – wie z.B. des Begriffs schöpferische Kraft – führt zu einem Dilemma, denn sie lösen Vorstellungen in uns aus, die naturgemäß innerhalb des menschlichen Vorstellungsvermögens liegen.
2.3.2 Das Erkenntnisvermögen des Menschen
Der zweite Teil der Schöpfungsgeschichte besteht wiederum aus zwei Teilen. Der erste Abschnitt vermittelt eine weitere Vorstellung davon, wie die Welt mit dem Menschen als Mittelpunkt erschaffen worden sein könnte.22 Der zweite, viel umfangreichere Teil der Geschichte beschreibt das Paradies, den Garten Eden, und das Geschehen, das sich dort abspielt.
Vor mehreren tausend Jahren stellten sich die Menschen das Paradies sicherlich als fruchtbares Ackerland mit ergiebigem Jagdrevier vor, in dem es keinen Nahrungsmangel gab. Werden die Aussagen der Bibel in diesem Sinne aufgefasst, können Regionen ausgemacht werden, auf die die spärlichen Hinweise zutreffen. Zusätzliche geographische Anhaltspunkte finden sich in Schriften anderer Kulturen Vorderasiens, die dieselbe Geschichte in abgewandelter Form enthalten. Die Beschreibungen liefern jedoch keine eindeutigen Ergebnisse, denn verschiedene Wissenschaftler kommen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen.
Selbst wenn man sich auf einen Ort einigen könnte, dürfte es schwerfallen, verschiedene Einzelheiten der Geschichte hinreichend zu erklären. Dagegen deutet der Begriff Baum der Erkenntnis meiner Meinung nach an, was es mit dem zweiten Teil der Schöpfungsgeschichte23 auf sich hat: Es geht um die Fähigkeit des Menschen zur objektiven Erkenntnis.
Weil den meisten Menschen die Mechanismen, die objektive Erkenntnisse ermöglichen, normalerweise nicht zugänglich sind, existieren dafür auch keine allgemein nachvollziehbaren Begriffe. Deswegen werden zur Erklärung symbolhaft bekannte Objekte der Außenwelt wie Garten oder Baum benutzt. Darüber hinaus wird auf einige Konsequenzen hingewiesen, die unauflöslich mit dem Erkenntnisapparat verknüpft sind.24
Was mit den Symbolen der Geschichte gemeint ist, erschließt sich intuitiv in der spirituellen Erfahrung. Dabei drängt sich auf, dass die Selbst-Wesensschau von allen Menschen gleichartig erfahren werden muss. Der Gott des zweiten Teils der Schöpfungsgeschichte kann daher verstanden werden als der persönliche Gott, als die ich-lose Person, die sich dem Menschen in demjenigen Bewusstseinszustand offenbart, der in dieser Abhandlung mit Wesen bezeichnet wird.
2.3.3 Die beiden Geschichten ergänzen sich
Was wir inzwischen über die Welt, die darin enthaltenen Objekte und die Veränderungen im zeitlichen Verlauf wissen, lässt uns erstaunen. Staunen darüber, in welch engen Bereichen die unzähligen Parameter eingestellt sind, die bei der Entfaltung des Universums eine Rolle spielen, so dass Raum und Zeit, Materie, Atome, ein Planet wie die Erde, Biomoleküle, lebensfähige Organismen, Pflanzen, Tiere und schließlich eine Spezies, die all das bis zu einem gewissen Grad erkennt, entstehen konnten.
Außer dem Menschen ist uns kein Lebewesen bekannt, das sich für derartige Dinge interessiert. Was ermöglicht uns, objektive Erkenntnisse erwerben zu können? Und welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Fähigkeit? Antworten auf diese Fragestellungen, um die es auch in der vorliegenden Abhandlung geht, gibt meiner Ansicht nach die Geschichte vom Garten Eden.
Den Menschen gäbe es nicht, wenn das Universum nicht existierte. Umgekehrt würde sich niemand für die Geschichte des Universums interessieren, wenn es keine Individuen mit dem Vermögen zur objektiven Erkenntnis gäbe. Nur gemeinsam liefern die beiden Teile der Schöpfungsgeschichte einen Rahmen zur Erklärung des Geschehens, so wie wir es in uns und um uns herum erleben.
10 Im Anhang sind einige Quellen aufgelistet.
11 Hinweise auf Erfahrungsberichte finden sich im abschließenden Kapitel.
12 Raymond A. Moody: Leben nach dem Tod – Die Erforschung einer unerklärlichen Erfahrung, Kapitel 2, Seite 42
13 Raymond A. Moody: Leben nach dem Tod – Die Erforschung einer unerklärlichen Erfahrung, Kapitel 2, Seite 38
14 Dr. Jeffrey Long mit Paul Perry: Beweise für ein Leben nach dem Tod, Einführung, Seite 16
15 Dr. Jeffrey Long mit Paul Perry: Beweise für ein Leben nach dem Tod, Einführung, Seite 17-33
16 Raymond A. Moody: Leben nach dem Tod – Die Erforschung einer unerklärlichen Erfahrung, Kapitel 2, Seite 41
17 Siehe beispielsweise die Briefe von Yaeko Iwasaki in Philip Kapleau: Die drei Pfeiler des Zen, Zweiter Teil, VI. Kapitel, Seite 377.
18 So taucht beispielsweise die Geschichte von der Sintflut in ähnlicher Fassung im babylonischen Gilgamesch-Epos auf.
19 Altes Testament der Bibel, 1. Buch Mose Kapitel 1., Vers 27.
20 Altes Testament der Bibel, 1. Buch Mose Kapitel 2., Vers 7.
21 Siehe bspw. Richard Elliot Friedman: Wer schrieb die Bibel?
22 Siehe auch Richard Elliot Friedman: Wer schrieb die Bibel? Kapitel 13, Seite 300,301
23 1.Buch Mose Kapitel 2., Vers 4. bis zum Ende des Kapitels 3.
24 Diese Interpretation wird bspw. durch Aussagen des Zen-Meisters Yamada Kuon gestützt; siehe Yamada Kuon Roshi: Teishos zum Hekiganroku: Band 2, 53. Fall, Seite 35.
3 Erkenntnisse der Philosophie
Vor etwa zwei- bis dreihundert Jahren wurden einige philosophische Schriften mit recht spekulativen metaphysischen Inhalten veröffentlicht. Weil unterschiedliche Autoren zu teilweise widersprüchlichen Aussagen gelangten, stellte sich die Frage, wie denn beurteilt werden kann, welche Arten von Schlussfolgerungen als gesichert gelten können und welche nicht. Allmählich setzte sich die Erkenntnis durch, dass zur Beantwortung dieser Frage zuerst einmal geklärt werden muss, in welchen Bereichen die menschliche Vernunft verlässliche Ergebnisse erzielt.
In der Folge haben sich viele Philosophen mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt. Einen besonders starken Einfluss nicht nur auf die Philosophie, sondern auch auf die Geistes- und Naturwissenschaften, übten die Schriften Immanuel Kants aus. Mit seiner Gedanken- und Begriffswelt setzten sich Generationen von Wissenschaftlern auseinander, auch viele – wenn nicht alle – der in dieser Abhandlung zitierten Philosophen und Wissenschaftler.
Inzwischen haben sich mehrere Wissenschaften herausgebildet, die sich mit dem menschlichen Geist, dem Gehirn oder dem Bewusstsein befassen, doch auch die Philosophie beschäftigt sich bis zum heutigen Tag mit derartigen Fragestellungen.25
3.1 Vernunft und Erkenntnisvermögen
Immanuel Kant ging es um eine kritische Beurteilung der Vernunft, weshalb er seine Schriften zu dieser Thematik auch als „Kritiken“26 bezeichnete. Er hatte nicht den aussichtslos scheinenden Anspruch, die Vernunft und das Erkenntnisvermögen vollständig zu beschreiben, sondern er wollte Klarheit darüber schaffen, für welche Arten von philosophischen Aussagen und Schlussfolgerungen das menschliche Erkenntnisvermögen geeignet ist und für welche nicht.
Um die Frage analytisch angehen zu können, unterteilte er die Geistesfunktionen zunächst in die reine Vernunft, die praktische Vernunft und die Urteilskraft. Diese Geistesfunktionen arbeiten natürlich nicht isoliert voneinander, sondern wirken bei vielen Vorgängen zusammen, ohne dass uns bewusst ist, welche wir jeweils nutzen.





























