
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Joy-Applebloom-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Gut gelaunt und abenteuerlustig – die neue Kinderbuchheldin Joy, die größte Optimistin der Welt, stößt an ihre Grenzen. Bisher war sie mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester immer auf Weltreise, doch nun zieht die Familie dauerhaft zum Großvater ins verregnete England, und Joy soll zum ersten Mal eine richtige Schule besuchen. Ihre Vorfreude verpufft, als sie merkt, dass ihr Traum vom In-die-Schule-gehen-und-neue-Freunde-Finden nichts mit der Realität zu tun hat. Als auch noch das einzig Gute an der Schule, die mächtige alte Eiche auf dem Schulhof, gefällt werden soll, kriegt Joy endgültig zu viel und beschließt, den Baum zu retten. Zum Glück gelingt es ihr, wieder die Silberstreifen am Horizont zu sehen, als sie überraschend Hilfe bei ihrer Protestaktion erhält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Jenny Valentine
Ich bin Joy
Aus dem Englischen von Anu Stohner
Mit Bildern von Claire Lefevre
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
An unserer Familie ist nichts Magisches, wie man es aus bestimmten Büchern kennt. Wir haben keinen Großvater, der fliegen kann, keinen Onkel, der heimlich an einer Zeitmaschine baut, und unsere Eltern sind keine im Verborgenen lebenden weltberühmten Zauberer. Unser Großvater benutzt einen Gehstock, wir haben überhaupt keine Onkel, und unsere Eltern sagen ständig Sachen wie: »Leg das sofort wieder hin, wo du’s herhast!«, oder: »Wo ist deine Schuluniform?«, oder: »Du räumst jetzt sofort dein Zimmer auf!«
Meine große Schwester Claude meint, das mache uns zu schrecklich normalen Leuten. Aber wir waren auch nie richtig normal, und ich finde nicht, dass wir plötzlich damit anfangen sollten.
Tatsache ist, dass sich bei uns in letzter Zeit einiges verändert hat. Wir leben schon normaler als früher, nicht mehr so ungebunden und frei. Und logisch, wir besitzen weder einen Zauberstab, der uns mit einem Schlag reich macht, noch steht uns ein hilfsbereites Wolfsrudel oder ein in ganzen Sätzen sprechender Felsblock bei. Wir haben noch keine parallelen Welten unter unseren Waschbecken oder in den Kleiderschränken entdeckt, und hinter unseren Wänden hausen keine perfekten Minimenschenwesen. An diesen Orten findet man bei uns Putzmittel, Anziehsachen und allerhöchstens Mäuse. Ich habe keine Schuhe, die von allein überall hinlaufen, sondern ein einziges Paar Turnschuhe, die mir mindestens eine Nummer zu klein sind und die ich trotzdem nicht wegwerfe, weil sie mit mir schon überall gewesen sind und mich bei keinem meiner vielen Abenteuer im Stich gelassen haben. Unsere Waschmaschine bekommt die Grasflecken aus Claudes kostbaren neuen Jeans genauso wenig heraus wie Papa den Kaffeefleck, den er neulich in Großvaters Teppich gemacht hat, also kann ich mir auch ziemlich sicher sein, dass keiner in unserer Familie die Gabe besitzt, Dinge zum Verschwinden zu bringen.
Ich glaube nur ganz fest, dass es mehr als nur eine Art von Magie gibt. Meines Erachtens ist es falsch, sie für unmöglich zu erklären oder nur in Geschichten zu erlauben. Es wäre einfach nicht gerecht. Claude sagt, es sei nur eine Frage, was man unter Magie verstehe, und ich verstünde nun mal was anderes darunter als sie. Sie wirft mir vor, vollkommen grundlos über die normalsten Dinge der Welt zu staunen und mich viel zu leicht beeindrucken zu lassen. Stimmt aber gar nicht. Ich bin nur ständig auf der Suche nach dem, was ich die praktische Alltagsmagie nenne, weil ich nämlich an sie glaube und ehrlich denke, dass wir jede Menge davon gebrauchen könnten.
Wenn ich davon spreche, verdreht Claude theatralisch die Augen und sagt: »Ach ja? Na, dann such mal schön! Viel Glück!«
Wenn du über keine märchenhaften Zauberkräfte verfügst, sind deine Probleme gleich viel weniger schick, und es macht auch nicht so viel Spaß, sie zu lösen. Zum Beispiel hat Papa den Kaffeefleck im Teppich nur schnell mit einem dicken Buch über Bäume zugedeckt, und jetzt liegt es mitten im Zimmer, wo es ungefähr so gut hinpasst wie ein Koffer in eine Pfütze. Jeden Moment könnte jemand – und natürlich am ehesten Großvater – darüber stolpern und die hässliche Wahrheit darunter entdecken. Claude sagt, dann könne sich Papa auf was gefasst machen, und es sei nur eine Frage der Zeit. Obwohl ich die Dinge immer positiv zu sehen versuche, denke ich, dass sie wahrscheinlich recht hat.
Ich bin zehn und Claude ist dreizehn.
Sie riecht nach Kirschen und schminkt sich die Augen ganz schwarz. Sie hat die geradesten und weißesten Zähne der Welt und das sonnigste Zahnpastalächeln, das ich je gesehen habe. Wenn sie glücklich ist, sieht sie wie jemand aus einem Werbeclip für strahlend weiße Zähne aus, aber im Moment kommt das nicht sehr häufig vor. Papa sagt, mit Claudes Zahnpastalächeln ist es wie mit Meteoritenschauern, die gibt es auch nur ein- oder zweimal im Jahr, und wenn du blinzelst, hast du sie schon verpasst.
Wir haben mal Meteoritenschauer gesehen: in Kalifornien, als ich sechs war und Claude neun. Allerdings hat es da die halbe Nacht Sterne geregnet, und ich bin eingeschlafen, bevor es zu Ende war. Damals hätte man lange blinzeln müssen, um was zu verpassen.
Claude ist kurz für Claudia Eloise und reimt sich auf ihren derzeitigen Lieblingssatz, der lautet nämlich: »Hier ist doch alles wie tot.« Seit wir nach England zurückgekommen und in Großvaters Haus gezogen sind, jammert sie, dass es hier nichts zu tun gibt und sowieso alles keinen Wert hat. Wenn sie es nicht hören kann, nennen Mama und Papa sie neuerdings die Backsteinmauer. Sie flüstern es hinter vorgehaltener Hand, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob das nötig ist. Soweit ich es beurteilen kann, hat Claude aufgehört, ihnen überhaupt noch zuzuhören, egal, was sie sagen.
Mama und Papa heißen Rina und Dan, kurz für Marina Jane Blake und Daniel Samson Applebloom. Seit wir hier wohnen, sind sie erstens hyperabwesend und zweitens megabeschäftigt mit Dingen, die sich wahrscheinlich ganz normal anhören, aber für sie vollkommen untypisch sind: Sie bewerben sich für Jobs, bei denen sie nicht reisen müssen, kümmern sich um Arzttermine und versuchen, Claude und mich in die richtigen Schulen einzuschleusen. So etwas waren wir von unseren Eltern bisher nicht gewohnt. Tatsächlich ist es das genaue Gegenteil dessen, was wir unser ganzes bisheriges Leben lang gewohnt waren. Darum macht es uns auch solche Sorgen. Claude ist der festen Meinung, Mama und Papa wären irgendwann, als wir gerade nicht dabei waren, komplett andere Persönlichkeiten eingepflanzt worden, wahrscheinlich nachts. Sie sagt, es könnte gut sein, dass die beiden gar nicht mehr unsere ursprünglichen Eltern sind und dass wir auf der Hut sein müssen, weil man bei ausgetauschten Persönlichkeiten mit absolut allem rechnen muss.
»Und du bist sicher, dass sie die einzigen Ausgetauschten sind?«, habe ich Claude gefragt, weil ich um sonst was wetten würde, dass mit ihr genau dasselbe passiert ist. Sie benimmt sich hundertprozentig nicht wie meine ursprüngliche Schwester. Vor allem ist sie nicht annähernd so witzig, wie sie mal war.
Bei mir hat man nichts neu eingepflanzt. Ich bin noch ganz genau wie immer, obwohl sich alles andere geändert hat. Meinen Namen kann man nicht abkürzen, und ich habe auch keinen zweiten. Er ist, wie er ist, und alle nennen mich nur Joy.
Das Hier, in dem wir uns jetzt befinden, ist das Haus von Großvater.
Er heißt Thomas Blake und ist der Vater von Mama, obwohl ich manchmal kaum glauben kann, dass sie überhaupt miteinander verwandt sind. Wenn ich es nicht wüsste, würde ich sie niemals für Vater und Tochter halten. Ehrlich nicht. Großvater ist irgendwie schemenhaft und verwischt, als wäre er mit einem weichen Bleistift gezeichnet, und Mama ist wie mit dickem schwarzen Filzer gemalt. Mama ist laut und bombastisch und bunt, Großvater eher schmal und still und blässlich. Mama ist Sozialdemokratin, was ein langes politisches Wort für jemand ist, der gut mit anderen teilen kann, und Großvater – nun ja, er ist kein Sozialdemokrat. Mama sagt, wir sind Weltbürger und sollten dafür eintreten, dass alle Menschen sich frei in der ganzen Welt bewegen können. Großvater würde wohl am liebsten einen hohen Zaun um unsere kleine englische Insel bauen. An dem Zaun hingen dann überall Schilder, und auf den Schildern stünde riesig groß:
KEIN DURCHGANG!
und
PRIVATGRUND
und
ZUTRITT VERBOTEN!
Es gibt eine lange Liste von Dingen, über die Großvater und wir anderen nicht einer Meinung sind. Das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb wir mit ihm mehr übers Wetter reden.
Auf Großvaters Fußabtreter vor der Haustür steht T. E. Blake, aber er verrät mir nicht, wofür das E. steht, darum habe ich beschlossen, es zu erraten. Ich mache einen Versuch pro Tag und vermute, dass ich noch kein einziges Mal auch nur in die Nähe der Wahrheit gekommen bin. Großvater korrigiert mich aber auch nicht, also mache ich immer weiter.
Thomas Elefant Blakes Gesicht ist voller Beutel und Knubbel wie ein alter Rucksack, und wenn er redet, füllen sich die Beutel und Knubbel mit Luft und leeren sich wieder. Die Post, die er bekommt, besteht fast nur aus Katalogen für beheizte Pantoffeln, Badewannen mit Türen für den seitlichen Ein- und Ausstieg oder als Lesebrille getarnte Hörhilfen. Ich finde die Sachen in den Katalogen genial, aber Thomas Eierbecher Blake kein bisschen. Er sagt, ständig kalte Füße zu haben und nicht mehr normal in die Badewanne hinein- und wieder herauszukommen sei genauso wenig ein Grund zum Jubeln wie schlecht zu hören oder zu sehen. So redet er über viele Dinge, weshalb ich glaube, dass er ganz allgemein kein Mensch ist, der gern jubelt. Er ist auch meistens grau angezogen und sieht dann aus, als käme er aus einem Zimmer, in dem gerade der Putz von der Decke gerieselt ist. Claude behauptet allerdings, das könne im Haus von Thomas Ernstnehmer Blake niemals passieren, weil darin selbst die unbelebten Dinge aussähen, als fürchteten sie sich vor jeder Art von Unordnung. Sie sagt, der Putz könne hier schon deshalb nicht von der Decke rieseln, weil er sich nicht traut.
Mama möchte, dass wir auch dann zusammenhalten, wenn mal Feuer unterm Dach ist, und das ist noch was, was Claude zufolge bei uns nicht passieren kann. Nicht im Haus von Großvater, der jeden Abend sämtliche Stecker aus den Steckdosen zieht, sagt sie. Und Mama sagt, wir sollen nicht voreilig über ihn urteilen. Um über jemanden angemessen urteilen zu können, müsse man ihn erst viel besser kennen. Außerdem sagt sie, Familie ist Familie, egal, wo man politisch steht, welche Vorstellungen man vom Zusammenleben hat oder woran immer man glaubt. Papa sagt, dass wir alle Geduld miteinander haben und uns gegenseitig Zeit geben sollten, bis sich der erste Staub gelegt hat.
Claude meint, der legt sich nie, und ich frage mich: Welcher Staub? Hier liegt doch nirgends das kleinste Körnchen! Aber unsere Eltern sagen, es lohne sich zu warten, irgendwann würden wir schon sehen, wie unser Großvater sich als bunter Schmetterling entpuppt. Oder wenigstens, wie der alte Python seine Haut abstreift.
In Mexiko habe ich Millionen Monarchfalter schlüpfen und mit ihrem Geflatter ganze Berghänge rot färben sehen. Auch eine Klapperschlange habe ich schon beobachtet, wie sie sich im heißen Wüstensand gehäutet hat. Dünn wie das Papier um einen Wachsmalstift war die alte Haut. Jedenfalls: Auf das Schauspiel, wenn Thomas Einhorn Blake sich entpuppt oder häutet, bin ich gespannt.
Claude schüttelt nur noch den Kopf: über mich, über Mama und Papa und überhaupt über die ganze neue enge Welt, in die wir hineingeraten sind. Wenn wir anderen reden, murmelt sie leise vor sich hin, und wenn ich es richtig verstehe, fragt sie sich, was das ganze Gequatsche überhaupt soll.
Bevor wir hier gestrandet sind, waren wir ständig auf Achse. Wirklich. Wir sind ich weiß nicht wie oft umgezogen und haben in allen möglichen Teilen der Welt gelebt, gearbeitet und Spaß gehabt, je nachdem. Schon zu Zeiten, als ich noch so klein war, dass ich mich selbst an nichts mehr erinnern kann. Claude, Mama, Papa und ich, wir waren immer frei wie die Vögel. In einem von Claudes vielen Notizbüchern gibt es eine Liste aller Orte, an denen wir schon gewesen sind, und ich habe die genaue Zahl vergessen, aber von den 195 Ländern, die es offiziell auf der Welt gibt, waren es eine Menge, obwohl natürlich immer noch genug übrig bleiben.
Großvater nennt das, was wir bisher gemacht haben, »ziellos in der Welt herumbummeln«. Mama und Papa nannten es immer »leben«. In der Pflanzenwelt wären wir so was wie die Hubschraubersamen von Ahornbäumen gewesen. Oder die kleinen Fallschirme, die von Pusteblumen davongeweht werden. Die lassen sich auch vom Wind durch die Gegend treiben und machen sich keinen Kopf, wo sie gerade sind.
Mama schaute sich, egal, wo wir waren, die Sonnenuntergänge an und seufzte: »Haben wir nicht ein Riesenglück?« Immer sagte sie, sie könne sich im Leben nicht vorstellen, irgendwo in einem Haus festzusitzen, womöglich noch in einer Straße, in der alle Häuser gleich aussehen und sich nie was ändert.
Und alle haben wir ihr recht gegeben.
Wenn es uns mal schwerfiel, Dinge hinter uns zu lassen, lagen neue, genauso schöne Dinge vor uns: das Café der kichernden Schwestern in Hanoi, in dem wir immer süße Suppe aßen, die Boote, mit denen wir von Mumbai aus zu den Elephanta-Höhlen fuhren, oder Fabiola, das Mädchen in Mexico City, das mir, ohne dass ich es richtig merkte, Rollschuhfahren und Spanisch gleichzeitig beibrachte.
Und wenn es wirklich mal Probleme gab, wie meinetwegen fiese Mücken, gebratene Meerschweinchen auf der Speisekarte oder Smog, so dick wie feuchte Watte, dann war es nur umso besser zu wissen, dass es ja bald weiterging.
Mein ganzes bisheriges Leben lang konnte ich mich darauf freuen, was als Nächstes kommt. Solange ich mich erinnern kann, gab es immer was Aufregendes zu tun und lag der nächste spannende Ort gleich um die Ecke.
Wir alle mochten das Leben genauso, wie es war, und ich kannte es auch gar nicht anders. Wahrscheinlich sagen Mama und Papa deshalb, ich sei das bestgelaunte und abenteuerlustigste Menschenkind, das sie kennen.
Als Mama und Papa uns erzählten, dass wir hierherziehen würden, waren wir genau 7403 km entfernt auf Sansibar, der Insel im Indischen Ozean, die vor Tansania an der Ostküste Afrikas liegt. Mama war in einem Krankenhaus beschäftigt, und Papa hat morgens Claude und mich unterrichtet und danach als Küchenchef in einem Hotel gearbeitet. Mama ist Krankenschwester und Papa Koch. Genauer gesagt, ist er der beste Koch, den ich kenne. Sein Essen bringt sogar Claude zum Lächeln, auch jetzt noch! Mama ist bestimmt auch spitze in ihrem Beruf, aber in der Küche hat sie gegen Papa keine Chance.
Auf Sansibar hatten wir ein Betonhaus mit Mückennetzen vor den Fenstern, und beim Einschlafen schaute ich durch die Maschen in den Himmel und hörte dem Meer beim Atmen zu. Bei Ebbe zog es sich an unserem Lieblingsstrand so weit zurück, dass wir über einen Kilometer laufen mussten, um ans Wasser zu kommen. Der Sand war feucht und fein und silbrig weiß, die Sonne machte unsere Schatten messerscharf, und Meer und Himmel waren so hell und klar wie diese berühmten blauen Edelsteine.
Um ganz Sansibar herum liegen Korallenriffe wie eine einzige atmende Mauer. An einem normalen Nachmittag sahen wir Schildkröten und Seepferdchen und Anglerfische und Trompetenfische und Porzellankrebse und Steinfische und jede Menge Oktopusse, einfach so, weil wir da waren, und ohne dass wir was dafür tun mussten. Ohne uns zu beachten, gingen sie alle ihren Unterwassergeschäften nach, während wir über ihren Köpfen schwammen und Sturmwolken an ihren Himmel strampelten. Die Sonne malte Muster ins Wasser, und wir bewegten uns, je nachdem, durch Warm und Kalt, aber immer über einer ganzen Welt voll Leben in Schatten und Licht.
An einem 1. April spielten wir Fußball mit Joseph, Prosper und Godfrey. Joseph und Prosper waren Brüder, und Godfreys Papa arbeitete im selben Krankenhaus wie Mama. Seit Wochen hatten wir an einem Ball aus Plastiktüten gebastelt. Immer, wenn wir eine fanden, kam eine neue Schicht dazu. Prosper, der es schon viele Male gemacht hatte, zeigte uns, wie es geht: Man muss jede neue Tüte richtig ordentlich um die alten herumwickeln, sonst geht sie kaputt oder bläht sich auf, dann wird das Ganze entweder eine Art Luftballon oder ein unbrauchbarer Plastikfetzenklumpen und jedenfalls kein Ball. Wenn Prosper groß ist, wird er mal reich, indem er aus dem vielen Zeug, das andere wegschmeißen, lauter schlaue Sachen macht. Plastiktüten sind ein echtes Problem für die Insel, und es ist verboten, sie irgendwo liegen zu lassen, aber die Touristen tun es trotzdem.
Als der Ball fast die richtige Größe hatte, redeten die Jungs schon darüber, womit wir als Nächstes anfangen würden, nämlich mit einer Art Kajak aus Plastikflaschen. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, aber leider sind wir abgereist, bevor es fertig war. Manchmal stelle ich mir vor, wie die Jungs mitten durch die blauen Edelsteinwellen auf der anderen Seite der Welt paddeln. Ich bin mir sicher, dass Prosper sogar ein Steuerruder für das Kajak erfunden hat, vielleicht aus einer alten Autoantenne und einer Schwimmflosse. Ich stelle mir vor, wie Schildkröten und Seepferdchen und Anglerfische und Trompetenfische und Porzellankrebse und Steinfische und jede Menge Oktopusse im Meer schwimmen und die laut lachenden Jungs oben über ihren Köpfen gar nicht beachten.
Der Umzugstag war für uns nie eine große Sache, daran waren wir gewöhnt. Es wartete ja immer was Neues auf uns, und es gab viele Orte, an die man als Nächstes reisen konnte. Anders war es nur an diesem einen 1. April. Als Claude und ich da nach Hause kamen, waren ein paar Warnhinweise nicht zu übersehen.
Erstens waren Mama und Papa beide da. Auf Sansibar waren sie sonst nur freitagabends gleichzeitig zu Hause, und es war Mittwoch. Erster Warnhinweis.
Außerdem merkten wir, dass sie auf uns gewartet hatten, und das war genauso ungewöhnlich. Zweiter Warnhinweis.




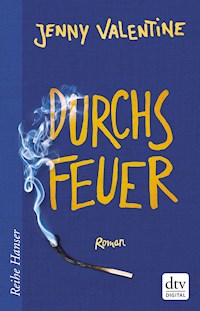













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










