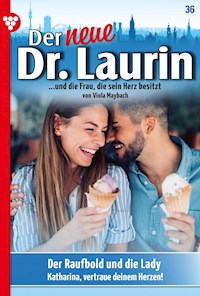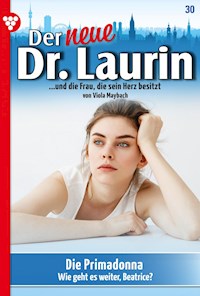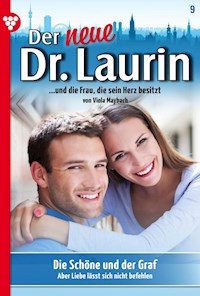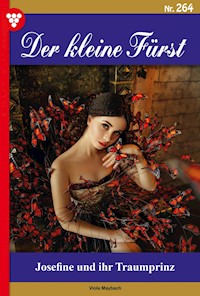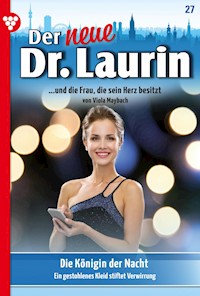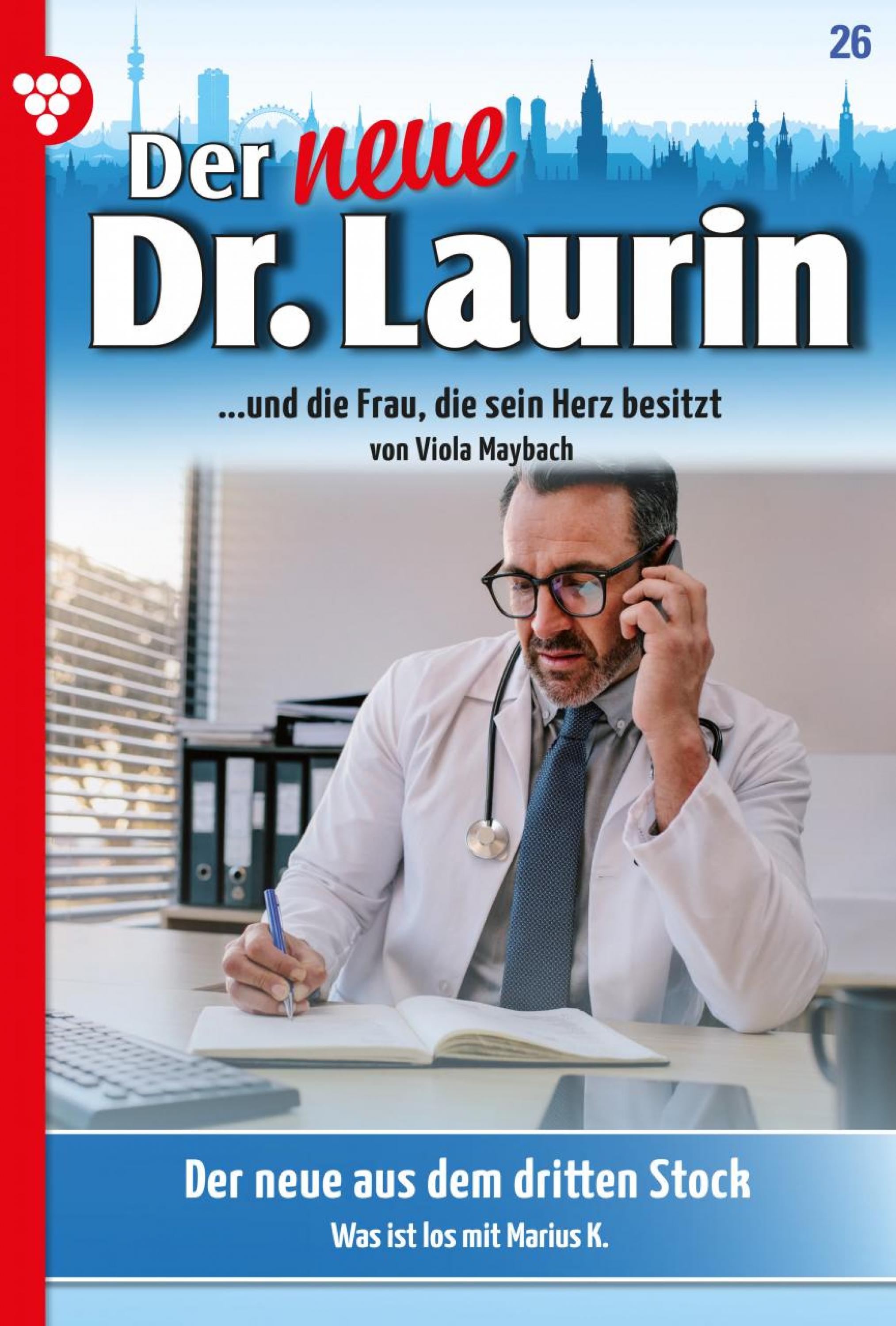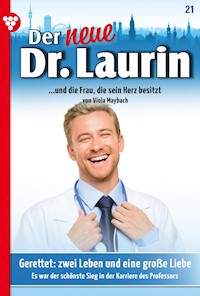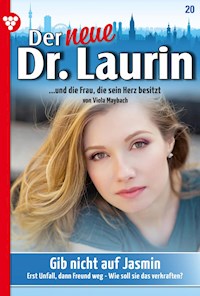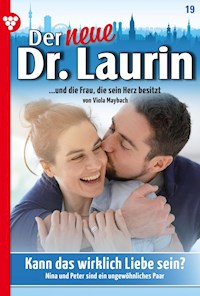Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der neue Dr. Laurin
- Sprache: Deutsch
Diese Serie von der Erfolgsschriftstellerin Viola Maybach knüpft an die bereits erschienenen Dr. Laurin-Romane von Patricia Vandenberg an. Die Familiengeschichte des Klinikchefs Dr. Leon Laurin tritt in eine neue Phase, die in die heutige moderne Lebenswelt passt. Da die vier Kinder der Familie Laurin langsam heranwachsen, möchte Dr. Laurins Frau, Dr. Antonia Laurin, endlich wieder als Kinderärztin arbeiten. Somit wird Antonia in der Privatklinik ihres Mannes eine Praxis als Kinderärztin aufmachen. Damit ist der Boden bereitet für eine große, faszinierende Arztserie, die das Spektrum um den charismatischen Dr. Laurin entscheidend erweitert. »Mir tun die Füße weh«, sagte Selina Warburg, ließ sich auf eine Holzbank fallen und legte die Beine auf einen Stuhl. »Und mir tut der Rücken weh.« Kristin Andermatt blieb stehen und machte ein paar Dehnübungen, streckte den Oberkörper nach hinten, nach vorne und zu den Seiten, bevor sie ihn nach unten fallen ließ. So blieb sie stehen, mit dem Kopf vor den Schienbeinen, während sie leicht nach unten und oben wippte. Hinter dem Tresen stand Willi Fahrenholz, ihr Chef, nachdem er zuvor bereits angefangen hatte, aufzuräumen und ein bisschen zu fegen. Er zapfte drei Pils, die er eigenhändig zu dem Tisch trug, an dem Selina saß. »Prost«, sagte er. »War ein harter Abend, ich weiß.« »Danke, Willi«, seufzte Selina, griff nach dem Bier und leerte das Glas mit einem Zug bis zur Hälfte. »Oh, das war jetzt echt gut«, sagte sie, legte den Kopf zurück und schloss die Augen, während sie mit den Zehen wackelte. Ihre Schuhe hatte sie inzwischen abgestreift. Kristin rollte den Oberkörper langsam nach oben, streckte sich ein letztes Mal und setzte sich zu den beiden anderen, auch sie ließ sich ihr Bier schmecken. Willi grinste und griff ebenfalls nach seinem Glas. So saßen sie jeden Abend, wenn die letzten Gäste ›Willis Kneipe am Eck‹ verlassen hatten, noch für ein paar Minuten zusammen und ließen den Tag ausklingen. Willi stand seit fünfundzwanzig Jahren hinter dem Tresen. Damals, mit dreißig, hatte er sein Lokal eröffnet und bereits gewusst, dass er nicht zum Angestellten geboren war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der neue Dr. Laurin – 109 –Ich bin nicht Marilyn!
Unveröffentlichter Roman
Viola Maybach
»Mir tun die Füße weh«, sagte Selina Warburg, ließ sich auf eine Holzbank fallen und legte die Beine auf einen Stuhl.
»Und mir tut der Rücken weh.« Kristin Andermatt blieb stehen und machte ein paar Dehnübungen, streckte den Oberkörper nach hinten, nach vorne und zu den Seiten, bevor sie ihn nach unten fallen ließ. So blieb sie stehen, mit dem Kopf vor den Schienbeinen, während sie leicht nach unten und oben wippte.
Hinter dem Tresen stand Willi Fahrenholz, ihr Chef, nachdem er zuvor bereits angefangen hatte, aufzuräumen und ein bisschen zu fegen. Er zapfte drei Pils, die er eigenhändig zu dem Tisch trug, an dem Selina saß. »Prost«, sagte er. »War ein harter Abend, ich weiß.«
»Danke, Willi«, seufzte Selina, griff nach dem Bier und leerte das Glas mit einem Zug bis zur Hälfte. »Oh, das war jetzt echt gut«, sagte sie, legte den Kopf zurück und schloss die Augen, während sie mit den Zehen wackelte. Ihre Schuhe hatte sie inzwischen abgestreift.
Kristin rollte den Oberkörper langsam nach oben, streckte sich ein letztes Mal und setzte sich zu den beiden anderen, auch sie ließ sich ihr Bier schmecken. Willi grinste und griff ebenfalls nach seinem Glas. So saßen sie jeden Abend, wenn die letzten Gäste ›Willis Kneipe am Eck‹ verlassen hatten, noch für ein paar Minuten zusammen und ließen den Tag ausklingen.
Willi stand seit fünfundzwanzig Jahren hinter dem Tresen. Damals, mit dreißig, hatte er sein Lokal eröffnet und bereits gewusst, dass er nicht zum Angestellten geboren war. Er wollte sein eigener Chef sein, mit allen Unwägbarkeiten, die das mit sich brachte. Tatsächlich hatte er tiefe Täler durchschreiten müssen, aber seine Kneipe gab es immer noch, und darauf war er stolz, zumal sie in den letzten Jahren besser lief denn je.
Heute war Willi ein Mann mit schulterlangen, gepflegten grauen Locken und einem ordentlich gestutzten Bart. Um die Mitte herum war er etwas fülliger geworden, das stand ihm gut, und da er ein zufriedener, in sich ruhender Mensch war, saßen die Gäste gern an seinem Tresen und vertrauten ihm ihre Kümmernisse an. Er kannte alle, die häufiger kamen, mit Namen, behielt, auch im Gespräch, dennoch das Lokal im Blick und wenn es etwas zu feiern gab, spendierte er auch gerne einmal eine Lokalrunde. Leute, die sich schlecht benahmen, warf er aus dem Lokal und empfahl ihnen dringend, sich nie wieder blicken zu lassen, da kannte er nichts. Dem Zulauf an Gästen schadete das nicht, im Gegenteil.
Je älter Willi wurde, desto mehr wurde er zu einem Original, das man unbedingt kennen musste. Die Frauen liebten ihn, und nicht wenige hatten schon versucht, ihn für sich zu gewinnen. Aber Willi liebte die Frauen zwar auch, aber seine Unabhängigkeit noch ein bisschen mehr. Mit einer allein wollte er sich nicht zufriedengeben, und so kam es immer wieder zu bitteren Enttäuschungen bei denen, die ihm zumindest zeitweise etwas näherkamen. Wenn es dann zu Ende war, wirkte Willi immer ein bisschen erleichtert, während sich die Frauen nicht mehr im Lokal blicken ließen. Zumindest eine Zeit lang nicht. Danach kamen viele wieder, warfen Willi sehnsüchtige Blicke zu, näherten sich ihm aber nicht mehr.
Selina Warburg arbeitete schon seit ihrem neunzehnten Lebensjahr für ihn, seit zehn Jahren also. Einige Jahre zuvor hatte er sie, mehr oder weniger, auf der Straße aufgelesen, wo sie wieder einmal auf der Suche nach ihrer drogensüchtigen Mutter gewesen war. Er hatte ihr geholfen, die Mutter zu finden – und dann, sich von ihr abzunabeln. Damals war sie ein mageres dunkelhaariges Mädchen mit riesigen schwarzen Augen gewesen, sechzehn Jahre alt, und sie hatte schon in mehr Abgründe geblickt, als andere in einem langen Leben.
Mit vierzehn war sie, obwohl klug und lernbegierig, von der Schule gegangen, um sich um ihre Mutter zu kümmern. Damit war sie natürlich vollkommen überfordert gewesen. Willi hatte ihr klargemacht, dass es Zeit wurde, sich um sich selbst zu kümmern, und so hatte Selina eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau gemacht, danach war sie seine erste Angestellte geworden. Seitdem gab es in seinem Lokal auch Kleinigkeiten zu essen. ›Kalte Küche‹, nannte Selina das, aber sie hatte eine richtige Kunst daraus gemacht, und auch dafür war Willis Lokal heute bekannt und berühmt.
Von der mageren Sechzehnjährigen war jedenfalls nichts mehr übrig. Heute war Selina eine sehr attraktive junge Frau mit weiblicher Figur, deren dunkle Augen leuchteten, und die fast immer lächelte. Sie war, seit sie auf eigenen Füßen stand, die Ausgeglichenheit in Person, so schnell warf sie nichts mehr um.
Kristin war zuletzt dazugestoßen, sie jobbte hier als Aushilfe und hatte sich schnell mit Selina und Willi angefreundet. »Du passt zu uns«, hatte Selina schon nach wenigen Tagen gesagt, und so fühlte es sich auch für Kristin an. Sie hatte studiert und eigentlich ganz andere Berufspläne, die sich aber aus verschiedenen Gründen nicht verwirklichen ließen. Da war der Job bei Willi nicht die schlechteste Übergangslösung. Kristin war der Typ ›schöne, aber kühle Blonde‹ – jedenfalls war es das, was die meisten Menschen dachten, wenn sie sie sahen. Doch so kühl, wie sie wirkte, war Kristin nicht. Aber im Lokal half ihr diese Ausstrahlung, da wagten es die angeheiterten Männer nicht so ohne Weiteres, ihr mit plumpen Annäherungsversuchen zu kommen.
Doch Willi hatte auch darauf ein Auge, wenn es ihm zu bunt wurde, wies er seine Gäste ohne zu zögern zurecht. Selina und Kristin standen unter seinem Schutz, alle Stammgäste wussten das, die anderen lernten es schnell.
»Was war denn eigentlich los heute?«, fragte Kristin. »Es ist ja immer voll hier, aber so wie heute habe ich es bislang selten erlebt. War das nur wegen Günters Geburtstag?«
Günter war einer der Stammgäste, er verbrachte mehrere Abende pro Woche bei Willi.
»Er ist sechzig geworden, immerhin«, sagte Willi. »Und er hat allen Bescheid gesagt, die er kannte, sie sollten doch heute Abend kommen. Und alle sind gekommen.«
»Verrückt«, murmelte Kristin und stand wieder auf, um erneut ein paar Dehnübungen zu machen. Als sie sich wieder aufrichtete, sagte sie: »Aber trinkgeldmäßig war es heute der Hammer, den Leuten saß das Geld locker.«
»Kannst du laut sagen. Insofern sollten wir Günter dankbar sein«, fand Selina. Sie leerte ihr Glas und stand auf. »Ich muss nach Haus, Leute, tut mir leid. Es wäre schön, noch etwas mit euch hier zu sitzen und zu quatschen, aber ich kann echt nicht mehr.«
»Ich gehe mit dir«, sagte Kristin.
»Bis morgen ihr beiden. Sehr gute Arbeit heute«, sagte Willi und setzte mit breitem Lächeln hinzu: »Wie immer. Aber heute wart ihr besonders gut, ihr habt euch selbst übertroffen und euch die Zulage verdient. Waren schließlich doppelt so viele Leute da wie sonst.«
»Und die haben einen Höllenlärm gemacht, manchmal habe ich gedacht, mir platzt der Kopf«, sagte Selina.
Sie verabschiedeten sich von Willi und traten hinaus in die warme Nacht. Wie auf Kommando blieben sie beide vor der Tür des Lokals stehen und blickten nach oben.
»Zu hell in der Stadt, um einen richtig schönen Sternenhimmel zu sehen«, seufzte Selina. »Schade.«
Sie liefen ein Stück des Wegs gemeinsam, beide hatten es nicht weit nach Hause. An der Ecke, wo sie sich trennen mussten, umarmten sie sich. »Bis morgen, schlaf gut!«, sagten sie wie aus einem Mund, lachten, und eilten in verschiedene Richtungen weiter.
Als Kristin ihre kleine Wohnung betrat, war sie froh über die Stille, die sie empfing. Gut, dass sie jung war, sonst hätte sie einen Abend wie diesen nicht so gut weggesteckt, nahm sie an. Er war wirklich die Hölle gewesen. Es hätte sie interessiert, wie viele Kilometer sie gelaufen und wie laut es über Stunden in der Kneipe gewesen war. Sie wunderte sich wieder einmal darüber, dass Willi, der ja immerhin schon Mitte fünfzig war, diese Belastungen nur wenig auszumachen schienen. Aber natürlich: Das Lokal war gewissermaßen sein Lebenswerk, und er hatte sich vermutlich im Lauf der vielen Jahre, die er dort nun schon arbeitete, an die eher unangenehmen Begleiterscheinungen seiner Arbeit gewöhnt.
Sie besah sich die Post, die sie aus dem Briefkasten gefischt hatte und warf sie auf den Tisch, wo auch noch die Todesanzeige ihrer Hamburger Großtante Emilia Andermatt lag, die vor zwei Wochen gestorben war. Emilia war eine Tante ihres Vaters gewesen, sie war weit über neunzig geworden. Sie trauerten aufrichtig um die alte Dame, ihr Vater war vor allem in letzter Zeit öfter zu ihr nach Hamburg gefahren. Jedes Mal hatte er bei der Rückkehr gesagt: ›Erstaunlich, wie fit sie im Kopf noch ist, in ihrem Alter.‹
Kristin hatte Emilia nicht oft in ihrem Leben gesehen, sich aber dennoch mit der alten Dame gut verstanden, sie hatten immer mal wieder miteinander telefoniert. Ihr Vater hätte seine Tante gerne nach München geholt, auch Kristin hätte das schön gefunden, doch davon hatte Emilia nichts wissen wollen. »Das Sprichwort sagt ja, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Ich habe mein ganzes Leben in Hamburg verbracht, ich werde die Stadt in meinen letzten Jahren nicht mehr verlassen.«
Kristin erinnerte sich vor allem an ein längeres Gespräch, das sie mit Emilia anlässlich eines Besuches bei ihr in Hamburg geführt hatte. Da war es um Zukunftsträume gegangen, um das, was sich Kristin vom Leben erhoffte. Sie war selbst erstaunt darüber gewesen, dass sie der Tante ihres Vaters, die sie zwar gern mochte, die aber keine enge Vertraute für sie gewesen war, hatte erzählen können, was sie sich wünschte, wovon sie träumte. An jenem Nachmittag vor ein paar Jahren waren sie einander sehr nahe gewesen.
Nach diesem Gespräch hatte sie Emilia öfter als zuvor angerufen, und immer hatte diese sich sehr gefreut, ihre Stimme zu hören. Sie hatte auch gelegentlich nachgefragt, ob Kristin der Verwirklichung ihrer Träume nähergekommen war. Das war leider nicht der Fall, hatte Kristin einräumen müssen.
Als sie jetzt die Anzeige noch einmal las, überkam sie einmal mehr eine Welle der Traurigkeit, weil ein Mensch gegangen war, den sie gerngehabt und der Anteil an ihrem Leben genommen hatte. Merkwürdig, wie deutlich sie das erst jetzt spürte: Emilia lebte nicht mehr, es würde keine Telefonate mit ihr mehr geben. Emilia war kein Teil ihres täglichen Lebens, ihr aber dennoch nahe gewesen. So nahe, dass sie zumindest ein Gespräch miteinander geführt hatten, in dem es um wesentliche Fragen gegangen war und das deshalb für immer in Erinnerung bleiben würde.
Sie ließ sich auf einen Stuhl sinken, plötzlich von Scham und Reue übermannt. Warum hatte sie Emilia nicht regelmäßig angerufen? Warum war sie nicht öfter nach Hamburg gefahren, um Zeit mit ihrer Großtante zu verbringen? Gut, sie hatte wenig Geld und war immer müde von der anstrengenden Arbeit, aber trotzdem: Warum hatte sie sich nicht klargemacht, dass die Zeit tickte, dass es bald zu spät sein würde für solche Unternehmungen?
Ihr kamen, heftiger als beim Öffnen der Todesanzeige, die Tränen angesichts der unwiederbringlich verpassten Gelegenheiten. Sie ließ sie laufen. Es war sogar eine Erleichterung, um Emilia zu weinen, wie sie es vorher nicht vermocht hatte. Sie war ja nicht einmal zur Urnenbeisetzung gefahren! Sie hatten eine Hochzeitsfeier im Lokal gehabt, da hatte sie schlecht Urlaub nehmen können, und selbst ihr Vater hatte gemeint, es sei nicht nötig, dass sie ihn begleitete. »Du hast sie doch gar nicht so gut gekannt, Kind, bleib hier, ich fahre ja hin.«
Sie war froh gewesen, dass er es ihr so leicht gemacht hatte. Jetzt tat es ihr leid. ›Die letzte Ehre erweisen‹ – das bedeutete ja etwas. Davor drückte man sich nicht, nur weil es bequem war. Aber genau das hatte sie getan.
Schließlich schob sie den kleinen Poststapel zusammen und stand auf. Sie würde demnächst einmal nach Hamburg reisen, Emilia auf dem Friedhof besuchen und Abbitte leisten.
Sie sah noch schnell nach ihren E-Mails und wünschte sich sofort, sie hätte es nicht getan. Sie hatte eine weitere Absage bekommen, genau genommen war es die vierunddreißigste.
Das war ein weiterer Tiefschlag, obwohl sie sich an diese Art von Niederlage allmählich hätte gewöhnt haben sollen. Doch vermutlich gewöhnte man sich nie daran.
*
Finn Kellermann stand am Grab von Emilia Andermatt und sagte leise: »Ich bin dann also weg, Frau Andermatt. Meine Sachen sind schon in München, ich fahre nachher, und dann beginnt für mich ein neues Leben mit einem neuen Job in einer neuen Stadt und hoffentlich bald mit neuen Freunden. Sie fehlen mir jetzt schon, das wollte ich Ihnen noch sagen.«
Er machte eine Pause, dachte nach, und setzte dann hinzu: »Aber natürlich komme ich gelegentlich wieder und statte Ihnen hier einen Besuch ab, das ist ja selbstverständlich. Ich danke Ihnen für alles, was Sie für mich getan haben – ich habe das nicht annähernd verdient, aber ich denke, das wissen Sie. Bis dann!«
Da er merkte, dass ihm die Kehle eng wurde, drehte er sich schnell um und wollte davongehen, als er einen schmalen grauhaarigen Mann näherkommen sah, den er sofort wiedererkannte, obwohl er ihn nur bei wenigen Gelegenheiten getroffen hatte: Es war Emilia Andermatts Neffe Bernhard Andermatt, ein schmaler Mann mit schönen grau-grünen Augen. Auch er erkannte Finn sofort wieder. »Herr Kellermann!«, sagte er. »Sie besuchen also auch gerade meine Tante.«
»Ja, genauer gesagt, ich habe Abschied genommen, weil ich ja nach München ziehe. Dieses ist erst einmal mein letzter Besuch hier.«
»Richtig, Sie hatten ja erwähnt, dass Sie umziehen. Melden Sie sich unbedingt, Sie haben doch meine Nummer?«
»Das mache ich bestimmt«, versprach Finn, »aber erst einmal werde ich damit beschäftigt sein, mich in meiner neuen Umgebung zurechtzufinden. Für mich ist ja alles neu …«
»Aber Sie haben immerhin eine Wohnung gefunden?«
»Dabei hat mir mein neuer Arbeitgeber geholfen, zum Glück.«
Finn würde künftig für eine Stiftung arbeiten, indem er deren Gelder verwaltete. Er war bislang bei einer Hamburger Bank beschäftigt gewesen, hatte aber schon länger nach einer neuen Aufgabe gesucht.
»Haben Sie noch Zeit? Ich würde Sie gern zum Essen einladen. Sie haben so viel für meine Tante getan …«