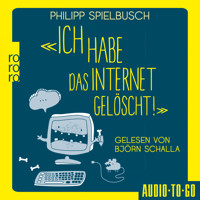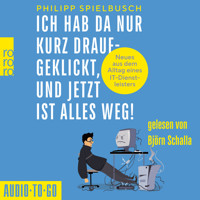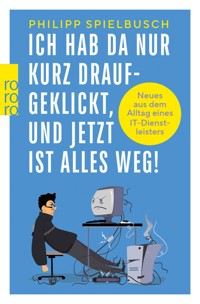
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
«Verzeihung? Sind Sie der Computermann? Können Sie mal kurz gucken?» Mit dieser Frage beginnen für Philipp Spielbusch lange Tage. Denn auch im Jahr 2025 ist das Leben als IT-Dienstleister nicht leichter geworden. Da lösen sich die Daten in der Cloud einfach in Luft auf, Influencer geben im Netz fatale Techniktipps, und verrückt spielende Smart Homes nehmen ihre Bewohner als Geiseln. Derweil werden die Kunden immer frecher, die KI immer schlauer und die Zeiten immer verrückter. Außerdem ist da noch Jonas, der einfach nicht mehr aus dem Büro ausziehen und ganz sicher den Beweis gefunden haben will, dass wir sowieso alle in einer Simulation leben. Ein urkomischer Blick auf unseren täglichen Kampf mit der alltäglichen Technik – von einem, der dem «Problem am anderen Ende des Kabels» immer wieder den Allerwertesten rettet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Philipp Spielbusch
Ich hab da nur kurz draufgeklickt, und jetzt ist alles weg!
Neues aus dem Alltag eines IT-Dienstleisters
Über dieses Buch
«Verzeihung? Sind Sie der Computermann? Können Sie mal kurz gucken?»
Mit dieser Frage beginnen für Philipp Spielbusch lange Tage. Denn auch im Jahr 2025 ist das Leben als IT-Dienstleister nicht leichter geworden. Da lösen sich die Daten in der Cloud einfach in Luft auf, Influencer geben im Netz fatale Techniktipps, und verrücktspielende Smart Homes nehmen ihre Bewohner als Geiseln. Derweil werden die Kunden immer frecher, die KI immer schlauer und die Zeiten immer verrückter. Außerdem ist da noch Jonas, der einfach nicht mehr aus dem Büro ausziehen und ganz sicher den Beweis gefunden haben will, dass wir sowieso alle in einer Simulation leben.
Ein urkomischer Blick auf unseren täglichen Kampf mit der alltäglichen Technik – von einem, der dem «Problem am anderen Ende des Kabels» immer wieder den Allerwertesten rettet.
Vita
Philipp Spielbusch ist der duldsamste IT-Berater der westfälischen Provinz. Seine Firma PSC richtet die Netzwerke mittelständischer Firmen ein, repariert Rechner aller Art und betätigt sich als Notarzt für jedes Problem. In seiner Freizeit fährt er als E-Sportler SIM-Racing. Philipp Spielbusch beherrscht 8 Programmiersprachen, 25 Betriebssysteme und rund 350 Stammkunden. Seine beiden Kinder hat er weniger im Griff. Mit seiner Partnerin Jutta lebt er in Drensteinfurt bei Hamm.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung zero-media.net, München
Coverabbildung FinePic®, München
ISBN 978-3-644-02372-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Pro bono
Der Wind singt in der Krone der alten Esche. Zuvor hat er einen Umweg über die Hallen genommen, über die Parkplätze und Hinterhöfe der benachbarten Firmen. Wir sind umgezogen, Wulf und ich. Weg aus dem Dorf, wo der Blick auf den schmucklosen Kreisverkehr fiel, links dahinter in der einen Richtung der Netto und in der anderen das zerrupfte Randgebüsch der Gärten von Menschen, die wir niemals kennengelernt haben. Ohnehin, jetzt fällt es mir auf, hat unsere Dienste nie jemand im unmittelbaren Umkreis von fünfhundert Metern gebucht. Hatten die keine Rechner? Oder lief bei denen über Jahrzehnte alles einwandfrei? Wie wahrscheinlich ist das? Einen Kreisverkehr haben wir jetzt wieder im Blickfeld, allerdings einen, den kaum jemand benutzt, denn diese Runde um die alte Esche bildet gleichzeitig das Ende unserer Straße, sieht man von der Einfahrt zum lokalen Hufschmied ab. In der selbstbestimmten Pause stehe ich gern hier vor der Tür und lausche dem Wind. Schrecklich die Vorstellung, ich würde meine kleine IT-Firma mitten in einer Großstadt betreiben.
«Verzeihung? Sind Sie der Computermann?»
Ich schwinge herum, in die Richtung, aus der die Stimme nah wie aus einem Headset an mein Ohr dringt. Ein kleiner Mann mit Arbeitshose und Viertagebart, wahrscheinlich aus einem der Betriebe die Straße hinab. Uralte, eingesessene Unternehmen, bei denen das Gemäuer bröckelt und der Fuhrpark die Kulisse für einen fünften Teil von Mad Max bilden könnte.
Trotz schwerer Stahlkappenschuhe hat der Mann sich nicht durch Schritte angekündigt. Ein lautloser Schleicher, wie in Stealth-Videospielen. Metal Gear Solid trifft Bob, der Baumeister.
«IT-Service», antworte ich, um meiner Tätigkeit mehr Glanz zu verleihen, als der Begriff «Computermann» es vermuten lassen würde.
Der Mann nickt eifrig, kolibrischnell schwingt das Kinn auf und ab. Er zögert kurz, als wäre er nicht sicher, mich was fragen zu dürfen, doch dann hält er mir sein Telefon hin.
«Das auch?»
«Handys sind ebenfalls IT», sage ich. Sein Gerät ist ein Smartphone, aber eher eins für Baustelle, Wald und Bohrinsel. Gummipuffer an allen Seiten, fester Grip, feiner Dreck zwischen Display und Rand. Stammt aus China, wirkt aber, als wäre es in den Minen von Mordor geschmiedet.
«Können Sie mal kurz gucken? Irgendwie kann ich nicht mehr telefonieren. Da steht: Nur Notruf.»
Das wäre auch ein guter Titel, denke ich mir. Für ein zweites Buch. Können Sie mal kurz gucken? Neues aus dem Alltag eines IT-Dienstleisters. Seit einigen Jahren bin ich zwar weiterhin hauptberuflich ein «Computermann», aber nebenher auch Schriftsteller, was ich immer noch kaum fassen kann. In der Branche hat mein Buch über das, was ich so tagtäglich erlebe, weite Kreise gezogen. Und hier in der münsterländischen Heimat hat es natürlich auch die Runde gemacht. Der Bauarbeiter scheint allerdings nichts davon zu wissen.
Ich seufze. Nicht, weil der Mann mein Buch nicht kennt, sondern weil all die unbezahlten Momente, in denen ich nur mal «kurz gucke», mir bereits das erste Haus in Monaco finanziert hätten, wären sie reguläre Aufträge gewesen. Aber gut, ich gucke, denn ich ahne bereits, was mit dem Gerät los sein könnte.
«Zeigen Sie mal her.»
Mit dem erleichterten Blick eines Jungen, dem endlich jemand sein aufgeschlagenes Knie verarztet, drückt er mir das Telefon in die Hand. Es fühlt sich schmierig und sandig zugleich an, wie ein verschwitzter Körper, der im Urlaub am Strand im Sand paniert worden ist.
«Ihre SIM wird nicht erkannt», sage ich.
«Wer?»
«Die kleine Karte, die Ihr Telefon überhaupt erst mit der Welt verbindet. Wo Ihre Nummer drauf ist und vielleicht sogar die Kontakte, falls Sie die auf der SIM speichern und nicht im Telefon, oder, wie ich es ja empfehlen würde, in der Cloud, bei Google. Dann können Sie sicher sein, immer Zugriff auf die Daten zu haben, egal mit welchem Telefon.»
Der Mann schaut mich an, als hätte ich beim Matheunterricht in der Grundschule so Kinkerlitzchen wie Plus, Minus, Mal und Geteilt übergangen und wäre direkt zur Riemannschen Vermutung gesprungen.
«Na, wie dem auch sei», wische ich seine Verwirrung aus der Morgenluft, die SIM-Karte da drinnen wird einfach nur den Kontakt verloren haben. Das passiert manchmal, wenn Telefone starken Stößen ausgesetzt sind. Und bei der Arbeit ruckelt’s sicher den ganzen Tag, oder?»
Der Mann nickt und lässt dabei zugleich seine Augenbrauen wippen.
Ich inspiziere die Rückseite. Die Abdeckung ist mit vier Schrauben befestigt. Schlitzprofil.
Die Augenbrauen tanzen mehr denn je, als der Mann in seine Tasche greift und ein kleines Universalmesser hervorholt, an dem sich ebenfalls Korkenzieher, Dosenöffner und zahlreiche andere Tools befinden – und ein kleiner Schlitzschraubendreher.
Ich nicke anerkennend und nehme das Ding entgegen. Der Mann lacht und zeigt mit dem astgleichen Finger in das von Zufallspassanten verschonte Gewerbegebiet: «Hier draußen gibt’s ja kein Messerverbot.»
Ich lache bitter mit.
«Und selbst wenn, gilt es ja eh nur zwischen 22 und 6 Uhr.»
Ich schraube die Abdeckung auf, hebe sie behutsam ab und zeige ihm, wo die SIM-Karte eingeschoben ist. Ein sehr stabiler Rahmen.
«Sehen Sie? Das Ding meinte ich.»
«Ach so! Ja, die hat mein Neffe da reingeschoben, als er mir den Vertrag besorgt hat!»
Es ist so typisch. Nur sehr wenige bleiben offen und neugierig, beschäftigen sich mit der Zeit sogar mehr mit ihren Geräten. Die meisten aber treibt die seltsame Überzeugung, beim Überschreiten des fünfzigsten Lebensjahrs automatisch jede Fähigkeit zu verlieren, auch nur das Einfachste zu begreifen, was mit ihren Rechnern oder Telefonen zu tun hat. Sie legen ihr datentechnisches Dasein komplett in die Hände anderer. Nur in die Hände der Cloud oder gar der KI, da wollen sie es nicht legen, trotz all der Vorteile, die es hat. Zumindest nicht hier, auf dem Land.
Ich berühre die Karte. Sie sitzt bombenfest. Kein Vor, kein Zurück. Behutsam führe ich das Telefon an den Mund und puste. Doch egal, wie es von außen aussieht – von innen ist diese Baustellenmöhre klinisch rein.
«Hm, die scheint guten Kontakt zu haben.»
«Was ist es dann?»
Ich schließe das Gerät wieder, Schraube für Schraube. Für einen Augenblick verlangsamt sich die Zeit, als ich die kleinen Dinger neben dem lieben Mann eindrehe. Solche einfachen Handgriffe sind wie ein Kokon aus Ruhe, irgendwie meditativ. Kann das Ding nicht acht oder zwölf Schrauben haben? Oder hundert?
«Und?»
Ich lege die Hand auf das wieder verschlossene Gerät und überlege. Nach einer Sekunde schnellt mein linker Zeigefinger in die Höhe. Ihm scheint’s noch zügiger eingefallen zu sein als mir selbst. Ich fahre das Android-Betriebssystem hoch und finde mich direkt auf dem Menü-Bildschirm wieder. Keine Sperre. In den Einstellungen suche ich nach der entscheidenden Einstellung und finde sie. Ich tue, was getan werden muss, reiche ihm das Gerät und sage: «Versuchen Sie mal.»
Kurz erscheint seine Zungenspitze zwischen den Lippen und zieht sich wieder zurück, während die Brauen tanzen. Er wählt eine Nummer. Nach zwei Sekunden geht auf der anderen Seite jemand ran.
«Kostas, ja, ich wollte nur kurz testen, ob mein Telefon wieder geht. Ja. Genau. Wir sehen uns heute Abend.»
Er legt auf, indem er mit dem Zeigefinger das Hörersymbol anpeilt und trifft, wie eine Katze, die den Punkt des Laserpointers jagt.
«Wie haben Sie das gemacht?»
Ich zeige ihm das Menü, in dem sich die SIM-Karte mithilfe eines Schiebereglers ausschalten lässt.
Wenn das Telefon verkündet, dass nur noch Notrufe funktionieren, gibt es keine Kommunikation mehr zwischen der SIM-Karte und dem Gerät. In vielen Fällen sitzt das kleine Ding nicht mehr richtig oder hat durch Schmutz den Kontakt verloren. Wir reden hier von winzigen Störquellen, die aber in der Relation zu dem, was auf der Karte geschieht, gar nicht winzig sind. Die SIM ist wie eine kleine Stadt aus Schaltkreisen, bei der jedes Haus nur die Größe eines Sandkorns hat. Dringt nun fremder Dreck in diese Straßen ein, schiebt er sich vor die Türen wie ein massiver Felsbrocken oder ein gigantischer Sturm, der tonnenweise Unrat aus der nahe gelegenen Steppe mit sich führt. Daher hilft es meistens, die Karte zu entfernen, vorsichtig Karte wie Slot freizupusten und sie wieder einzusetzen. Das säubert die Stadt und rückt den Kontakt, sollte er minimal verschoben gewesen sein, wieder gerade. Der viel seltenere Fehler besteht darin, dass die Karte im Menü deaktiviert ist, je nach Telefon aufzufinden etwa unter Einstellungen → Verbindungen → Netzwerk & Internet → SIM-Kartenverwaltung oder bei Einstellungen → Mobilfunknetz oder an noch anderer Stelle, die sich über das Suchfeld oben bei den Einstellungen manuell auffinden lässt. Auf Apple-Geräten kann dieser letztere Fehler allerdings nicht geschehen – im Betriebssystem iOS kann eine SIM-Karte nicht einfach auf diese Weise deaktiviert werden.
Der Mann sieht mich an, als hätte ich ihm erklärt, im kommenden Quartal die Heizung aus seinem Keller zu reißen und ihm zugleich den Betrieb des Kamins zu verbieten.
«Man kann dieses SIM-Ding ausschalten?»
«Ja.»
«Wieso?»
Die Frage ist berechtigt. Ich freue mich, wenn meine Kunden mitdenken. Obwohl, er ist ja gar kein Kunde, sondern ein «Mal eben kurz gucken»-Typ. Ob er ans Trinkgeld denken wird? Bevor ich ihm antworten kann, macht er ein paar Schritte auf die Straße, die nach dem seltenen Mineral Strontianit benannt ist, und gestikuliert.
«Die Karte macht mein Telefon erst zum Telefon, aber es gibt eine Funktion, mit der sich sie ausschalten lässt? Das ist doch völlig absurd! Das ist ja so, als würde man im Auto einen Knopf einbauen, der den Motor komplett unbrauchbar macht, selbst wenn ich den Zündschlüssel drehe. Oder drüben bei uns in der Halle – nee, der Stapler geht heute nicht, den haben wir abgeschaltet. Wieso gibt es dafür ein Menü, als wäre das überhaupt eine Wahlfrage? Geht gar nicht ist doch keine Option!»
Vergnügt beobachte ich, wie der Mann sich austobt. Er hat ja recht. Aber als Fachmann muss ich seine rhetorische Frage dann doch beantworten.
«Nehmen wir an, Sie wissen, dass Sie in den kommenden Stunden auf gar keinen Fall telefonieren oder ins Netz gehen werden. Wenn Sie die Karte komplett ausschalten, spart das ein paar Megabyte. Also, theoretisch. Denn irgendwas verbraucht das Gerät immer. Oder Sie haben zwei Karten in Betrieb und wollen eine rausnehmen, ohne das Telefon abzuschalten.»
Der Bauarbeiter kommt zum Stehen und überlegt, ob es Sinn ergibt, was ich da sage. Über uns zieht ein Schwarm Gänse dahin, die aus dem Winterurlaub zurückkehren. Ihr melodisches Geschnatter tönt bis hierher zu uns Bodenbewohnern.
«Unfug!», urteilt der Mann mit einem erstaunlich schönen Wort. «Wenn ich nicht telefonieren will, mache ich den Flugmodus an. Den kenne ich. Und wenn ich die Karte raushole, schalte ich es aus. Und eine zweite Karte mit zweiter Nummer haben nur Verbrecher. Ja, gut, vielleicht für Schwarzarbeit, aber … nein, das habe ich nicht gesagt.»
Kurz wird er rot im Gesicht, dann winkt er noch einmal freundlich, ruft ein «Danke!» hinter sich auf den Weg in meine Richtung und läuft zu seinem Arbeitsplatz zurück.
Kein Trinkgeld. Habe ich’s mir doch gedacht.
Wenn jemand sein Anliegen mit «Können Sie mal kurz gucken?» einleitet, ist mit keinerlei Bezahlung für die Dienstleistung zu rechnen. Schätze daher vorher gut den Zeitaufwand ein, der bei dieser Frage von zwei Minuten bis zu zwei Tagen dauern kann, und entscheide, wo die Grenze für dich für Pro-bono-Einsätze liegt. Was einen einzelnen Einsatz angeht sowie auch für die Gesamtanzahl solcher Gefälligkeiten, die du im Jahr zu leisten bereit bist. Auf diese Weise entlastest du dich vom stetigen Kampf deines sozialen mit deinem geschäftlichen Gewissen.
Ich schaue dem Bauarbeiter hinterher und gönne mir noch ein paar Züge an der E-Zigarette. Derzeit habe ich als Aroma Blaubeere mit Himbeere in Betrieb, auf Englisch Blueberry Sour Raspberry, was Wulf besonders lustig findet, da der Raspberry Pi ja auch ein winziger, kreditkartenkleiner Ein-Platinen-Computer ist, mit dem interessierte Nerds aller Altersklassen eigene Programmiererfahrungen machen können. Satte 45 Millionen Exemplare hat die Stiftung, die das Ding herstellt, mittlerweile verkauft – mehr als von mancher Videospielkonsole abgesetzt wurde. So verschieden ist die Lebenswirklichkeit der Menschen in den Zwanzigerjahren des 21. Jahrhunderts – die einen haben von der Technik überhaupt keine Ahnung und die anderen kaufen sich die IT-Entsprechung zum anspruchsvollsten Fischer-Technik-Kasten überhaupt.
Ich stecke meine Dampfe zurück in die Tasche und erinnere mich daran, wie das früher gewesen ist, wenn ein Mann wie ich eine Zigarettenpause auf der Straße vor der Firma gemacht hat. Niemand steckte den Filter des fertig gerauchten Glimmstängels in die Tasche oder in eine Mülltonne. Stattdessen warf man ihn einfach auf den Boden, atmete die letzte Fuhre Qualm mit halb geschlossenen Clint-Eastwood-Augen aus und beendete die letzte Glut, indem man den giftigen Filter noch einmal mit der Spitze seines Schuhs kraftvoll in den Asphalt einrieb. Niemand wusste zu der Zeit, dass ein einziger dieser Filter rund sechzig Liter Grundwasser verseuchen kann und eine Ewigkeit braucht, um zu verrotten. Aber man hätte es ahnen können.
Bevor der Handwerker seine Kollegen am Tor des Firmenhofs erreicht, hebt er sein Telefon und wackelt mit der Hand. Einer der Kollegen, der wie eine Playmobil-Figur genau mittig zwischen einem Palettenberg und einem Gabelstapler steht, hebt lachend den Daumen. Ich gehe hinein.
Im Büro ist es angenehm still. Wulf hat seine Gewohnheit, am Tag nicht mehr als zwanzig Sätze zu sprechen, beibehalten. Zusätzlich haben wir uns darauf geeinigt, dass das kleine Digitalradio die Nachrichten, die Werbung und die Popmusik der 80er, 90er und gegenwärtigen Jahre nur noch in Flüsterlautstärke in die Räume abgeben soll, wie ein Raumerfrischer seine feinen Pumpstöße. Vom Klangteppich der meist angenehmen und vertrauten Popmusik als Untermalung der Arbeit hört man so immer noch genug. Die Nachrichten allerdings werden so angenehm gedämpft, sie sind nicht mehr als das Wispern der Geister in der Maschine, ihr Inhalt belastet nicht länger. Kein Mensch kann im Jahre 2025 noch konzentriert arbeiten, wenn er gleichzeitig stündlich den Neuigkeiten aus aller Welt ausgesetzt ist. Was früher in mehreren Jahren geschah, stürzt nun im Wochentakt auf uns ein. Kriege, Attentate, gigantische Brände, Flugzeugabstürze, Putschversuche, Regimewechsel, rätselhafte Todesfälle, neue Viren, Massenmissbrauch Minderjähriger durch Rap-Stars und Schauspieler. Erfundene und tatsächliche Verschwörungen, die es nicht leichter machen, mit unserem Dauergast Jonas umzugehen, der zwar immer noch keinen Bundestrojaner auf dem Rechner installiert bekommen hat, mittlerweile aber bei zahllosen Themen mit dem Fingerknöchel auf den Tisch klopfen und sagen kann: «Seht ihr, ich hab’s doch immer gesagt!»
Das Radio schickt gerade auf sanften Schwingen «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» von U2 durch den Flur. Es steht dort, um uns alle gleichzeitig in den neuen, viel größeren Räumlichkeiten zu versorgen. Meine Partnerin und Controllerin Jutta, Licht meines Lebens, aber auch meiner Zahlen, die vorn aus dem Extrabüro für die Buchhaltung winkt. Wulf in seinem eigenen Reich abseits der Werkstatt, wo er hinter fünf geschwungenen Monitoren, die einen Halbkreis bilden, wie der Chef eines Geheimdienstes wirkt und wo zwei noch leere Arbeitsplätze auf neue Mitarbeiter warten. Und mich in meinem kleinen Büro schräg gegenüber, in das der Glastisch und zwei Sofas gewandert sind.
«I have run through the fields / only to be with youuuu.»
U2 hatten es 2014 geschafft, sich dadurch unbeliebt zu machen, dass sie ihr neues Album ungefragt und zwangsweise an alle verschenkten. Aber was heißt schon verschenken? Es war auf einem speziellen U2-iPod vorinstalliert, der fünfzig Euro mehr kostete als das übliche Modell. Nix pro bono.
Ich ziehe mir einen Kaffee am großen, schwarzen Vollautomaten mit dem digitalen Display, über dem ganz analog das Whiteboard mit unseren Strichlisten hängt. Wir führen immer noch Buch über die häufigsten Sätze und Ausrufe der Kunden. Den ersten Platz hält weiterhin «Ich hab nix gemacht!». Die etwas trotzige Wendung «Das kann ja gar nicht sein!» hatte den zweiten Platz eine Weile lang erobert, ist aber längst wieder aus den Top 5 gefallen. Eine Weile lang wäre «Bleiben Sie gesund!» auf die eins gegangen, aber den haben wir mangels IT-Bezug nicht mitgezählt. Dafür eroberten in der Corona-Zeit, als alle plötzlich den ganzen Tag in virtuellen Meetings saßen, ganz neue Sätze die oberen Plätze. «Ich komm da nicht mehr rein!» oder «Du bist eingefroren!» oder «Du hörst uns noch, aber wir hören dich nicht mehr.» In den vergangenen zwei Jahren haben sich die Probleme dann wieder verschoben und langsam, aber sicher kriechen «Einen neuen Rechner kann ich mir nicht leisten», aber auch «Dann frage ich lieber ChatGPT» Platz für Platz nach oben. Ich nehme den Stift und mache einen Strich neben dem Klassiker «Können Sie mal kurz gucken?», der beständig zwischen Platz 7 und Platz 12 changiert, aber nur dann zählt, wenn auf die Hilfe wirklich keinerlei Bezahlung folgt.
Wulf arbeitet in der Werkstatt, die man zwischen unseren beiden Bürotüren als Kopfraum betreten kann und aus welcher der Blick auf den einsamen Kreisverkehr mit der Esche fällt, an einem großen Desktop-Rechner. Diese klobigen, schweren Geräte, deren Seitenwand man aushaken und wie ein Chirurg jedes einzelne Organ in ihnen austauschen und optimieren kann, sind bei normalen Nutzern immer seltener geworden. Als ab den Neunzigerjahren nach und nach jeder Haushalt einen Computer bekam, waren sie selbstverständlich der Standard, und selbst der ganz normale Nutzer hatte eine vage Vorstellung davon, was wir meinten, wenn wir von der Grafikkarte, der Soundkarte, dem Motherboard oder der Erweiterung des temporären Speichers durch frische RAM-Riegel sprachen. Überall standen die Dinger unter Schreibtischen oder sogar in einem eigens dafür gedachten Computerschrank, den die Möbelhäuser damals zu Zehntausenden verkauften. Die Tastatur auf einem ausziehbaren Brettchen, die Maus daneben auf einem oft individuell bedruckten Pad, über dessen leicht raue Gummifilz-Oberfläche die damals noch physische Kugel gut gleiten konnte … um dabei all den Staub einzusammeln, der regelmäßig zu entfernen war. Richtige Lautsprecherboxen, angeschlossen an den Klinkeneingang im Rücken des Rechners. Tiefe Röhrenbildschirme, die beim Umzug neben Kühlschrank, Waschmaschine und Fernseher zum Schwersten gehörten, was zu tragen war.
Vor allem unter Gamern sind große Rechner allerdings sogar häufiger geworden. Zahllose Firmen bieten hochpreisige Kompositionen aus Komponenten voller Hardware-Power, gern mit einer Glasscheibe verkleidet, sodass man das Innenleben, schick mit LEDs beleuchtet, bewundern kann. Unsere Privatkunden gehören weniger zu dieser Gruppe und kommen meist mit Laptops zu uns, an denen immer weniger überhaupt demontierbar ist. Wulf stellt sich der Herausforderung trotzdem jedes Mal, studiert jede Schraube der kleinen Klapprechner und sucht nach Möglichkeiten, sie irgendwie öffnen und wieder schließen zu können, obwohl sie immer öfter sogar einfach verklebt sind. Hin und wieder wechseln wir noch eine Tastatur bei diesen Laptops, aber in den meisten Fällen wollen die Menschen einfach nur ihre Daten gerettet haben und tauschen die Hardware selbst alle paar Jahre so beiläufig aus, wie man es mit einem Smartphone zu tun pflegt. Nein, Laptops machen bei Weitem nicht so viel Freude wie richtige Rechner beziehungsweise das, was Wulf und ich weiterhin als richtige Rechner bezeichnen, und ich bin froh, auf dem Land zu leben, wo neben jungen Gamern auch immer noch genug erwachsene Herren und manchmal auch Damen existieren, die selbst für Word, Windows 11 und aktuelle Anwendungen weiterhin nach einem Großgerät verlangen.
Während Wulf sich mit einem richtigen Computer vergnügen darf, habe ich die Fleißaufgabe auf dem Tisch, ein Kleingerät einzurichten. Die Kundin, Frau Westerholt aus dem Neubauviertel am Ortsrand, das sich Jahr für Jahr näher an die Bauernschaft heranfrisst, hat mir in schöner Schreibschrift auf einem karierten DIN-A5-Block ihre Wünsche notiert. Ein «richtiges» Office solle es sein, bloß nicht das neue, wo alles nur in der Wolke ist und sich sogar automatisch mit den Servern von Microsoft synchronisiert.
«Meine Briefe gehören mir», sagte Frau Westerkamp, als sie den Laptop in unsere Werkstatt trug. Sie schreibt noch viele davon, druckt sie auf einem der letzten Tintenstrahler des Münsterlands aus, garniert den Text mit ein paar kleinen Zeichnungen und einer Unterschrift aus dem Füller und schickt die Dinger auf klassischem Postwege zu Verwandten und Freunden im ganzen Bundesgebiet und dem europäischen Ausland. Auf den zahlreichen Kreuzfahrten, die sie als frühe Witwe zum Unmut ihrer Kinder bucht, weil jede davon das Erbe um eine nicht unerhebliche Summe weiter abschmelzen lässt, lernt sie eine Menge neuer Menschen kennen. Kein Microsoft 365 also, sondern die klassische Variante des Office-Pakets, einst in großen Kartons vertrieben, heute als Lizenz online zu erwerben. Ein gutes Anti-Viren-Programm wünscht die ehemalige Gattin eines Spediteurs, der die Firma damals gerade noch rechtzeitig verkaufte, um die ersten Kreuzfahrten mit seiner Frau gemeinsam erleben zu können, ebenfalls. Außerdem Outlook für die wenige Post, die nicht in Umschläge kommt, sowie einen guten Browser. «Und, ach ja», fügte Frau Westerkamp vor einigen Tagen im Konferenzraum, den wir auch noch extra eingerichtet haben, noch hinzu und tippte mit den rot lackierten Nägeln auf ihren Notizblock, «machen Sie mir was Schönes zum Spielen drauf. Auf Seite 2 habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben.»
Ich nehme den Block zur Hand und lese die Titel. Der U2-iPod stand im Jahre 2004 in den Regalen, also bereits vor zwei Jahrzehnten, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Ich sag mal so: das neueste der von Frau Westerkamp notierten Spiele kam noch vor «Songs of Innocence» heraus.
Die meisten Menschen gehen davon aus, dass alle Systeme endlos abwärtskompatibel sind. Das liegt daran, dass wir alle selbst endlos abwärtskompatibel sind und vor allem als Erwachsene ständig den Eindruck haben, die Alben von Nirvana, die Getränkedose mit der Lasche zum Abreißen oder die Wahl von Angela Merkel zur Kanzlerin wären gestern gewesen. Die Einsicht, dass vor allem Technik die Zeit nicht konserviert, ist daher den Menschen auch psychologisch behutsam zu erklären.
Ich greife zum Hörer und rufe die Kundin an. Den Betrieb einer Festnetzanlage lasse ich mir nicht nehmen, auch wenn sie inzwischen natürlich als Voice-Over-IP läuft. Doch das tatsächliche Abheben eines echten Hörers ist wundervoll … und außerdem hat man nur so die Möglichkeit, auch mal ganz erbost mit einem lauten Knall aufzulegen. Die Kunden, die das mit ihrem Smartphone versucht haben, habe ich schon zur Handywerkstatt in der Nachbargemeinde geschickt.
«Westerkamp?»
«Ja, hallo, Frau Westerkamp, Spielbusch hier. Ich rufe an wegen der wunderbaren Spiele, die Sie wieder auf Ihrem neuen Rechner haben wollen. Das sind, wie soll ich sagen, sehr klassische Titel.»
«Fünf Prozent!»
Frau Westerkamp lacht, während sie das sagt. Wie jemand, der ein Kind dabei beobachtet, wie es das erste Mal Die Monster AG schaut, ganz vorn auf der Sesselkante, und mit seinen acht Jahren nicht weiß, was als Nächstes passiert.
«Wie? Fünf Prozent.»
«Fünf Prozent dürfen Sie auf Ihr Honorar draufschlagen. Darum geht’s doch, oder? Wir haben das jedenfalls damals in der Spedition immer so gemacht.»
«Was haben sie gemacht?»
«Was wollten Sie gleich sagen, Herr Spielbusch? Welcher Satz lag Ihnen auf den Lippen? Seien Sie ehrlich.»
«Na ja …»
Sie nimmt mir die Antwort ab.
«Das wird nicht ganz so einfach. Das wollten Sie doch sagen, nicht wahr?»
Mein Schweigen am Hörer redet laut davon, wie gut sie den Nagel auf den Kopf getroffen hat.
«Sehen Sie? Wenn damals jemand in der Spedition angerufen hat, mit einem ganz normalen Auftrag, sagen wir, zehn Paletten Papierwaren hier vom Münsterland rauf nach Hamburg. Keine offene Ladung, kein Gefahrengut und die meiste Zeit geradeaus. Dann habe ich trotzdem kurz am Telefon geseufzt, zu meinem Mann gesehen, der nickte, und zum Kunden gesagt: ‹Das wird nicht ganz so einfach.› Damit er kurz Angst kriegt, dass aus dem Terminauftrag nichts wird. Man kann dann noch Gründe erfinden von wegen Feuergefahr oder der aktuellen Baustellenlage auf der Strecke, die komplexe Umleitungsfahrten erfordert. So oder so, irgendwann kam dann der Satz, den wir alle als Dienstleister hören wollen. Na, kennen Sie ihn?»
Ich räuspere mich. Das Digitalradio wispert jetzt «Bad Liar» von Selena Gomez über den Flur, als wüsste es, was gerade geschieht.
«Herr Spielbusch, es muss Ihnen nicht unangenehm sein. Der Satz lautet natürlich: ‹Und was können wir da machen?› Wenn der fällt, haben wir den Kunden. Jackpot. Zuvor habe ich mir irgendeinen Zusatzaufwand ausgedacht und fünf Prozent mehr berechnet, die den schweren Auftrag auf einmal doch möglich machen. Nur fünf Prozent? Der Kunde war erleichtert. Jedes Mal. Und für uns haben sich die ständigen fünf Prozent über die Jahrzehnte so geläppert, dass sie allein schon drei Kreuzfahrten finanziert haben.»
Ich höre der Frau zu und frage mich, ob ich für diese Welt zu gut geraten bin.
«Ich erfinde die Schwierigkeiten nicht. Computer sind nicht so einfach abwärtskompatibel.»
«Wieso nicht? Ich kann mich heute noch in einen alten Passat aus den Achtzigern setzen und über die Autobahn flitzen.»
«Der Vergleich hinkt, Frau Westerkamp. Fahren Sie überhaupt einen alten Passat?»
«Nein, einen blutjungen Benz.»
Meine Güte, was muss sich das Speditionswesen unter Kohl, Schröder und der frühen Merkel gelohnt haben.
«Gut», fahre ich fort, «können Sie in dem brandneuen Benz noch Kassetten abspielen?»
«Ach so!», scheint sie zu begreifen. «Sie meinen, es liegt daran, dass mein neuer Rechner keinen Schlitz mehr für die CDs hat, auf denen die Spiele hier rumliegen?»
Einen Moment lang weiß ich nicht, ob diese frische Information mich erleichtert oder stresst. Ohne virtuelles Betriebssystem werde ich ihre Wünsche nicht erfüllen können, und sicher könnte ich Dateien der alten Spiele irgendwo im Netz finden. Sie alle schon zu haben, samt der Lizenzcodes, erleichtert so einiges. Und ein CD-ROM-Laufwerk lässt sich extern anschließen.
«Sie haben alles da? Das ist gar kein Wunschzettel, sondern eine Inventurliste?»
«Wenn Sie’s so ausdrücken wollen.»
«Das mit dem Laufwerk ist kein Problem», erkläre ich, «es liegt am Betriebssystem. Es ist zu schnell. Der Rechner denkt anders, wenn Sie so wollen.»
«Dann war Ihre Metapher mit den Kassetten im Auto aber auch schief», sagt Frau Westerkamp. «Dann hätten Sie sagen müssen, ich will in einer uralten Opelkarosserie mit einem heutigen Porschemotor fahren.»
Einen Moment bin ich sprachlos.
«Gibt’s denn eine Lösung? Hallo? Herr Spielbusch?»
Ehe ich meinen Mund bremsen kann, fällt es aus ihm heraus: «Ja, aber das wird nicht ganz so einfach.»
Jetzt lachen wir beide schallend los, sodass sogar Wulf den Kopf aus der Werkstatttür streckt.
«Fünf Prozent», sage ich, mir ein Tränchen aus dem Augenwinkel wischend. «Das kriege ich hin.»
Wer sehr alte Spiele wiederbeleben möchte, ohne sich dazu einen zweiten Rechner mit der alten Original-Hardware hinzustellen, kann den alten Rechner auf seinem neuen simulieren. Dazu braucht man eine Software wie VirtualBox, mit der man eine «virtuelle Maschine» auf dem aktuellen PC einrichten, das Betriebssystem bestimmen und diesem «Rechner im Rechner» die passenden Ressourcen zuweisen kann. Dann muss man diesem virtuellen Rechner nur noch eine virtuelle Festplatte (VDI – Virtual Disk Image) zuordnen und darauf erst das alte Betriebssystem und dann, wenn vorhanden, die alten Programme und Spiele installieren – genau, wie man es auch auf einem echten machen würde. Dazu nutzt man entweder sogenannte ISO-Dateien aus dem Netz oder man hat sein altes Windows XP, sein altes Office und die zwanzig Jahre alten Spiele tatsächlich noch physisch auf CD herumliegen. Trotz allem gilt besonders bei den Spielen, dass man oftmals noch sehr lange mit den Einstellungen der Bildschirmauflösung, der Farbtiefe und der Sound-Erzeugung herumprobieren muss, bis sie wirklich auf dem virtuellen Rechner laufen. Mit anderen Worten: Das wird nicht ganz so einfach.
Einige Stunden lang versinke ich in der Aufgabe. So mag ich das, selbst, wenn ich keine fünf Prozent draufschlagen dürfte. Eine Mission statt Dutzender gleichzeitig, konzentriertes Single Tasking. Es hat Vorteile, dass ein Teil der Kundschaft sich heutzutage gern über WhatsApp meldet