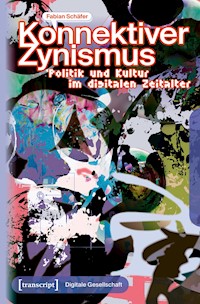Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: 110th
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ich hab`rübergemacht! - Alle wollten in den Westen, nur ich nicht! Hunderttausende ostdeutsche Landsleute machten in den Jahren nach der Maueröffnung rüber in den Westen. Ich habe auch rübergemacht, aber genau in die andere Richtung. Und dafür hielten mich damals nicht wenige meiner Kumpels aus der westfälischen Heimat für einigermaßen bekloppt! "Ich hab` rübergemacht!" ist nicht zwingend autobiographisch, sondern eine Satire. Erleben Sie, wie man sich als Wessi fühlte, einen Plattenbau zu beziehen, als Betonkutschenfahrer den "Aufbau Ost" mit voranzutreiben, beim Einkaufen im Baumarkt schier zu verzweifeln und in weiteren haarsträubenden Situationen die Angleichung von Ost und West Schritt für Schritt mitzuerleben. Die Stationen dieser Ereignisse sind Hannover, Bonn, Berlin, Jena und Dresden und erstrecken sich von 1984 bis 2010.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fabian Schäfer
Ich hab` rübergemacht!
Alle wollten in den Westen, nur ich nicht!
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek. Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie (zuvor erschienen unter OSSILAND);
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Impressum:
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Autors
oder der beteiligten Agentur chichiliy agency unzulässig.
Titelbild: © dreamtimes.com
Umschlaggestaltung: chichili agency
© 110th / chichili agency 2015
EPUB ISBN 978-3-95865-678-9
MOBI ISBN 978-3-95865-679-6
Kurzinhalt:
Hunderttausende ostdeutsche Landsleute machten in den Jahren nach der Maueröffnung rüber in den Westen. Ich habe auch rübergemacht, aber genau in die andere Richtung. Und dafür hielten mich damals nicht wenige meiner Kumpels aus der westfälischen Heimat für einigermaßen bekloppt!
„Ich habe rübergemacht!“ ist keine Autobiographie, sondern eine Satire. Erleben Sie, wie man sich als Wessi fühlte, einen Plattenbau zu beziehen, als Betonkutschenfahrer den „Aufbau Ost“ mit voranzutreiben, beim Einkaufen im Baumarkt schier zu verzweifeln und in weiteren haarsträubenden Situationen die Angleichung von Ost und West Schritt für Schritt mitzuerleben. Die Stationen dieser Ereignisse sind Hannover, Bonn, Berlin, Jena und Dresden und erstrecken sich von 1984 bis 2010.
Fabian Schäfer wurde als Wassermann 1965 in Lippstadt in Westfalen geboren. Nach der Bundeswehrzeit in Bremen und Hannover, einer Buchhändlerlehre in Göttingen und dem Studium in Deutsch und Geschichte in Bonn, wohnte er von 1991 bis 2006 in Jena. Weitere Stationen waren Leipzig und Dresden, wo er heute mit seiner zweiten Frau lebt. Er hat zwei Söhne aus erster Ehe.
Hinweis: Diese Satire erschien bereits unter dem Titel „Ossiland“ unter dem Pseudonym Sebastian F. Alzheimer
Inhalt
Vorwort
Teil I Damals (1984–1993)
Schützenfest
Student sein
Dunkel-Deutschland
Maueröffnung
Heimkehr
Notarzt
Plattenbau
Strukkis
Aufbau Ost
Teil II Heute (2002/2003)
Erholung
Lebensqualität
VIP-Bereich
Rock-Event
Coitus Interruptus
Fünf Sterne
Spießer
Stammtisch
Baumarkt
Penisverlängerung
Feiertag
Teil III Nachspiel (2010)
Blaues Wunder
Danksagung
Vorwort
Die Ostdeutschen auf dem Treck in den „goldenen Westen“ waren wohl ziemlich gut durch das Westfernsehen darüber informiert, was sie „drüben“ erwartete (vielleicht mit Ausnahme einiger weniger im „Tal der Ahnungslosen“, in meiner heutigen Heimatstadt Dresden, die ich mit Abstand für die schönste Stadt Deutschlands halte).
Ich hatte allerdings keine Ahnung, was mich wirklich erwartete, als ich 1991 der Liebe wegen nach Jena zog. (Meine erste Frau war am 9. November 1989 morgens noch über Hof in den Westen geflüchtet). Sieht man einmal von einer nächtlichen Zugfahrt von Bonn nach West-Berlin ab und einem Tagesausflug über die Friedrichstraße nach Ost-Berlin, den ich ein Jahr vor der Mauereröffnung erlebte, und der mich eher erschauern ließ, als mich zu einem Leben im Osten zu motivieren. Aber das war im Wiedervereinigungstaumel schnell vergessen.
Ihr Fabian Schäfer
Dresden im März 2012
Teil I
Damals (1984–1993)- Schützenfest
Es war in den ersten Jahren der Kohl-Ära. Viele von meinen Klassenkameraden wurden wie ich unmittelbar nach dem Abitur einberufen und dadurch von der geliebten Mutterbrust beinahe gewaltsam entwöhnt. Während der Grundausbildung war nicht nur mir mehr als einmal zum Heulen zumute. Aber schließlich wollten wir ja keine Weicheier sein, und so haben wir uns alle mehr oder weniger tapfer über fünfzehn Monate zu richtigen Männern formen lassen. Diese Feststellung beziehe ich weniger auf die militärischen Fähigkeiten, die wir erlernten. Im darauf folgenden Leben in Freiheit haben diese uns wohl nicht allzu sehr geholfen. Kameradschaft und Teamgeist waren vor allem gefragt und wurden auch von den meisten von uns erfolgreich praktiziert.
Besonders gefordert wurden diese Eigenschaften bei so wichtigen Events wie Gewaltmärschen oder Stubenreinigen, die unsere Vorgesetzten regelmäßig in väterlicher Fürsorglichkeit für uns auf den Dienstplan setzten, damit wir Grünschnäbel uns nicht langweilten. Entweder erreichten wir alle zusammen die von den militärischen Führungskräften geforderten Ziele, oder wir hatten allesamt die entsprechenden Restriktionen zu ertragen. Diese waren dann doch meist weniger witzig. Keiner verbrachte gerne seine eigentliche Freizeit mit dem zusätzlichen Reinigen von Scheißhäusern. War diese Tätigkeit einfach nur eklig, konnte ein aus erzieherischen Gründen verordneter Wochenenddienst auch an der Heimatfront durchaus fatale Folgen haben.
Wenn in dieser Zeit eine feste Freundin allein zuhause auf einen wartete, blieb sie im besten Fall einfach nur unbefriedigt. Wenn sie allerdings charakterlich nicht sonderlich gefestigt war, konnte es auch schon mal vorkommen, dass sie ersatzweise mit irgendeinem anderen Typen dafür sorgte, dass zumindest ihr Hormonhaushalt ausgeglichen blieb. Da ich damals am Wochenende in einer ostwestfälischen Kleinstadt bei meinen Eltern wohnte, und dort so ziemlich jeder jeden kannte, blieben solche Geschichten nicht lange unentdeckt.
Meine ehemaligen Schulfreunde wurden auf alle möglichen Bundeswehrstandorte verteilt. Am Wochenende haben wir uns jedoch meistens in unserer Heimatstadt wieder gesehen. Dann konnten wir beweisen, dass wir alle trotz der räumlichen Entfernung so ziemlich die gleichen Verhaltenmuster eingetrichtert bekommen hatten. Meinte eine unserer Freundinnen, sich eine sexuelle Abwechslung gönnen zu müssen, hatte der Typ, der unsere Abwesenheit schamlos ausgenutzt hatte, nicht viel zu lachen. Aufs Maul gab es eigentlich eher selten. Es war stattdessen die Regel, dass der Betreffende sich auf keiner Festivität in unserem Heimatort und dem weiteren Umfeld mehr sehen lassen konnte. Allein unsere massive Anwesenheit und die Androhung von körperlichen Folgen, wenn derjenige sich nicht unverzüglich entfernte, reichten aus, ihm den Spaß an dem weiteren Abend reichlich zu verderben. War er der irrigen Meinung, sich stattdessen auf einer anderen Veranstaltung in der näheren Umgebung vergnügen zu können, hatte er sich auch damit verrechnet. Aufgrund der relativen Übersichtlichkeit unseres Reviers waren wir meist genau informiert, wo und wann Wochenend-Events stattfanden. Also folgten wir demjenigen einfach, wenn er sich verzog, da wir uns selten darum kümmerten, ob wir irgendwo erwünscht, geschweige denn überhaupt eingeladen waren. Spätestens dann zog der Schmarotzer den endgültigen Rückzug weiterem Stress vor. Mit relativer Sicherheit brauchte derjenige aus unserer Mitte, der gehörnt worden war, in der Folgezeit die dumme Visage des Aasgeiers nirgendwo mehr zu ertragen.
Während der dienstfreien Zeit lernten wir jungen Kerle eine Reihe weiterer wichtiger Fähigkeiten, die uns auch im Leben nach dem Bund in der Welt der Erwachsenen enorm weiterbrachten. Es gelang mir nach einigen Wochen Übung ohne nennenswerte Probleme das Skatblatt in meiner Hand auch dann noch zu realisieren, wenn ich mehr als einen halben Kasten Bier verkonsumiert hatte. Der Obolus für die zum Kartenspiel obligatorische Flüssignahrung wurde durch den aufgrund unseres begrenzten Wehrsolds recht gemäßigten Spieleinsatz finanziert. Natürlich eskalierten diese die Kameradschaft fördernden Veranstaltungen bisweilen. Wenn es zu exzessivem Bierkonsum kam, was eher selten der Fall war, konnte es schon mal passieren, dass einer der Kameraden plötzlich am Spieltisch in den Schlaf der Gerechten verfiel. Diese Auszeit gönnten wir übrigen dem friedlich Schlummernden selbstredend von Herzen. Nicht selten fühlte sich dann aber ein anderer Kamerad dazu berufen, den Beweis für den durchaus verständlichen Schwächeanfall auf Polaroid zu bannen. Um den Anblick noch ein wenig abzurunden, konnte es auch vorkommen, dass auf dem Foto der Schwanz eines nicht minder alkoholisierten Kameraden zu sehen war. Der entblößte Nachweis draller Männlichkeit wurde dazu fotogen auf dem vorschriftsmäßig geschnittenen Haupthaar des selig Schlafenden postiert. An Phantasie hat es uns offensichtlich nie gemangelt, wobei man freilich über das Niveau solcher Einlagen geteilter Meinung sein kann. Nicht wenige Kameraden übten sich zwangsläufig in der hohen Kunst des Onanierens. Unter diesen Handwerkern gab es wiederum eine besonders schamlose Spezies. Ohne Hemmungen ließen diese Kameraden die übrigen Stubenkollegen an ihren fleischlichen Freuden teilhaben. Sie ließen sich auch nicht durch das dabei entstehende rhythmische Quietschen der metallenen Bettgestelle von ihrer Handarbeit abhalten. Zumindest fand das ganze Procedere normalerweise im Dunkeln nach dem Zapfenstreich statt, sodass uns anderen der Anblick der Sauerei erspart blieb, die ja zwangsläufig am Ende des Vorgangs folgen musste. Ich persönlich zog es vor meine diesbezüglichen Trainingseinheiten möglichst unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen.
Der Standort am Rande einer norddeutschen Großstadt war deswegen für uns von Vorteil, weil wir auch während dieser entbehrungsreichen Zeit nicht unbedingt auf die Freuden der zwischenmenschlichen Beziehungen zum schönen Geschlecht verzichten mussten. Mit der Straßenbahn konnten wir innerhalb kurzer Zeit in das Zentrum gelangen, wo es in den zahlreichen Kneipen und Discos reichlich spaltbares Material gab. Nicht alle meiner Schulfreunde hatten diesbezüglich so viel Glück wie ich. Diejenigen, die in eine Kaserne einberufen wurden, die irgendwo am Arsch der Welt lag, konnten entweder den Kontakt zwischen ihren Fingern und ihrem kleinen Freund intensiv pflegen oder gegen Bares in einem der meist in der Nähe vorhandenen einschlägigen Etablissements Druck ablassen. Die Aufnahme von Beziehungen zur weiblichen Landbevölkerung war für diese bedauernswerten Kameraden meist mangels Masse die goldene Ausnahme. Einmal im Jahr fand im Zentrum der Großstadt ein Schützenfest statt. Dabei handelt es sich noch heute um das größte Fest dieser Art in Deutschland. Ich kannte solche Veranstaltungen bereits aus meiner westfälischen Heimatstadt und den umliegenden Dörfern. Im Grunde wird dabei jedes Jahr ein neuer Depp gesucht, der so blöd ist, für alle anderen das Bier und den Schnaps zu bezahlen. Dazu wird üblicherweise auf dem Dorfplatz ein Holzvogel aufgestellt, auf den die meist schon reichlich angetrunkenen Schützenbrüder mit Luftgewehren ballern, bis das bedauernswerte Federvieh irgendwann vom Sockel fällt. Derjenige, der den letzten Schuss vor dem traurigen Ende des hölzernen Vogels abgegeben hat, ist der neue Schützenkönig. Dadurch wird er für ein Jahr zum Herrscher über eine Horde von übermäßig an Alkoholkonsum interessierten Vereinsmeiern, zumindest sah ich diese Typen so.
Es ist Usus, dass die Schützen-Heinis sich zu jeder offiziellen Veranstaltung mit einer besonders schicken Uniform ausstaffieren. Unter einem meist grünen Jackett, an dem bei ganz besonders verdienstvollen Kameraden reihenweise Orden angeheftet sind, wie bei einem russischen Brigadegeneral, tragen die Jungs weiße Hosen und weiße Hemden. Das ist deshalb besonders sinnvoll, weil die nach Tagen des mehr oder weniger unkontrollierten Alkoholkonsums unvermeidlichen Bier- und Schnapsflecken einen optimalen Kontrast zum Weiß der Einheitsbekleidung bilden. Die Grundausbildung bei der Bundeswehr ist in solchen Vereinen ausnahmsweise von Vorteil. Die Kameraden müssen sich nämlich zunächst unter dem Befehl ihrer Vorgesetzten in militärischer Ordnung in einem fröhlichen Zug durch die Gemeinde bewegen, bevor sie irgendwann den Schützenplatz erreichen. Bei diesen zunächst wohl organisierten Veranstaltungen wird nicht nur auf einen Vogel geschossen, sondern auch ordentlich gevögelt. Die dabei anwesende Damenwelt rekrutiert sich nicht selten aus den Exemplaren, die auf Männer in schicken Uniformen stehen. Offensichtlich wirkt diese Bekleidung auf sie nicht selten wie ein Aphrodisiakum.
Die paarungswillige Dame himmelt den auserwählten Uniformierten zu fortgeschrittener Stunde mit leicht glasigen Kuhaugen an. Dabei scheint für diese Spezies die körperliche Konstitution des einmal erwählten Partners keine entscheidende Rolle zu spielen. Der Alkoholpegel im Blut des männlichen Balzpartners gibt diesem wiederum die Möglichkeit, mit ausgefeilten rhetorischen Mitteln den Ort der geplanten Kopulation vorzuschlagen. Dafür kommen zum einen die Motorhauben der um den Schützenplatz geparkten Fahrzeuge in Frage. Es bieten sich aber auch die Deichseln der Bierwagen an, die im Hintergrund des regen Geschehens abgestellt sind, und in denen der Nachschub für die durstige Festgemeinde gekühlt wird.
Mit der Fortdauer der Veranstaltung gebärdet sich der eine oder andere Balzvogel wie die männlichen Vertreter der vorher zur Ermittlung des neuen Häuptlings abgeschossenen Tiergattung. Nicht selten bekommt man, wenn man sich als auswärtiger Gast auf fremden Schützenplätzen sehen lässt, von den Einheimischen Hähnen zu hören, dass man vor Ort immer noch seine Hühner selber tritt. Das passiert natürlich nur dann, wenn man unsportlich ist und die Tatsache schamlos ausnutzt, dass man im Gegensatz zu der organisierten Saufgemeinde selber noch nicht seit Tagen gelötet hat. Taktisch klug ist es deshalb natürlich auch, während des Aufenthaltes in fremden Festzelten den Alkoholkonsum möglichst in Grenzen zu halten. Alleine durch ein Gespräch mit einer der willigen Bräute kann man eine handfeste Reaktion eines alkoholisierten Uniformierten hervorrufen. Es kann daher nicht schaden, wenn noch einige verlässliche Kumpels anwesend sind, die mit überzeugenden Argumenten aller Art schnell wieder für Ruhe sorgen können.
In der niedersächsischen Großstadt, in der wir unseren Wehrdienst leisteten, lag die Sache insofern etwas anders, als es neben einer ähnlichen Narrenveranstaltung wie in meiner westfälischen Heimat, nur in wesentlich größeren Ausmaßen, auch ein riesiges Volksfest gab. Aufgrund unserer einschlägigen Erfahrungen beschlossen mein Stubenkamerad Bernd und ich uns an einem Samstag auf den Festplatz zu begeben, um unseren in der Woche angesammelten Samenüberschuss abzubauen.
Es gab eine Unmenge von Karussells, Losverkaufsständen und Schiessbuden, an denen wir zunächst unsere auf bei der Bundeswehr erworbenen Fertigkeiten mit wenig Erfolg testeten. Der Penner hinter der Theke hatte eindeutig Kimme und Korn manipuliert. Bis wir das endlich gerafft hatten, war der Betrüger um einige harte D-Mark reicher. Ein wenig frustriert brachen wir letztlich das Unternehmen ohne eine Siegestrophäe ab. Wir schütteten uns an der einen oder anderen Bierbude ein Gläschen in den Hals, um ein wenig in Stimmung zu kommen. Es gab hier und da einige durchaus vorzeigbare Mädels, aber irgendwie blieben unsere Versuche, mit ihnen ins Geschäft zu kommen, zunächst erfolglos. Neben den verschiedenen Buden gab es auch eine ganze Reihe von größeren Festzelten, ähnlich wie beim Münchener Oktoberfest. Wir waren uns relativ sicher, dass es dort ausreichend paarungswillige Partnerinnen gab. Solche Orte zogen erfahrungsgemäß die Hühner reihenweise an, da es neben den üblichen Saufgelegenheiten auch Kapellen gab, die zum Tanz aufspielten. Die Hütte, die wir uns aussuchten, war gut gefüllt mit schunkelnden und saufenden Zeitgenossen. Lange Reihen von Biertischen führten zu einer Bühne, auf der ein paar Schwuchteln mit ihren Blasinstrumenten die unvermeidlichen Stimmungslieder spielten.
Grundsätzlich waren Bernd und ich nicht gerade Freunde blecherner Blasmusik. In diesem Fall sollte uns das nervende Gedudel aber durchaus recht sein, wenn es nur die Stimmung der anwesenden Damen in die von uns gewünschte Richtung lenkte. Am rechten und linken Rand des Zeltes gab es Biertheken im Übermaß. Wir steuerten gleich auf eine zu, um die bereits draußen begonnene Lötung fortzusetzen. Zufällig standen vor der Theke drei durchaus akzeptable Modelle. Sie hatten auch schon ordentlich getankt und schauten uns entsprechend ihrem geistigen Zustand herausfordernd an. Das für Kopulationsinteressierte charakteristische Verhalten setzte auf beiden Seiten der Geschlechterfront auch gleich ein.
Wir bestellten für die drei und uns eine Runde Bier und tauschten erst einmal unsere Namen aus. Beruf und Familienstand interessierten uns dabei wenig. Das sollte sich in diesem Fall aber noch als grober Fehler herausstellen. Biggi war blond, hatte ordentlich Holz vor der Hütte und war von Anfang an die zutraulichste der Truppe. Susanne hatte ein ziemlich dürres Gestell, dunkle Haare und war überhaupt nicht mein Typ, dafür fuhr Bernd gleich auf sie ab und sie auch auf ihn. Die dritte im Bunde war Heike. Sie war wie Biggi blond, hatte eine Büffelhüfte und war alkoholisch schon ziemlich überversorgt. Sie laberte, während wir ihren Freundinnen langsam näher kamen, einen Haufen besoffenen Scheiß. Mit jedem weiteren Bier verlor sie zunehmend die Kontrolle über ihre Sprechinstrumente. Das interessierte aber Bernd und mich nur am Rande, da wir bei den beiden anderen Torten zügig vorankamen. Wir setzten uns an einen der Biertische und ließen unseren Charme oder das, was wir in unserem Zustand dafür hielten, mit einigem Erfolg spielen. Zu dem in solchen Saufanstalten üblichen Geschunkel zu dem Gedudel der Blaskapelle ging auch bald das vorbereitende Gefummel los.
Ich knutschte ein bisschen mit Biggi und testete auch schon mal ihre Möpse unter ihrem Pullover an. Die Tatsache, dass sich mein kleiner Freund ab und zu in der Hose meldete, zeigte mir, dass ich durchaus auf dem richtigen Weg und auch noch anatomisch in der Lage war, die Freuden des Beischlafs ausgiebig genießen zu können. Ich beschloss daher, den bisher exzessiv praktizierten Alkoholgenuss in meinem und natürlich auch Biggis Interesse ein wenig einzuschränken. Es wäre ja zu schade gewesen, wenn später anstelle des von mir schon in stiller Vorfreude erwarteten Flüssigkeitsaustausches nur noch heiße Luft gekommen wäre. Bernd war ebenfalls auf einem Erfolg versprechenden Weg. Er tat es mir in der Bearbeitung von Susannes allerdings nur spärlich vorhandenen Brüsten gleich. Sie überprüfte auch schon mal seine Standfestigkeit zwischen den Beinen. Ich freute mich für meinen Kumpel und amüsierte mich prächtig dabei. Nur die mittlerweile mächtig lallende Heike ging mir langsam mittelschwer auf die Nerven. Sie schien mit fortschreitender Dauer der Festivität immer zügiger nicht nur ihre rhetorischen Fähigkeiten ein zu büßen, sondern auch die Kontrolle über ihre Nackenstützmuskulatur. Das hatte zum einen ein immer hektischeres Vor- und Zurückwippen ihres Kopfes zur Folge, zum anderen aber auch eine ausgesprochene Verfeinerung ihres Vokabulars. Kurz bevor wir aufbrachen, um endlich zur Tat zu schreiten, brüllte sie zum Entsetzen unserer Tischnachbarn, die sich schon in fortgeschrittenem Alter befanden, dass sie den da nachher auch noch ficken würde.
Sie deutete in einem Augenblick, in dem sie die Kontrolle über ihren Bewegungsapparat für kurze Zeit wiedererlangt hatte, mit ihrem Kopf auf mich. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Ich hatte ja grundsätzlich nichts gegen einen gepflegten Dreier, aber doch nicht mit einer Schwester, die sowieso nichts mehr merkt. Ein Leichenschänder war ich ja nun bei aller Begeisterung für die fleischlichen Freuden beileibe nicht. Das Problem löste sich dann doch zur Zufriedenheit aller Anwesenden von allein, als Heike wieder einmal zur Theke torkelte. Die mittlerweile in ihrer überwiegenden Mehrheit sich in glücklicher Bierseligkeit befindende Corona verursachte einen Höllenlärm. Deshalb konnten wir auch nicht eindeutig verstehen, was sie uns vor ihrem Abgang zugebrüllt hatte. Ich meinte aus ihrem Gebrabbel herausgehört zu haben, dass sie die Absicht hatte, gegen alle Regeln der Vernunft noch eine Runde Bier zu holen. Dazu kam es jedoch nicht mehr. Einer der besoffenen Volltrottel in grün-weißer Uniform quatschte sie an, als sie erstaunlicherweise unfallfrei an der Theke angekommen war. Wahrscheinlich geschah das auf dem gleichen sprachlichen Niveau, auf dem sich Heike zu dem Zeitpunkt befand. Offensichtlich störte es sie dabei auch nicht, dass der mächtig angeschlagene Kerl ziemlich unkontrolliert mit dem Oberkörper schaukelte, während er mit seinem Mund die Nähe ihres linken Ohres suchte. Vermutlich sabbelte er mit seiner feuchten Aussprache irgendeine Anzüglichkeit in dasselbe.
Gleichzeitig tropfte als Folge seiner mangelnden Standfestigkeit ständig das kostbare Nass aus seinem vollen Bierglas auf seine schicke weiße Hose.
Heike schien sich köstlich über seine zweifellos völlig hohlen Sprüche zu amüsieren, denn sie lachte darüber laut und ordinär. Das animierte wiederum den Kollegen von der Zunft, die harmlose Holzvögel zu erschießen pflegt, dazu mutig eine seiner schmierigen Hände um Heikes umfangreiche Hüften zu legen. Sie schlang daraufhin einen Arm um seinen Hals, nicht zuletzt auch deshalb, um nicht endgültig umzukippen. Offensichtlich wollte sie ihm aber auch ihre Kopulationsbereitschaft signalisieren. Nach einigen weiteren Minuten des gepflegten Geistesaustausches war man sich wohl handelseinig. Die beiden torkelnden Turteltauben verschwanden in der lauen Sommernacht. Bei der Nummer wäre ich am liebsten dabei gewesen. Ich hätte zu gerne gesehen, wann der Typ erkannt hat, dass bei ihm sowieso nur noch heiße Luft kommt. Ich frage mich noch heute, ob das wohl passierte, bevor oder nachdem Heike eingeschlafen ist. Wie dem auch immer war, unser Bier haben wir von ihr jedenfalls nicht mehr bekommen.
Nach Heikes amüsantem Abgang war es endlich an der Zeit selbst zur Tat zu schreiten. Unsere Favoritinnen waren wie wir längst in bester Laune, und sie hatten uns mit ihren Handgreiflichkeiten im Genitalbereich wissen lassen, dass sie genauso willig waren wie wir. Nun blieb nur noch die Frage offen, wo wir uns zur Paarung niederlassen sollten. In die Kaserne konnten wir schließlich wohl kaum. Sicher hätte der UvD vollstes Verständnis für unser Begehren gehabt. Vögeln in der Stube war allerdings strengstens verboten, zumal wir für die Süßen wohl kaum mitten in der Nacht einen Besucherschein bekommen hätten. Das Problem wurde jedoch schnell geklärt. Biggi schlug vor, in ihre Wohnung zu fahren, die etwas außerhalb des Zentrums lag. Sie bestand darauf, dass Bernd und Susanne, die in unmittelbarer Nachbarschaft von Biggi wohnte, mitkommen sollten. Dass Frauen grundsätzlich zu zweit aufs Klo gehen, ist ja allgemein bekannt. Mir hat auch noch keine anvertraut, warum das so ist. Dass aber auch noch zu zweit zum Vögeln gegangen wird, war eine für mich zu dem damaligen Zeitpunkt neue Erfahrung. In der Straßenbahn zischten wir noch eine Hülse Bier und beschäftigten uns schon mal mit dem Vorspiel.
Dabei schien nicht nur meinem Kumpel und mir die Tatsache besondere Freude zu bereiten, dass sich ein paar alte Schachteln, die uns unmittelbar gegenüber saßen, über unser Gefummel erheblich echauffierten. Die Hitze in Biggis Schritt entwickelte sich keineswegs umgekehrt proportional zu der Härte meines guten Freundes zwischen den Beinen. Susanne leitete ebenfalls die sexuelle Aufwärmphase ein, indem sie ihren geilen Hintern zur Übung schon mal an Bernds zweifellos nicht minder hartem Lümmel rieb. Als wir in Biggis Bude ankamen hatten sich unsere Partnerinnen als Folge der Fummelei in der Straßenbahn genauso wenig unter Kontrolle wie wir. Wir ließen uns jeweils paarweise auf den im Rechteck um einen flachen Glastisch angeordneten Sofas nieder.
Die Wohnung hatte ich mir beim Betreten gar nicht genauer angeschaut, weil Biggi schon nach dem Schließen der Eingangstür am Reisverschluss meiner Jeans nestelte. Während ihrer Handgreiflichkeiten an meiner Hose und dem was darin war, verlor ich ebenfalls keine weitere Zeit und streifte ihr den lästigen Pullover über ihren blonden Schopf. Ohne diese die Schwellkörpertätigkeit anregende Ablenkung wären mir sicher als altem Landser die verschiedenen Gruppenfotos mit britischen Soldaten aufgefallen, die an der Wand im Flur angebracht waren. Im Wohnzimmer hing über dem Sofa, auf dem ich mich gerade mit meiner Zunge um Biggis Muschi kümmerte, unter anderem ein Schal und ein Mannschaftsfoto von Manchester United. Auch Bernd ließ sich in seiner Konzentration auf Susanne von solchen Nebensächlichkeiten nicht mehr ablenken. Er lag auf dem anderen Sofa auf dem Rücken. Susanne saß halb auf ihm und rieb sein Ding steif, während er ihre Pobacken massierte. Deshalb konnte er auch nicht das Porträtfoto des freundlich grinsenden, gut gebauten jungen Mannes an der Wand über ihm sehen. Der Teil des Oberkörpers, der auf dem Bild zu erkennen war, ließ erahnen, dass der Mann einen Tarnanzug trug. Das Barett auf seinem an den Seiten kahl rasierten Schädel war jedoch unübersehbar. All diese Details entgingen gänzlich unserer Aufmerksamkeit, weil wir eben unsere Verantwortung für die sexuelle Befriedigung unserer Bräute von Anfang an sehr ernst nahmen, was ja auch grundsätzlich lobenswert ist. Es wurde uns erst schlagartig bewusst, wo wir eigentlich waren, als es etwas später heftig an der Tür klingelte und wir eine aufgeregte Frauenstimme von draußen Biggis Namen rufen hörten. Wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören, heißt es im Volksmund. Welcher ahnungslose Spießer dieses Sprichwort wohl erfunden hat?
Auf jeden Fall hat er sich nie mit einem guten Kumpel nach einer ordentlichen Dröhnung von zwei mehr als willigen Schönheiten einen blasen lassen, sonst hätte er niemals so einen Schwachsinn von sich gegeben. Oder wäre er in einem solchen Augenblick des höchsten Glücks freiwillig aufgestanden, hätte sein erregiertes Ding unter Schmerzen wieder in die Hose verpackt und die beiden Ladys mit seinem selbst erfundenen Spruch auf den Lippen unbefriedigt zurückgelassen? In dieser Situation lag der Fall jedoch etwas anders. Wir machten diesem Sprichwort alle Ehre, aber doch eher unfreiwillig. Als draußen die Tussi rumbrüllte und wie wild klingelte, stellten unsere Partnerinnen unisono sofort das herrliche Blaskonzert ein. Bernd und ich schauten fragend auf unsere plötzlich so allein gelassenen Geschlechtsorgane, die noch ein paar Momente weiter verzweifelt in die Höhe ragten. Spätestens als die Bläserinnen panisch zur Tür rannten, fielen unsere beiden Jungs voller Enttäuschung wie Kartenhäuser in sich zusammen. Die Erkenntnis kam uns praktisch gleichzeitig. Wir schnappten einzelne Gesprächsfetzen von der Eingangstür her auf. Es ging um von einer Truppenübung vorzeitig zurückkehrende Ehemänner. Gleichzeitig fielen unsere Blicke auf die Utensilien und Fotos auf den Wänden um uns herum. Wir hatten die Sachlage schon vollständig erfasst, ehe unsere Schätzchen völlig aufgelöst zu uns zurückkehrten. Das zügige Ankleiden hatten wir ja ausgiebig während unserer Grundausbildung trainiert. Neue Rekorde stellt man aber nur dann auf, wenn eine ausreichende Motivation vorhanden ist. Wir hielten die Tatsache, dass wir soeben im Begriff gewesen waren, die Ehefrauen von zwei britischen Elitesoldaten flachzulegen, die auch noch jeden Augenblick in der Tür stehen konnten, für völlig ausreichend.
Die hysterische Nachbarin, die ihre Freundinnen warnen wollte, hatte zufällig erfahren, dass ihre Ehemänner im Anmarsch waren. Ihren eigenen Bettgenossen hatte sie schon vorher rechtzeitig aus der Bude gejagt.
Es war ein Kamerad aus einer anderen Einheit in unserer Kaserne, den wir nach unserer erfolgreichen Flucht an der Straßenbahnhaltestelle trafen. Er hatte nur das Glück gehabt, schon einige Zeit eher mit der Schnalle zum gemütlichen Teil des Abends übergegangen zu sein. Wir hätten halt ein paar Bier weniger trinken oder uns nicht so lange mit dem Vorspiel aufhalten sollen. Das hatte man nun davon, wenn man sich in der Kiste zu sehr um die Interessen des weiblichen Geschlechts kümmert. Auch kann ich nur empfehlen, sich vor einer spontanen Vögelei vorher über die familiären Verhältnisse der Auserwählten ausgiebig zu informieren.
Student sein
Es war zwei Jahre vor der Maueröffnung, als ich im „Bundesdorf“ mein Studium aufnahm.
Das Leben war einfach herrlich unbeschwert. Eigentlich musste ich mir über nichts wirklich ernsthafte Gedanken machen.
Die monatliche Überweisung von Mama und Papa kam immer pünktlich. Die angewiesene Summe reichte für den täglichen Bedarf völlig aus. Die Bude in dem Studentenheim in Poppelsdorf kostete schlappe 150 D-Mark. Ich hatte dazu noch rund 650 Mäuse zum Leben. Als katholisch erzogener Musterknabe versuchte ich mich über ein Semester in solch ausgefallenen Fächern wie Theologie und Latein. Es war ja nicht gerade so, dass ich mich schon als Priester sah. Ich hatte längst die Vorzüge des weiblichen Körpers zu schätzen gelernt. Deshalb wollte ich auf keinen Fall meine zukünftigen sexuellen Erfahrungen allein auf die Perfektionierung meiner Hobel-Technik beschränken. Vielmehr sah ich mich schon vor einer Horde frecher Blagen stehen, um ihnen als cooler Pauker die Freuden der lateinischen Grammatik oder das richtige Verständnis vom lieben Gott näher zu bringen. Dabei stellte ich mir allerdings nicht vor, den lieben Kleinen ein verbiestertes und spießiges Weltbild zu vermitteln. Immerhin wuchs ich in einem kleinbürgerlichen Umfeld auf, in dem mir die Sicht der Dinge auf diese Weise von vielen Erwachsenen täglich vorgelebt wurde.
Das katholische Volk stand in meiner Jugend, die ich in den Siebzigern und frühen Achtzigern in Ostwestfalen verbrachte, unter dem streng konservativen Regiment des Erzbistums Paderborn. Nicht nur meine Erziehung wurde in erheblichem Masse von den Regeln der heiligen Mutter Kirche mitbestimmt. Meine Eltern versuchten, sich mit den Jahren eine etwas liberalere Grundeinstellung zuzulegen. Den durchaus restriktiven Vorstellungen der Kirche von Moral und Erziehung, von denen sie in erheblichem Masse selbst geprägt waren, konnten sie sich aber zumindest nach außen nie wirklich entziehen. So gab es zuhause zunehmend Konfliktstoff, wenn meine beiden Brüder und ich mit zunehmendem Alter Verhaltensweisen entwickelten, die nicht immer konform mit der kirchlichen Doktrin gingen.
Der sonntägliche Kirchgang war einfach ein Pflichtprogramm, dem ich in meiner Jugend nicht entkommen konnte. Mein Vater hatte irgendwann für uns beschlossen, dass wir grundsätzlich die letzte Messe des Wochenendes besuchten. Sie fand sonntags abends um 19 Uhr statt. Das hatte die frustrierende Folge, dass wir fast immer die letzten fünf Minuten unserer Lieblingsserie verpassten. Bonanza oder Raumschiff Enterprise liefen in der Stunde zwischen 18 und 19 Uhr. Manchmal waren zu unserem Glück die Folgen so spannend, dass auch unser Vater das Finale nicht verpassen wollte. Dann betraten wir die Kirche erst mit einigen Minuten Verspätung.
Die Nachbarn aus unserer Strasse waren natürlich schon alle anwesend und musterten uns mit vorwurfsvollen Blicken, wenn sie sich noch einmal von ihren Bänken erheben mussten, um uns zu freien Plätzen durchzulassen. Überhaupt hatte ich nicht selten den Eindruck, dass viele der katholischen Kirchgänger nicht zuletzt auch deshalb da waren, um zu kontrollieren, ob ihre Bekannten ebenfalls brav ihrer sonntäglichen Pflicht nachkamen. Der wöchentliche Kirchenbesuch diente nach meiner Einschätzung den Damen der Kleinstadt-Gesellschaft auch dazu, die eigene Garderobe mit den über die Woche neu angeschafften Kleidungsstücken der anwesenden weiblichen Konkurrenz vergleichen zu können. Man beschäftigte sich daher nicht immer mit der nötigen inneren Einkehr, zu der man eigentlich an diesem heiligen Ort zusammengekommen war. In meiner katholischen Erziehung wurde viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt. Den Sinn bestimmter Verhaltensweisen, die von mir und meinen Brüdern verlangt wurden, konnte ich trotz der intensiven Erklärungsversuche meiner Eltern nie ganz einsehen.
Am Karfreitag gab es nur einmal etwas zu essen, den restlichen Tag mussten wir dann mit knurrendem Magen verbringen. Diese Kasteiung wurde uns befohlen, wir führten sie nicht aus eigenem Antrieb durch. Deshalb verfehlte sie wahrscheinlich letztlich auch ihre Wirkung.
Am Osterwochenende rannten wir gleich dreimal in die Kirche. Beim dritten Mal wusste ich schon gar nicht mehr, was ich dem lieben Gott noch erzählen sollte. Ich war ja erst gestern und vorgestern da gewesen. Am Heiligabend wurde auf Instrumenten, deren Beherrschung meine Brüder und ich über Jahre mühsam erlernen mussten, Hausmusik aufgeführt. Die Proben am Nachmittag des lang herbeigesehnten Tages endeten oft in einem Fiasko, da wir Kinder mehr an die Geschenke dachten, die unter dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum auf uns warteten, als uns auf die Noten zu konzentrieren.
Einer von uns verspielte sich immer, sodass sich die Probe unter dem Gebrüll unseres Vaters über Stunden hinziehen konnte, bis er letztendlich einigermaßen zufrieden war. Das Bewusstsein, dass die Aufführung des familiären Streich-Quartetts eigentlich zur Ehre Gottes gereichen sollte, war uns Kindern irgendwann während des nachmittäglichen Probenstresses abhanden gekommen. Das obligatorische Absingen des einen oder anderen Weihnachtsliedes ließen wir schließlich auch noch über uns ergehen. Der Augenblick der lang ersehnten Bescherung war ja dann nicht mehr weit.
Die Freuden der katholischen Erziehung, die wir genießen durften, erstreckten sich aber nicht nur auf den Bereich der regelmäßigen Kirchgänge, Fasten und Kirchenmusik. Es wurde auch in unserer sexuellen Entwicklung penibel darauf geachtet, dass wir Jungs nicht allzu früh den Kontakt zum schönen Geschlecht über das platonische Maß hinaus intensivierten.
Schon das Onanieren war eine Handlung, die wir im Beichtstuhl als Sünde gegenüber dem verständnisvollen Priester deklarieren sollten. Irgendwann beschloss ich aber für mich, dass das ein wenig zu weit ging. Was ging es den Kerl hinter dem Holzgitter an, ob und wann und wie oft ich mir einen runterholte? Sex war etwas, das nach dem Wunsch unserer Eltern erst nach der Eheschließung stattzufinden hatte. Es wurde uns eingetrichtert, dass der Beischlaf so etwas Besonderes sei, dass wir uns dieses Erlebnis für die Frau unseres Lebens aufsparen sollten. Die Folge dieses Aspektes unserer Erziehung war, dass auch die meisten meiner Kumpels, die natürlich ähnliche Direktiven von ihren Eltern erhielten wie ich, in ihrer überwiegenden Mehrheit mit der pubertären Fummelei erst relativ spät begannen. Das lag natürlich auch daran, dass die Mädchen in unserem Alter von ihren Eltern die gleichen Verhaltensmuster beigebracht bekamen. Deshalb war in unserem Umfeld das Angebot an Girls, die bereit waren, über schüchternes Geknutsche hinauszugehen, anfänglich relativ begrenzt.
Bei den ersten Versuchen, einem Mädel an die Möpse zu fassen, hatte man noch regelrecht ein schlechtes Gewissen, weil man meinte, dass das dem lieben Gott gar nicht gefallen würde. Mit fortschreitendem Alter siegte dann aber doch die Geilheit über die Vernunft. Das ging übrigens den Hühnern genauso, sodass sich das Angebot an paarungswilligen Partnerinnen mit der Zeit immer mehr vergrößerte. Wie ich später feststellen durfte, lag die Sache in der Zone etwas anders. Dort war die Erziehung in der Regel alles andere als kirchlich geprägt. Die Tatsache, dass unsere Altersgenossen auf der anderen Seite der Mauer eingesperrt waren, wurde zumindest etwas dadurch kompensiert, dass die Jugend dort mit reinem Gewissen schon ziemlich früh vögelte, was das Zeug hielt. Während wir nach dem Willen unserer Eltern mit dem Sex möglichst noch bis zur Eheschließung warten sollten, verfuhr man drüben doch eher nach dem Motto: Drum prüfe wer sich ewig bindet, ob er nicht noch was Besseres findet. Ein Motto, das eher meiner Lebensphilosophie entsprach. Als ich das erst einmal erkannt hatte, kam ich ihm auch ausgiebig nach.
Nach einem Semester wechselte ich die Studienfächer. Ich bekam die griechischen Vokabeln einfach nicht in die Birne. Da Griechisch aber nun mal eine Voraussetzung für das Theologie-Studium war, musste ich das ganze Fach drangeben. Auch mein Lateinstudium scheiterte, weil wir unseren Caesar plötzlich vom Deutschen ins Lateinische übersetzen sollten, was wir in der Schule nie gelernt hatten. Deutsch und Geschichte waren die Alternativen für mich. Die beiden Fächer lagen mir nicht nur inhaltlich. Die Organisation des Studiums, oder das, was man in den ersten Semestern dafür hielt, ließ mir und meinen Kommilitonen genügend zeitlichen Spielraum für die Freuden des Lebens. Wir hatten schnell raus, dass viele der Geschichtsprofessoren in ihren Vorlesungen am liebsten aus den von ihnen selbst verfassten Büchern wörtlich ablasen. So konnten wir uns die Zeit im Hörsaal getrost sparen. Es wurde zwar bei jeder Vorlesung eine Anwesenheitsliste herumgereicht, in die man sich eintragen musste. Es fand sich aber auch immer ein Streber, der meinte, bei jeder dieser Lesestunden anwesend sein zu müssen. Gegen das ein oder andere Bier abends in einer der zahlreichen Kneipen der Bonner Studentenviertel war der strebsame Studienkollege aber gern dazu bereit, neben dem eigenen Namen auch den eines abwesenden Kommilitonen in die Liste einzutragen.
Zur Erlangung des Scheines am Ende des Semesters mussten wir beim Professor eine mündliche Prüfung über den Inhalt der Vorlesung ablegen. Wir kauften uns das entsprechende Buch, womit wir sicher für ein nicht unerhebliches Zusatzeinkommen des Professors sorgten, und hämmerten uns das ausgewählte Prüfungsthema in ein oder zwei Nachtsitzungen ins Kurzzeitgedächtnis. Eine Note gab es für diese Prüfungen nicht, sodass wir einfach nur bestehen mussten, was letztlich wirklich kein Problem darstellte. Das Deutsch-Studium war auch nicht mit viel mehr Aufwand verbunden.
Nachdem also der unwichtige Teil des Studentenlebens auf diese Weise nach dem Minimal-Prinzip geregelt war, konnte ich mich in der im Überfluss vorhandenen Freizeit den wirklich wichtigen Dingen des Lebens widmen. Ich fand in Bonn sehr schnell Anschluss durch den Eintritt in eine der Studentenverbindungen, die überall auf dem Campus um neue Mitglieder warben. Es gab zum einen katholische Studentenvereine. Mein Vater hätte gerne gesehen, wenn ich einem solchen beigetreten wäre, da er selber darin in seiner Studienzeit in Heidelberg sehr aktiv gewesen war. Er hatte mir immer wieder von dieser Zeit vorgeschwärmt, sodass ich mich gleich nach einer passenden Verbindung umschaute.
Darüber hinaus gab es auch die Jungs, die sich für die Härtesten hielten und sich in so genannten Corps zusammenschlossen. Sie lebten immer noch so, wie es nach meiner Vorstellung zu Kaisers Zeiten abgelaufen sein muss. Der stramme Komment in diesen Vereinen verlangte eine Reihe von Pflichtmensuren. Bei der ersten ging es meist noch recht unblutig zu. Mit jeder weiteren Mensur stieg jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer oder sogar beide der Kontrahenten recht ansehnliche Schmisse im Gesicht einhandelten. Diese wurden dann wie Trophäen stolz zur Schau getragen. Wenn man als Korporierter den Jungs in der Stadt über den Weg lief oder sie auf einem anderen Verbindungshaus traf, musste man aufpassen, sie nicht falsch anzuschauen, sonst sah man sich schneller auf einem Paukboden wieder, als einem lieb war. Viele der Kerle fanden nicht selten unschwer einen Grund Satisfaktion zu verlangen. Auch im Saufen machte denen niemand was vor. Ich war zwar bald auch recht gut im Training, aber die Jungs kannten nur volle oder leere Gläser. Wenn Vertreter dieser Zunft zum Couleurbesuch auf unser Verbindungshaus kamen, war die höchste Alarmstufe angesagt. Nur mit vereinten Kräften konnten meine Bundesbrüder und ich die Kerle wieder vom Haus saufen. Zum Glück waren diese Besuche aber nicht die Regel, da die Corpsbrüder sich nach meiner Erfahrung grundsätzlich für die Elite der Verbindungen hielten. Mit dem niederen Burschenvolk, das wir in ihren Augen darstellten, wollten sie eigentlich sowieso nichts zu tun haben.
Der Zufall wollte es schließlich, dass ich zu einer Semesterantrittskneipe in einem Verbindungshaus landete. Es war eine Burschenschaft, in der zwar auch Partien gefochten wurden. Die Austragung war aber für die Bundesbrüder fakultativ. Das kam mir durchaus entgegen, da ich zu den Mensuren meine eigene Meinung hatte. Außerdem wollte ich auf keinen Fall für den Rest meines Lebens mit einem Schmiss in der Fresse rumlaufen. Die Jungs machten von Anfang an einen sympathischen Eindruck auf mich. Ich fühlte mich in der geselligen Runde absolut wohl. Noch am gleichen Abend wurde ich in den Bund aufgenommen und bekam das Fuxenband umgehängt. Das Leben in der Verbindung hatte zwei Seiten. Ich lernte einen Lebensbund kennen, der seit über hundertzwanzig Jahren bestand. Das wäre sicher nicht möglich gewesen, wenn sich hier ein paar Jungs lediglich zum Saufen und Singen getroffen hätten. Dieses allgemeine Bild von Studentenverbindungen herrschte ja nun mal in der deutschen Öffentlichkeit vor. Das politische Ziel der Deutschen Burschenschaft war seit ihrem Entstehen zur Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon ein einiges deutsches Vaterland. Daran war und ist nichts Radikales, was die Vertreter beiderlei Geschlechts vom linken Asta bis heute nicht verstanden haben. Sie machen immer noch Stimmung gegen die Studentenverbindungen, aber das ist letztlich deren Problem.
Damals war noch nicht im Traum an den Fall der Mauer zu denken, trotzdem standen wir zu dieser Vorstellung. Selbst die kühnsten Optimisten unter uns hatten keine rechte Ahnung, wie eine Wiedervereinigung in absehbarer Zeit Realität werden sollte. Noch viel weniger konnte irgendjemand ahnen, dass es in weniger als zwei Jahren schon so weit sein würde.
Wir luden auf unser Haus Größen aus Politik und Wirtschaft zu Vortragsabenden ein, die ja praktisch direkt vor unserer Tür saßen. Mit Hilfe der teilweise großen Namen, für die wir vorher mit Plakaten warben, erhöhten wir unseren Bekanntheitsgrad, warben neue Mitglieder und interessierten auch Mädels für uns. Die konnten zwar unserer Verbindung nicht beitreten, kamen aber gerne immer wieder zu geselligen Veranstaltungen auf unser Haus. Alle zwei Wochen fanden Konvente statt, in denen alle Angelegenheiten des Bundes debattiert wurden. Wir lernten Kompromisse zu schließen, uns an bestimmte Verfahrensregeln zu halten und vor allem die freie Rede. Für die Jungs aus dem Vorstand, der in jedem Semester neu gewählt wurde, kam die gesamte Organisation des Semesterprogramms hinzu. Sie hatten den ganzen Laden zu leiten, zu organisieren und die Bundesbrüder auch bei Streitigkeiten bei der Fahne zu halten. Das war zwar nicht immer einfach, dafür prägten diese Erfahrungen für das spätere Leben und halfen uns langsam erwachsen zu werden. Da die meisten von uns zum ersten mal weit weg von Mamas Rockzipfel waren, wenn man die Bundeswehrzeit außer Acht lässt, in der man ja nun alles andere als frei war, ließen wir so richtig die Sau raus.
Wenn wir nicht in der Uni waren, hielten wir uns tagsüber im Verbindungshaus auf. Wir spielten stundenlang Doppelkopf oder Billard. Einer der alten Herren hatte einen großen Spieltisch gespendet. Spätestens am Nachmittag stiegen wir von alkoholfreien Getränken auf Bier um. Ich war solo, aber einige Bundesbrüder hatten Freundinnen, die Gefallen am Bundesleben fanden und sich fast täglich dazugesellten. Das Flachlegen dieser Damen, die in festen Händen waren, war im äußersten Maße unerwünscht. Das sah nicht nur der unmittelbar Betroffene so, sondern es war auch eine der Grundregeln des Bundeslebens, die ich gleich am Anfang beigebracht bekam. Ließ man sich bei einer solchen nicht kommentgemäßen Koitus erwischen, konnte das den Ausschluss aus dem Bund zur Folge haben. Ich hielt mich bis auf eine Ausnahme daran. Die Doppelkopfrunden konnten sich bis in die frühen Morgenstunden erstrecken, wenn nicht gerade irgendwelche offiziellen Veranstaltungen auf dem Programm standen. Das ständige Training im Bierkonsum ermöglichte es uns, auch nach einer durchzechten Nacht, körperlich in der Lage zu sein, am nächsten Morgen die Uni aufsuchen zu können, wenn es unbedingt nötig war. Wurde es uns auf dem Haus zu langweilig, machten wir Couleurbummel durch die Kneipenlandschaft der Bonner Süd-Stadt. Dabei war es dann gar nicht schwer, eine interessierte Torte kennen zu lernen. Zwar gab es die linken Tussis, die uns Verbindungsstudenten für rechtsradikale Arschlöcher hielten. An denen hatten wir aber sowieso wenig Interesse, weil sie nach unserem Geschmack meist potthässlich waren in ihren selbst gestrickten Öko-Outfits. Die Hälfte von denen waren außerdem Lesben, zumindest sahen wir das damals so. Dann gab es aber auch durchaus annehmbare Exemplare, die uns gerade wegen unserer Bänder interessant fanden. Mit solchen Zeitgenossinnen kam man recht einfach ins Gespräch. Konnte man sie nicht gleich abschleppen, gab es dafür immer wieder Partys auf unserem Haus, zu denen wir sie einladen konnten, um einen zweiten Versuch zu starten. Bei einem Sit-in in der Wohnung eines Bundesbruders traf ich Karla. Sie fiel mir gar nicht besonders auf, da sie vom Aussehen her nicht gerade der Reißer war. Ich lötete mir mit meinen Kumpels den gesamten Sonntagnachmittag ausgiebig einen und hatte gar keine rechte Lust, mich um die anwesende Damenwelt zu kümmern.
Irgendwann kam Karla zu mir rüber, als ich mir in einem Nebenraum Nachschub aus dem Bowletopf holen wollte. Sie verwickelte mich in ein Gespräch über irgendein belangloses Thema und rückte mir dabei schon ziemlich angriffslustig auf die Pelle. Ich merkte sehr bald, was sie wollte und war letztlich dann doch interessiert, zumal sie mir bei näherem Hingucken flachlegenswerter erschien als am Anfang der Party, als ich noch nüchtern war. Wahrscheinlich begünstigte wieder einmal der Suff meine Einschätzung ihrer körperlichen Vorzüge, was mir aber letztlich egal war.
Wir knutschten ein wenig rum, wobei sie es aber nicht belassen wollte. Mit einem zielsicheren Griff zwischen meine Beine überzeugte sie sich davon, dass ich ihr noch geben konnte, wonach ihr eindeutig der Sinn stand. Wir gingen in ihre Wohnung, die nur ein paar Blocks weiter lag und gaben in ihrem Bett standesgemäß Gas. Die Sache war technisch gar nicht so einfach, da sie einen Verband um die Schulter trug. Sie hatte sich bei einem Fahrradunfall eine Rippe gebrochen und konnte nur unter Schmerzen atmen. An einem der nächsten Tage traf ich sie in der Uni wieder. Ich nahm sie aufgrund meines völlig nüchternen Zustandes so wahr, wie sie nun einmal wirklich aussah, nämlich ziemlich unscheinbar. Ich verlor das Interesse und wir wiederholten unser Erlebnis nicht mehr.
Den Vogel schoss Beate ab.
Wir waren kurz vor Weihnachten mit einigen Bundesbrüdern auf dem Haus einer befreundeten Verbindung am Rheinufer zu einer Feuerzangenbowle eingeladen. Wir saßen an langen Tischen und schütteten das Teufelszeug in uns rein. Nicht nur ich war relativ schnell voll. Es waren auch einige Modelle anwesend. Sie nahmen wenig Rücksicht auf die Tatsache, dass sie am nächsten Morgen einen fürchterlichen Brummschädel haben würden. Die trinkfesten Torten dachten gar nicht daran, die Anzahl der verkonsumierten Bowlebecher in Grenzen zu halten. Beate saß zufällig neben mir. Sie sah einfach fantastisch aus. Sie hatte halblange blonde Locken, blaue Augen und eine äußerst frauliche Figur. Lieber etwas mehr als zu wenig, dachte ich und war gleich ganz geil auf sie, was sie aber zunächst ignorierte. Sie unterhielt den ganzen Tisch mit saftigen Zoten und kümmerte sich eigentlich nur am Rande um mich. Als ich vom Suff mutig geworden war, legte ich einen Arm um ihre Hüfte. Sie schaute mir etwas überrascht in die Augen. Ich hielt ihrem Blick stand und dachte gar nicht daran, meinen Arm wegzunehmen. Das gefiel ihr offensichtlich. Von da an unterhielten wir uns prächtig. Ich stellte den Suff sofort ein, weil ich die Nummer, die ich mir erhoffte, unbedingt noch bei relativ klarem Verstand erleben wollte. An diesem Abend wurde daraus aber nichts mehr. Irgendwann stand sie auf und sagte, dass sie nach hause müsse. Sie machte auch überhaupt keine Anstalten, mich einzuladen mit ihr zu kommen. Ich war echt stinksauer und nahm vor lauter Frust die Sauferei wieder auf. Woher sie meine Nummer hatte, habe ich nie erfahren. Als ich am nächsten Mittag in meiner Bude immer noch meinen Rausch ausschlief, klingelte das Telefon. Sie war dran und lud mich für diesen Abend zu ihr ein. Ich war den ganzen Tag erfüllt von vorfreudiger Erregung und wurde in der kommenden Nacht nicht enttäuscht. Sie ließ mich zwar zunächst noch ein paar Stunden zappeln, zumal noch eine Freundin von ihr unangemeldet hinzugekommen war. Die störende Schickse verzog sich aber dann endlich, und wir legten los wie die Feuerwehr. Nachdem wir einige Zeit geschlafen hatten, fielen wir vor dem Aufstehen noch einmal übereinander her. Bei der Zigarette danach überlegte ich mir gerade, ob ich mich in sie verlieben könnte. Da teilte sie mir ganz trocken mit, dass sie den Wettbewerb mit ihrer Bekannten, die gestern Abend noch da gewesen war, nun gewonnen habe.
Ich verstand zunächst überhaupt nichts. Als ich nachfragte, sagte sie mir, dass ich Nummer 32 sei. Sie habe mit ihrer Freundin einen Wettbewerb laufen, in dem es um die Anzahl der flachgelegten Männer in diesem Jahr ginge. Es sei ja nun in wenigen Tagen zu Ende und ihre Gegnerin läge hoffnungslos hinten. Ich überlegte einen Augenblick, ob ich nun sauer oder beeindruckt sein sollte. Die Nacht mit ihr war einfach zu gut gewesen, deshalb entschied ich mich für die zweite Variante und beglückwünschte sie zu ihrem Sieg. Das fand sie nun wieder so gut, dass sie am ersten Januar mittags vor meiner Bude stand. Ich war noch ziemlich geschafft von der Silvesterfete, die bis in den Morgen gedauert hatte. Als ich sie aber vor meiner Tür stehen sah, war ich gleich hellwach. Ich begriff sofort, was sie vorhatte. In diesem Jahr war ich ihre Nummer eins.
Dunkel-Deutschland
Wir fuhren mit einem D-Zug ein Jahr vor der Maueröffnung nach Berlin. Dort wollten wir mit einigen Bundesbrüdern am Burschentag, der jährlichen Zentralveranstaltung unseres Verbandes, teilnehmen. Wir hatten uns in unseren Grundsätzen immer wieder für die Wiedervereinigung eingesetzt, obwohl wir deshalb nicht nur von den Linken in Bonn als Neo-Nazis beschimpft worden waren. Nicht einmal die kühnsten Optimisten hätten sich damals träumen lassen, dass dieses Ereignis nur noch etwas mehr als ein Jahr auf sich warten lassen würde. Die Gelegenheit, mir ein eigenes Bild von der anderen Seite unseres Vaterlandes zu machen, wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Wir waren zu dritt. Stefan spielte schon seit Jahren eine tragende Rolle in unserem örtlichen Verband und war politisch auch sehr engagiert. Er war recht stramm gebaut, trug einen Vollbart und war rhetorisch sehr versiert. Er war Burschenschafter mit Leib und Seele. Alex war sehr schlank, größer als ich und hatte halblange schwarze Haare, ein echter Frauentyp. Er war im gleichen Alter wie ich und kurz vor mir in unsere Bonner Burschenschaft eingetreten. Wir hatten uns auf Anhieb sehr gut verstanden und freuten uns schon lange vor dieser Fahrt auf das gemeinsame Erlebnis.
Der D-Zug verließ den Bonner Hauptbahnhof irgendwann am Abend und sollte am nächsten Vormittag am Berliner Bahnhof Zoo ankommen. Unmittelbar nach der Abfahrt holte Stefan die ersten drei Blechbüchsen mit einem billigen Bier aus der Palette, die wir als Wegzehrung in der Ablage über den Sitzen verstaut hatten. Wir prosteten uns zu und zischten die erste Hülse in zügigem Tempo. Unsere Laune nahm parallel mit dem Zug Fahrt auf.
„Mensch Stefan, wenn wir so weiter saufen, habe ich bald so einen Ranzen dran wie du“, versuchte Alex unseren Bundesbruder gleich aufzuziehen. Stefan stand über solchen Dingen. Er war die ständige Hänselei durchaus gewohnt. Nicht nur bei Veranstaltungen unserer Burschenschaft, sondern auch bei seinen zahlreichen politischen Pflichtterminen in der Bonner Partei gehörte der Alkoholkonsum zum guten Ton. Ein ansehnlicher Bauchansatz konnte dabei nicht ausbleiben.
„Hauptsache du fällst nicht nach der zweiten Hülse besoffen unter die Bank, lieber Bundesbruder“, konterte Stefan und grinste dabei wie ein Honigkuchenpferd.
„Das Stiftungsfest war schon heftig, nicht jeder steckt drei Tage Suff so weg wie du, Mann. Mit vollen Hosen ist gut stinken“, gab ich eine der zum Allgemeinwissen gehörenden Trinkerweisheiten zum Besten.
„Mensch, ich wäre doch gestern Nachmittag nicht schon so früh von der Bank gekippt, wenn es nicht so heiß gewesen wäre. Birgit ist jedenfalls noch vor mir ins Koma gefallen“, meinte Alex sich verteidigen zu müssen. Er spielte damit auf die Freundin eines Bundesbruders an, die gestern beim traditionellen Frühschoppen mit Damen, der grundsätzlich zum Abschluss des jährlichen Stiftungsfestes am Sonntag morgen zelebriert wird, plötzlich die Augen verleiert hatte und auf der Bierbank in sich zusammengesackt war. Birgit hatte sich allzu optimistisch am Stiefel-Saufen beteiligt. Die Mischung aus Bier und Sekt hatte ihr schon früh den Rest gegeben. Das lag neben der Hitze auch daran, dass sie keine Runde ausgelassen hatte. Jedes mal, wenn der Stiefel bei ihr vorbeikam, hatte sie einen kräftigen Schluck daraus genommen. Alex hielt zwar noch etwas länger durch als sie, erlebte das Ende des Frühschoppens am späten Nachmittag aber auch nicht mehr bei vollem Bewusstsein.
„An der Hitze lag es bestimmt nicht, dass du so kläglich versagt hast“, stichelte Stefan noch ein bisschen weiter.
„Ist schon in Ordnung. Nicht jeder ist sauftechnisch so in Schuss wie du“, gab Alex schließlich die kleine Auseinandersetzung verloren und nahm einen ordentlichen Schluck aus seiner Hülse.
„Dafür hast du eine gute Figur beim Ball gemacht, Alter“, versuchte ich Alex Stimmung wieder anzuheben. „Die elende Tanzerei ist ja nun überhaupt nicht mein Fall. Während dieser affigen Spielchen auf der Tanzfläche verzog ich mich lieber in die Sekt-Bar. Womöglich wäre ich noch wegen schwerer Körperverletzung in den Bau gewandert, wenn ich einer der Damen auf die Füße gelatscht wäre.“
Stefan zerknüllte seine gerade geleerte Hülse und schmiss sie scheppernd unter die Sitzbank. Alex und ich taten es ihm nach.
„Wir sind ja nicht zum Vergnügen hier“, meinte Alex und versorgte uns mit einer neuen Runde. Offenbar fühlte er sich durch Stefans Stichelei herausgefordert. Mir war gleich klar, dass er diesen Kampf nicht gewinnen konnte.
„Auf die Hauptstadt“, rief er lautstark aus, und wir stießen erneut an.
Wir kamen in den Ruhrpott. In Dortmund stiegen zwei Studentinnen zu, die auch nach Berlin wollten, was wir etwas später erfuhren. Draußen war es schon vor einiger Zeit dunkel geworden, und wir hatten bereits ein gutes Drittel der Hülsen geleert.
Die beiden Weiber waren ziemliche „Hässletten“. Sie trugen die typischen Uniformen der Öko-Tussis, Strickpullover und lange Röcke, dazu zottelige, seit Tagen offensichtlich ungewaschene Haare. Auch wenn sie unter ihren wenig animierenden Klamotten Traumfiguren verborgen hätten, was ich bezweifelte, wäre jedem einigermaßen normal gearteten Mann jeglicher Gedanke an einen gepflegten Flirt von vornherein gar nicht erst in den Sinn gekommen. Die beiden Liebestöter machten auch gleich keinen Hehl aus ihrer Einstellung zu Burschenschaftern, als sie unsere bunten Burschenbänder sahen, die wir quer über der Brust trugen. Sie schauten sich gegenseitig an, verzogen missbilligend ihre Mienen und schüttelten beide abfällig ihre Köpfe. Danach fischten sie bunte Schnellhefter aus ihren speckigen Rucksäcken und versuchten sich in die darin befindlichen handschriftlichen Notizen zu vertiefen. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um Seminarmitschriften. Die beiden humorlosen Hühner hatten beim Betreten des Abteils einen kaum hörbaren Gruß durch ihre gelben, ungepflegten Zähne gequetscht. Danach fiel für eine Weile kein weiteres Wort zwischen uns. Irgendwann musste Stefan unwillkürlich grinsen. Ich war sicher, dass er etwas ausheckte, während er einen Schluck aus seiner Hülse nahm.
„Dürfen wir den Damen ein kühles Bier anbieten?“, brach er schließlich das Schweigen. Mittlerschweres Entsetzen ergriff mich, als ich blitzschnell im Kopf überschlug, dass die Biervorräte selbst für uns drei nur noch bis zur Zonen-Grenze reichen würden. Ich hatte wenig Lust bei dem Lackaffen, der die Mini-Bar im Zug spazieren fuhr, für Preise wie im Puff Nachschub zu ordern. Meine Befürchtungen erwiesen sich jedoch als gänzlich unbegründet.
„Nee, wir trinken keinen Alkohol“, kam zu meiner unendlichen Erleichterung die schnippische Antwort von einer der beiden Öko-Tanten. Stefan lächelte gewinnend und ließ sich keineswegs von ihrem abweisenden Ton abschrecken.
„Darf ich fragen wohin ihr fahrt?“
„Wir müssen nach Berlin. Wir studieren da Politik-Wissenschaften“, kam von der anderen Schwester, die etwas zutraulicher zu sein schien. „Ich bin übrigens Caroline und das da ist Karola“, stellte sie sich vor, ohne dass jemand von uns danach gefragt hätte. Nachdem Alex daraufhin unsere Namen genannt hatte, kam auch ein erstes zaghaftes Lächeln von der reservierten Anti-Alkoholikerin zustande.
„Ihr seid doch in so einem rechten Studenten-Haufen. Das sehe ich an den bunten Bändern, die ihr da tragt“, rückte sie allerdings sofort die Verhältnisse wieder zurecht.
„Wie kommst du denn auf die Idee, dass wir ein rechter Haufen sind?“ wollte ich von der Kuh wissen und schlürfte mit einem etwas übertriebenen Geräusch einen weiteren Schluck aus meiner Hülse, um sie noch ein wenig zu provozieren.
„Na, das weiß doch jeder, dass ihr euch mit Schwertern prügelt und extrem frauenfeindlich seid“, brachte Karola im Brustton der Überzeugung heraus.
„Ja und außerdem singt ihr immer auf euren Saufgelagen die erste Strophe der Nationalhymne, einfach ätzend“, setzte Caroline noch einen drauf. Stefan war wieder an der Reihe.
„Die Dinger, mit denen wir uns nach eurem Sprachgebrauch prügeln, heißen nicht Schwerter, sondern Schläger, wenn ich diese Information mal wertfrei an euch weitergeben darf. Wir gehören übrigens zu einem Haufen, in dem das Prügeln, was man übrigens im Fachjargon Fechten nennt, gar nicht zur Pflicht gehört. Bei uns kann jeder entscheiden, ob er eine Mensur austrägt oder nicht.“
„Was soll das denn dann überhaupt mit der Fechterei?“, wollte Karola wissen. Offensichtlich hatte Stefan nun doch ihr Interesse geweckt.
„Indem einer unserer Bundesbrüder gegen den Vertreter eines anderen Bundes eine Mensur mit scharfen Klingen austrägt, möchte er beweisen, dass er bereit ist, für seine Farben den Kopf hinzuhalten. Niemand wird dabei ernsthaft verletzt, überhaupt kommen Verletzungen in den ersten Mensuren nur äußerst selten vor. Mir ist dabei überhaupt nicht klar, was das mit einer rechten Gesinnung zu tun haben soll“, klärte Alex unsere verbalen Gegnerinnen auf. „Ich bin übrigens der einzige von uns dreien, der eine scharfe Mensur gefochten hat. Die beiden anderen Weicheier hier haben gekniffen“, meinte er noch hinzufügen zu müssen. Grinsend richtete er sich mit einiger Mühe aus seinem Sitz auf. Die Nachwirkungen des Stiftungsfestes zeigten bei ihm erste körperliche Ausfallerscheinungen. Er stand auf, wobei er leicht schwankte, und langte zu den Resten der Palette auf der Ablage hinauf. Dann verteilte er eine neue Runde Hülsen an die anwesenden Biertrinker.
„Lasst euch von dem Spinner nicht irre machen“, versuchte ich die Stimmung ruhig zu halten. „Stefan und ich haben für uns entschieden, keine Mensur zu fechten. Die so genannte Mensurreife haben wir allerdings, wie jeder in unserem Bund, durch Stunden bei unserem Fechtmeister erlangt.“
„Ja, aber ihr habt doch was gegen Frauen“, warf Caroline nun ein. „Bei euch darf doch keine Frau mitmachen.“
„Mädels, jetzt mal ehrlich, wolltet ihr ernsthaft in einem Männerhaufen mitmachen, in dem nach eurer Vorstellung nur gesoffen wird und man sich gegenseitig die Köpfe einhaut?“, wollte Stefan nun wissen.
„Nee, natürlich nicht“, gab Caroline zur Antwort. „Aber selbst wenn, dürften wir das doch gar nicht.“