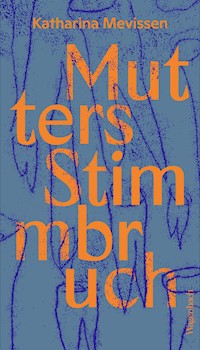Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein schalldichter Raum. Draußen die Großstadt. Osman Engels übt Cello. Er spielt an gegen unsichtbare Hindernisse, die irgendwo in seiner Vergangenheit liegen und denen er auf dem Fußballfeld besser ausweichen kann. In seiner Welt ersetzt Musik schon lange die Worte. Er kann selbst nicht gut zuhören, nichts festhalten, ohne Kontaktlinsen auch schlecht sehen. Als er ein zufällig gefundenes Aufnahmegerät abhört, wird er zum Ohrenzeugen einer Beziehung, die auf ganz andere Art laut ist. Seine Mitbewohnerin Luise lernt derweil im Nebenzimmer für ihre Prüfung, manchmal rauchen sie gemeinsam am offenen Fenster, kochen Knoblauchnudeln, bringen Altglas zum Container. Sie verstehen sich, ohne sich richtig anzufassen, denn auch mit der Liebe fangen sie gerade erst an. Als sein türkischer Vater, ebenfalls Musiker, sich das Handgelenk bricht und Tante Elide, seine Ziehmutter, nach fast zwanzig Jahren in Deutschland plötzlich nach Paris gehen will, ist Osman gezwungen, ein paar Dinge aufzuräumen, ein paar Fragen zu stellen. Der Roman erzählt von einem jungen Mann, dem Augen und Ohren geöffnet werden, und von einer Frau, die in der Stille lebt. Es geht um Vater-, Mutter- und Gebärdensprache und um die berührende Kraft von Musik. Ungewöhnliche Themen, eindringliche Bilder. Ein großes Talent.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Hanna
E-Book-Ausgabe 2018
© 2018 Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung: Simon Wahlers. Gesetzt aus der Lora.
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 9783803142450
Auch in gedruckter Form erhältlich: 9783803133069
www.wagenbach.de
1
Ich bin einer von denen, die atmen. Ich muss mit der Musik atmen, ihr und mir Luft zuführen, damit sie nicht erstickt und ich auch nicht. Nicht jedes Stück braucht viel Luft, aber manche bringen mich völlig außer Atem. Dann schnaufe ich schwer, keuche, zische, seufze. Susanne nennt es asthmatisch, Philipp sportlich. Mir wurde schon oft vorgeführt, wie ich meine Nase dabei aufblähe und rümpfe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich beim Cellospielen so dumm aussehe. Aber was will man machen. Schließlich hat jeder in der Musik sein eigenes Gesicht, und gegen die hartnäckigen Macken und Ticks lässt sich kaum etwas tun.
Ich hab angefangen, als ich vier war. Noch bevor ich rechnen und schreiben gelernt habe, prügeln, labern, lügen, Ballspiele, Tauschgeschäfte, all die Grundlagen, die man in der Schule lernt. Die Musik kam allem zuvor und Fußball knapp dahinter.
Schon mit fünfzehn wollte ich weg. Weg aus unserer Dreizimmerwohnung (Vater, Tante, Bruder), weg von meinem Vater und seiner Musik, von Musik überhaupt. Aber sie kam mir nach. Ist mir so lange gefolgt, bis ich stehen geblieben bin und mich umgedreht hab. Wir mussten uns in die Augen sehen: Wer kann länger.
Ich gab nach. Wir kamen wieder zusammen. So wie man es mit der ersten großen Liebe noch einmal versucht. Man spürt, dass irgendetwas nicht stimmt, aber es reicht, um weiterzumachen. Weil man nicht voneinander lassen kann. Und weil man sich so schnell wieder nah kommt, sich gewöhnt, bekämpft und braucht. Ich konnte und konnte nicht und konnte doch: Cello studieren. Ich würde sagen, dass ich schon einigermaßen klargekommen bin. Dass es geklappt hat, mit dem Neuanfang, bis. Bis mein Vater.
2
Ich lehne im Rahmen der geschlossenen Flügeltür, und über die Hinterköpfe der Leute hinweg beobachte ich Yokos Gesicht, während sie eine Sonate von Chopin spielt. Ihr Gesicht ist still wie ein See, fast regungslos. Yoko sieht am Cello so aus, wie viele Menschen sich das wohl vorstellen. Romantisch, konzentriert. Geschlossene Augen, zwischendurch ein Seufzer. Im Gesicht Anmut, in den Fingern Präzision. Die Leute könnten glauben, das sei alles Leichtigkeit, oder doch wenigstens eine große Leidenschaft, ein leiser, schöner Schmerz. Sie würden nicht glauben, dass Musik ein Biest sein kann, das dich von innen drangsaliert und keinen Ton in dir übrig lässt.
Aber nicht alle sehen so mustergültig aus wie Yoko. Es gibt viele Musiker, die sich bewegen. Die mitgehen, die Stirn runzeln, die Lippen spitzen, mit den Füßen wippen, mit dem Kopf schütteln oder nicken. Und dann gibt es die mit den stark bewegten Gesichtern, stürmisch, fast wild, als kämpften, als tanzten sie mit der Musik, die prusten, wiegen, summen, schmelzen, treiben, träumen, alles. Igor spielt so, und ich könnte ihm stundenlang dabei zusehen. Es ist ein Unwetter. Aber sobald er den Bogen weglegt, wird er wieder der höfliche, etwas umständliche Typ.
Jetzt rauscht Applaus durch den Saal, und die Tür in meinem Rücken geht auf.
»Os, wir sind dran!«, mahnt Igor über meine Schulter, die Violine schon unter der Achsel.
Ich nehme mein Cello und folge den anderen auf die Bühne, nun sehe ich das Publikum des Benefizkonzertes von vorne. Mein Blick überfliegt die Gesichter, die da sind, um zuzuhören, und sich kein bisschen vor Musik fürchten, und bleibt hängen. Das kann doch nicht. Was wollen die Jungs denn hier?
Susanne baut sich mit geradem Rücken hinter ihrem Kontrabass auf, Igor hebt die Violine. Philipp rückt ans Klavier und schüttelt die Finger aus. Manu sitzt neben ihm, um die Noten umzublättern. Ich fixiere das Cello am Boden und richte mich auf. Ich bemerke, dass mein Hemd fies unter den Achseln zwickt.
Wir tauschen Blicke. Wir stimmen nach. Ein paar grunzende Geräusche aus den mittleren Reihen. Dann wird es still, alles spannt sich. Wie in den letzten Sekunden vorm Sprint, wenn man in die Hocke geht, das Körpergewicht leicht nach vorne verlagert. Philipp nickt kurz, und wir rennen los, fünfzig Meter Mendelssohn Bartholdy, flink und federnd. Der Bodenkontakt ist flüchtig, der Puls hämmert. Es kommt mir vor, als hinge ich hinterher, nur ein paar Millimeter, als bekäme ich die Töne mit minimaler Verspätung zu fassen. Wir fliegen durch das Stück bis zur ersten weißen Linie, dann werden wir langsamer, leichter, trippelnd, weiter auf Zehen- und Fingerspitzen, pizzicato. Hier kann man atmen. Erster Satz.
Ich habs gewusst. Die Jungs klatschen direkt nach dem ersten Satz los, die Einzigen im Saal. Sie machen sich nichts aus der wortlosen Missbilligung, die ihnen ihre wohltätigen Sitznachbarn zukommen lassen. Sie dämpfen ihr Gelächter kaum.
Wir machen weiter, zweiter Satz, dritter. Finale. Applaus. Wir verbeugen uns, und Maik, Streifke, Dino und Wilma halten die Daumen hoch und gestikulieren, als ständen wir aufm Platz und nicht im Tschaikowsky-Saal. Die älteren Damen neben ihnen, denen klassische Musik ein ebenso inniges Anliegen ist wie die Förderung humanistischer Bildung und die daher großzügig für dieses Benefizkonzert gespendet haben, sind verstört. Ich beeile mich, von der Bühne zu kommen.
Susanne drückt die Flügeltür hinter uns zu. Und trennt uns von dem Applaus, der jetzt das Duo begrüßt, das nach uns dran ist.
»Was waren das denn für Deppen!«, schnaubt sie.
»Sorry, Leute. Die gehören zu mir«, gestehe ich und beginne, die obersten Knöpfe des kneifenden Hemds zu öffnen.
»Du hast die eingeladen?!«
»Ne! Sie sind ganz von allein gekommen.«
»Deine Freunde?«
»Meine Fußballjungs.«
Jetzt grinst Susanne. »Dann haben wir ja Glück gehabt.«
»Ja?«
»Na, dass nicht die ganze Mannschaft gekommen ist.«
»Die anderen sind eigentlich ganz nett. Aber die hier haben wirklich schlechte Manieren.«
Ich kann nicht aufhören, an meinem Hemd herumzuziehen.
»Das ist dir zu klein«, kommentiert Susanne.
»Ich weiß. Ist von meinem Mitbewohner. Meins war so fleckig, das ging gar nicht.«
»Hast du nur ein Hemd?!«
»Ne, ich hab schon mehrere. Theoretisch. Aber auf die Schnelle …«
Susanne gluckst.
»Benehmt euch!«, zischt Manu. »Da drinnen geht’s weiter.«
Als Susanne und ich nach dem Konzert ins Foyer kommen, hat Manu schon Sekt organisiert. Sie schiebt sich vorbei an Grüppchen aus wohlhabenden älteren Herrschaften und hält uns das Tablett hin. »Wo sind Igor und Philipp?«
»Wurden schon festgequatscht …«
Wir stoßen an. »Auf die Wohltätigkeit!«, rufe ich, wir kichern.
Jetzt kommt ein Ehepaar auf uns zu, sie bei ihm untergehakt. Sie strahlt mich an. »Wunderbare Musik! Und was für ein wunderbares Instrument, ich liebe Celli …«, schwärmt sie.
Ich lächle. »Ja, ich auch«, sage ich sanft, und Manu verkneift sich ein Lachen.
Die Dame linst ins Programmheft. »Sind Sie … Osman … Engels?«
»Der bin ich«, erwidere ich höflich und weiß genau, was als Nächstes kommt. Unsere Eltern haben mir und meinem Bruder den Gefallen getan, uns die Vornamen unserer beiden Großväter zu geben: Osman und Wilhelm. Bei älterem Publikum kommen sie meistens hervorragend an.
»Das ist aber ein interessanter Name. Darf ich fragen, woher …?« Ihr Blick wandert die Knopfleiste meines Hemds abwärts und kehrt wieder zurück.
»Aus dem Osmanischen Reich«, brummt ihr Gatte, der einen vollen weißen Oberlippenbart trägt.
»Genau. Aus dem Osmanischen Reich«, nicke ich ernst.
»Aber der Nachname …?«
»Stammt aus dem Ruhrgebiet und kann bis in die Zeit des deutschen Kaiserreiches zurückverfolgt werden.«
»Oh.« Sie nippt an ihrem Sekt. »Dann kommt Ihre Familie aus dem Osmanischen –«
»Aus der Türkei, Annette. Das Osmanische Reich bestand nur bis zum Jahre 1918. Übrigens genauso lange wie das Preußische Kaiserreich unter Kaiser Wilhelm II.«
»Ich komme aus dem Ruhrgebiet.«
»Ah, aber Ihre Vorfahren …«
Manu platzt dazwischen und fragt: »Woher kommen Ihre Vorfahren denn eigentlich?«
Die Dame guckt erschrocken. »Wie … äh, meine …?«
»Oooosman Engels!«, grölt in diesem Moment eine Stimme, und ich entdecke Dino, der sich durch das Gedränge auf uns zuarbeitet.
»Entschuldigen Sie mich«, lächle ich und gehe zu Dino, der mir tüchtig den Rücken abklopft und mich umgehend zu den Jungs bugsiert. Auf dem Weg zum anderen Ende des Foyers fängt er noch einen Kellner ab, der eine große Platte voller winziger Schnittchen befördert.
»Momentchen, darf man da mal kurz … was ist das denn Gutes?«, fragt Dino und beginnt sofort, die Platte abzuräumen. Bevor der Kellner detailliert Auskunft gegeben hat, hat Dino bereits an die zehn Häppchen auf seinem Handteller gestapelt.
»Dino!«, stöhne ich und ziehe an seinem Oberarm.
»Hört sich gut an. Probier ich mal.« Er nickt grinsend und hebt seine Schnittchenhand wie ein Tablett über seinen Kopf, als wir uns weiter vorwärts schieben.
Maik studiert die Broschüre des Reiche-Leute-Vereins, der sich der Bildungsförderung für benachteiligte Kinder in Hamburgs sozialen Brennpunkten verschrieben hat. Wilma und Streifke sitzen mit ihren Sektgläsern auf den Treppenstufen und drehen Zigaretten. Dino fängt an, sich ein Schnittchen nach dem anderen in den Mund zu werfen.
»Was wollt ihr denn hier?!«, zische ich, obwohl es mich insgeheim freut, dass die vier hier aufgekreuzt sind. Ein Grüppchen von Wohltätigen, die gerade mit ihren wenigen gewählten Häppchen auf Servietten an uns vorbeischweben, werfen Dino und mir enttäuschte Blicke zu.
»Wir interessieren uns für Musik und Bildung«, beginnt Wilma.
»Wir sind stolz auf dich, Engels!«, fährt Dino dazwischen und kommentiert mit vollem Mund: »Und schickes Hemd übrigens! Aber falsch geknöpft!«
Ich gucke an mir runter und stöhne auf.
»Dino, was snackst du da eigentlich, zeig mal her.« Wilma winkt Dino zu sich heran.
»Keine Ahnung, irgendwas Teures in ganz kleinen Stücken. Musste dir selber welche holen, die kann man nicht teilen. Weiß nicht, wie die hier satt werden wollen.« Dino vertilgt die letzten drei Schnittchen auf einmal.
»Willst du nicht mal ne ganze Platte für uns organisieren?«, schlägt Wilma vor.
Streifke hält mir sein Sektglas entgegen. »Schlimmes Zeug. Auf dich.«
Ich nehme mir die Kippe, die er auf seinem Knie abgelegt hat. »Gehn wir rauchen?!«
»Da kommt deine Kollegin, Engels.«
Susanne eilt auf hohen Absätzen zu uns herüber und baut sich vor uns auf. Wilma und Streifke mustern sie skeptisch, Dino nickt und wischt sich den Mund ab.
»Also ihr seid die unangenehmsten Gäste, die je zu einem Konzert der Hochschule …«
»Wo war ich stehengeblieben? Bildung und interkultureller Dialog sind uns sehr wichtig«, fährt Wilma fort. »Wir bemühen uns, die reichen Leute hier mit unseren milieuspezifischen Umgangsformen vertraut zu machen. Wir sorgen für Allgemeinbildung, könnte man sagen.«
Susanne gibt sich unbeeindruckt. Ihr Blick bleibt an meinen Hemdknöpfen hängen. »Os, dein Hemd ist falsch geknöpft«, bemerkt sie.
»Hab ich ihm auch schon gesagt.« Dino zwinkert ihr zu. »Cooles Instrument. Sehr groß.«
Susanne hebt eine Augenbraue und sieht ihn streng an, während sie ihr Glas leert. »Du hast da noch was«, sagt sie spitz und tippt gegen ihr Kinn. Dino reibt sich durchs Gesicht. »Weg?«
»Leute, können wir irgendwohin gehen, wo es Bier gibt?«, fleht Streifke. »Ich vertrag das hier echt nicht.«
»Was genau?«, frage ich grinsend.
Ich bin entschlossen, die Sache zügig hinter mich zu bringen. Ich werde das billigste schwarze Hemd kaufen, das sie im Sortiment haben.
Im Kaufhaus verlaufe ich mich nach wenigen Minuten. Die Wege sind mit Vitrinen, Restposten und Angebotskörben verstellt, und die Rolltreppen fahren immer in das Stockwerk, in das du nicht willst. Ich drehe bei den Strumpfwaren um, wahrscheinlich nicht mal die richtige Etage, durchquere die Damenabteilung. Aus den Lautsprechern schallt ein Lied aus den Achtzigern, und irgendwas in mir stolpert. Irgendetwas war. Ich bleibe stehen, bei der Abendgarderobe und den Kleidern. Der Song brettert los, Voyage, voyage von Desireless. Ich stehe zwischen den schwarzen Abendkleidern, knöchellange und knielange, aus glänzenden, knisternden Stoffen. Tiefe Rückenausschnitte, die noch länger wirken, wenn die Haare hochgesteckt sind und der Nacken dann frei. Irgendwas war da. Ich greife in den schwarzen Stoff hinein, Konzertstoff, kneife die Augen zusammen. Eine Szene schiebt sich in meinen Kopf.
Meine Eltern, Suat und Doris, in schwarzen, eleganten Kleidern, ihrer Konzertgarderobe, in der Küche. Spätabends, längst dunkel, nur das Licht der Dunstabzugshaube ist eingeschaltet, Doris sitzt auf der Tischplatte in ihrem langen schwarzen Kleid, die Hochsteckfrisur löst sich auf, ein paar Strähnen fallen ihr in den nackten Rücken. Ich sehe sie von hinten, vor ihr steht Suat, der seine Hände an ihren Armen runtergleiten lässt. Er sagt etwas, grinst, und sie lacht. Das Küchenradio, auf halblaut gedreht: Voyage voyage. Suat hebt Doris vom Tisch, trägt sie durch die Küche, es sieht aus wie ein Tanz, und sie lachen leise. Dann schließen sie die Küchentür, und durch das Milchglas sieht man die Szene nur noch unscharf. Ich stehe im dunklen Wohnungsflur, die Geräusche und die schwarzen Schemen überlagern sich und verschwimmen.
»Kann ich helfen?«
Ich sehe wieder klar. Vor mir steht eine Verkäuferin, die mich skeptisch anlächelt. Ihr Blick rutscht an mir herunter, zu meinen Händen, die ich immer noch im Stoff des Abendkleids vergraben habe.
»Äh, danke, äh, nein, ich, danke.«
»Sie suchen …?«
»Hemden! Schwarz!«, rufe ich schnell und viel zu laut.
»Sie sind hier in der Damenabteilung. Herren ist oben, Hemden und Anzüge, auf der zweiten Etage, gleich links, wenn Sie hochkommen.«
Ich haste die Rolltreppe hoch. Das Lied ist zu Ende, und ich bin benommen. Diese Szene, von der ich nicht wusste, dass es sie, dass es Doris in meinem Kopf überhaupt gibt. Von der ich den Nachnamen habe, aber kein Bild, dachte ich, und jetzt auf einmal doch. Aber nur der Rücken, kein Gesicht. Es muss von weit hinten gekommen sein, wo sich sonst nur die Kopfschmerzen ballen.
Ich überschlage die Jahre, aber ich kann die Zeit nicht fassen und diese Szene nirgends einfügen. Meine Eltern in der Küche, irgendwann nach einem Auftritt von Suat wahrscheinlich, zu zweit, verliebt, zusammen. Das Bild weicht, je mehr ich mich darauf konzentriere, auf Doris’ freien Rücken, die schwarze Abendkleidung, das schwächliche Licht und den halblauten Popsong. Ich kann dieser Szene nicht glauben: dass sie das sein soll, Doris, dass sie das sein sollen, Doris und Suat, besser einzeln zu nennen als zusammen, nicht Eltern, dieses Wort, das zwei Menschen zusammenfasst, als wären sie eins.
In der Umkleide knöpfe ich das schwarze Hemd zu, zupfe es zurecht und sehe mich im Kabinenspiegel an. Das sieht nicht elegant aus. Um die Hüften sitzt es nicht, und die Ärmel sind etwas knapp. Ich weiß noch nicht mal, brauche ich es dann eine Nummer größer oder eine Nummer kleiner. Ich kauf das jetzt.
3
Luise hat mich gefragt, ob ich mitgucken wolle, sie habe einen Film geladen. Ich kannte ihn nicht, und sie meinte, er sei etwas speziell. Nach den ersten siebzig Minuten würde ich eher sagen: Er ist einer von diesen komplizierten Streifen, die die konventionellen Sehgewohnheiten damit strapazieren wollen, dass fast nichts passiert. Bei denen man, immer wenn eine neue Figur auftaucht, denkt, ah, die ist wichtig, und dann kommt sie nie wieder. Ich mag solche Filme nicht, ich finde, das ist einfach schlechte Unterhaltung. Lieber schaue ich mir richtige Geschichten an, mit Drama und Spannung, und ehrlich gesagt, ich liebe Kitsch und Komödien, billigen Humor und absehbare Liebesgeschichten. Das einzig Spannende an diesem Film ist für mich, dass ich ihn mit Luise gucke. Ich überlege, mir einfach schon mal die Kontaktlinsen rauszunehmen. Luise könnte ich dann immer noch gut sehen, so eng sitzen wir auf ihrem Bett zusammen. Im Gegensatz zu mir folgt sie aufmerksam der Handlung, die es nicht gibt. Sie lacht zwischendurch.
»Lu, willst du auch noch ein Bier?«
Luise nickt. Als ich mit zwei Flaschen zurückkomme und ihr eine hinhalte, löst sie endlich mal kurz ihren Blick vom Bildschirm und sieht mir gründlich in die Augen, um mit mir anzustoßen. Während der Film läuft, bildet sich zwischen uns an einigen Stellen flächiger Körperkontakt. Die Außenseiten unserer Oberschenkel liegen aneinander an, unsere Schultern und Unterarme. Von mir aus könnte es noch viel mehr sein. Ich weiß sehr gut, dass Luise meine Mitbewohnerin ist und dass ich sie faszinierend finde, dass sie mich anzieht und verwirrt, kurz, dass ich unübersichtliche Gefühle für sie habe und dass so etwas in Wohngemeinschaften möglichst unterbunden werden sollte. Vor zwei Monaten bin ich hier eingezogen, und was mich an dieser WG am meisten überzeugt hat, war definitiv Luise. Beim Casting saßen wir in der Küche, Fenster offen, Kaffee auf dem Tisch, das gängige Konzept: Jeder erzählt was über sich, die anderen nicken und finden es cool, und allen ist es irgendwie unangenehm.
Ich hab viel geredet, wenig davon hatte was mit mir zu tun. Andi hat schlechte Witze gemacht und die üblichen Fragen gestellt (Dein Vorname, witzig, wie kam’s?, Oh, krass, Cello, wie viele Stunden übst du so am Tag?, Cool, und was sind sonst so deine Hobbys?). Chrissie war nicht da (wodurch sie ein treffendes Bild von sich abgegeben hat, denn man sieht sie fast nie, sie arbeitet viel und ist ansonsten immer bei ihrem Freund). Und Luise hat mich genau beobachtet, Zigaretten gedreht und kaum etwas gesagt (erst, als wir auf Filme kamen, hat sie losgelegt). Als wir am Ende in der Tür standen, grinste sie ein bisschen und meinte: »Ja dann. Bis bald? Also, von mir aus ist die Sache klar.«
Der Abspann setzt ein, und das Zimmer wird davon ziemlich dunkel. Das sind die klassischen Momente, in denen man sich noch etwas näher kommen könnte. Arm umlegen, Hand nehmen, und wenns gut läuft, knutschen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Luise das gefallen würde. Luise, die doch alles Klischeehafte zum Kotzen findet. Da klappt sie unvermittelt ihren Laptop zu, und auf einmal ist es völlig dunkel.
»Oder wolltest du den Abspann noch zu Ende gucken?«, fragt ihre Stimme aus dem Dunkeln.
»Nö«, sag ich und setze mich auf.
Kein Geräusch, keine Bewegung. Ich warte darauf, dass sie das Licht anknipst. Aber nichts passiert. Ich werde nervös.
»Lu?«
»Ja.«
»Was ist mit dem Licht?«
Jetzt regt sich Luise, und plötzlich sind da ihre Hände. Streichen über meine Unterarme aufwärts und bleiben auf meinen Schultern liegen. Ich bin so perplex, dass ich mich einfach gar nicht rühre. Dann ist ihr Mund in meinem Gesicht und ihre Zunge auch, auf meinen Augen, an meinem Kinn und auf meinen Lippen. Ich atme kurz, und zwischen meinen Pulsschlägen ist fast keine Pause mehr. Luise drückt mich gegen den Schrank am Kopfende ihres Bettes.
Ich traue mich nicht, sie anzufassen, irgendwo anzufangen mit ihrem warmen, starken Körper, der überall ist, den ich jetzt an so vielen Stellen gleichzeitig berühre, ohne ihn zu sehen.
Dann löst sie sich von mir, nimmt ihren Mund weg und ihre Hände, steigt aus dem Bett, geht ein paar Schritte und macht das Licht an. Ich kneife die Augen zusammen, und als ich wieder etwas sehen kann, ist da Luise, die an der Tür steht und mich betrachtet.
»Das war ein guter Film«, sagt sie und verschwindet im Bad.
Erst würgen und spucken die Duschköpfe, die Leitungen knattern, dann schießt das Wasser heraus, lau, wärmer, heiß. Wir stehen in der dampfenden Mannschaftsdusche und sind nackt und laut wie immer. Wortwechsel knallen kurz und scheppernd durch den gefliesten Duschraum.
Dino baut sich nackt vor mir auf und fängt mit dramatischer Miene an, ein unsichtbares Cello zu spielen. Er wimmert dazu die Melodie von My Heart Will Go On. Ich grinse und stoppe die 3-in-1-Shampooflasche, die zwischen Dinos Beinen hindurch über die Fliesen gepasst wird, mit dem Fuß. Die Duschen sprühen und nebeln uns ein, Pfützen aus Schaum und Schweiß stauen sich über den Abflüssen.
Runter vom Platz und raus aus der Dusche flacht der Geräuschpegel ab. Mein Klingelton plärrt hörbar durch die Umkleide, ich wühle nach meinem Handy. Tante Elide! Ich lasse den Anruf durchklingeln und bemerke jetzt, dass sie während des Trainings dreimal angerufen hat.
»Wer hat Bock, Millennium Star Döner?!«, wirft Wilma in die Runde.
Draußen lasse ich mich ein paar Meter hinter die Dönertruppe zurückfallen und rufe meine Tante zurück. Sie geht gleich ran. »Canım, da bist du endlich. Osman. Hörst du mich? Du musst kommen.«
Erst als Ali mir meinen Döner (mit bisschen scharf und ohne Kraut) über die Theke reicht, bemerke ich, wie wenig ich imstande bin, ihn in meinem Magen unterzubringen. Dino und Wilma haben sich schon tief in ihre Döner hineingearbeitet, als ich meinen auf dem Tisch ablege und überlege, was ich jetzt damit anfangen soll. Ich hole erst mal ne Cola.
»Die walzen auf Dauer alles platt, was geil ist. In zwei Jahren kann Ali dichtmachen. Drecksläden wie der da«, Wilma deutet auf das neue Café, das gegenüber von Millennium Star Döner aufgemacht hat, »müssen besteuert werden. Wer was mit Matcha in der Karte hat, Kokosnusswasser, Smoothies, Detox Chai oder Chia-Cupcakes, der muss blechen. Wer seine Kunden zwingt, auf Möbeln aus Europaletten vor unverputzten Wänden zu sitzen und aus Einmachgläsern frischgepressten Kiwi-Sellerie-Saft zu trinken, der muss dafür bezahlen!«
Gegenüber baumeln nackte Glühbirnen im Fenster, von dem die Kellnerin gerade das Detox-Donnerstag-Tagesangebot wischt.
Dino schmatzt und schluckt. »Das hier ist ein verdammt ehrlicher Döner. Der nichts anderes sein will als ein ehrlicher Döner.«
»Eben. Er will dich nicht entgiften, er will dich nicht heilen. Er ist einfach ehrlich zu dir. Und Ehrlichkeit muss belohnt werden. Deswegen kriegt Ali dann das, was mit der Gentrifizierungssteuer eingenommen wird, und kann damit die verdoppelte Ladenmiete bezahlen.«
»Os, was guckst du deinen Döner so schüchtern an?«
»Ich glaub, der ist nicht vegan.«
Wilma und Dino kichern. Ihre sind bis auf einen Brotstreifen im Papier zusammengeschrumpft.
Ich salze gründlich nach und beiße ein paarmal hinein, aber meine Tante hat mir mit wenigen Sätzen den Magen verdorben. Und das bei einem Exemplar von Millennium Ali, das ist eine Katastrophe. »Boah, sorry, ich bin durch.«
Wilma und Dino gucken. »Echt jetzt?«
»Ja, irgendwie … ist mein Magen nicht fit. Bedient euch.«
Dino übernimmt die Sache und fräst sich zügig durch den Döner. »Der ist anders als meiner.«
»Ohne Kraut.«
»Nicht so geil, ohne Kraut. Und bisschen salzig.«
Wilma wischt sich den Mund ab. »Noch mal zurück zu der Steuer. Man könnte die …«
»Ich packs mal, Jungs. Wir sehen uns …«
Dino hebt die Hand. »Ah, Engels, aber was ist jetzt mit deiner Kollegin …?«
»Dino, ich weiß nicht …«
»Kann ich die mal gepflegt auf nen Döner einladen, oder ist die schon …«, Dino weist auf den Laden gegenüber, »zum anderen Ufer übergelaufen?«
Ich grinse mühsam und ziehe die Tür auf. »Ich frag mal. Haut rein.«
Nach ein paar Hundert Metern verschwinde ich in der U-Bahnstation. Die Rolltreppe transportiert mich abwärts durch den verkachelten Schacht. Ich stehe still, bis die Bahn einschießt. Obwohl ich mich beeile, schlagen die Türen fast vor mir zu, so schwer fällt mir jede Bewegung vorwärts.
Mein Zimmer liegt im Dunkeln, es gibt nur dieses kranke Halblicht, das die Bildschirme von Laptops nachts spenden. Die Seite des Busunternehmens taucht den Raum in einen eklig grünen Flimmer, während ich die einzige bezahlbare Verbindung zu einer unmenschlichen Uhrzeit von Hamburg nach Essen buche. Die Seite lädt, und der grellgrüne Schriftzug erscheint: Vielen Dank für Deine Buchung! Eine generelle Übelkeit breitet sich in mir aus, und es gibt allen Grund dazu; das Licht, die Busfahrt um 6 Uhr 30 und mein Vater.
Ich hab ja gesagt, ja, Tante, ich komme. Ich komme übermorgen.
4
Ich erreiche unseren alten Hausblock in der Krawehlstraße, einen Bau aus Wiederholungen von drei Zimmer/Küche/Bad/ Balkon, verbunden durch einen Flurschlauch. In einer dieser Wiederholungen bin ich aufgewachsen, haben wir gelebt. Inzwischen ist nur noch Elide dort, und manchmal Suat. Ich drücke die Klingel kurz und fest, die vierte von unten, und ich weiß, wie es jetzt oben in der Wohnung scheppert. Ihre Stimme in der Gegensprechanlage ruft: »Osman! Du bist das!«
Die Tür summt. Ich nehme die Treppen.