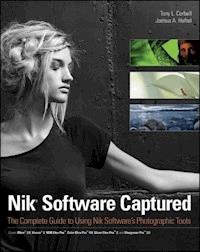Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Vermessung der Zukunft Wie wachsen Muttermale? Wie lassen sich Hörsäle und andere Räume optimal nutzen? Wie wird sich die Verbreitung eines Virus durch eine Impfung verändern? Alles lässt sich in ein Modell gießen und simulieren. Das ist die Kernkompetenz von Niki Popper und seinem Team – ihr Kreativort ist die »drahtwarenhandlung«, ein Biotop für Profis aus Mathematik, Simulation und künstlicher Intelligenz. Nicht die Frage nach dem »Wieviel«, sondern nach dem »Warum« treibt sie an. In seinem ersten Buch gibt Simulationsexperte Niki Popper interessante Einblicke in seinen Forscheralltag, erzählt von komplexen Herausforderungen trotz neuester Technologien, skurrilen Aufgabenstellungen, Erfolgen und Misserfolgen – und warum Menschen manchmal Kommazahlen sind. Mit einem Glossar und zahlreichen Abbildungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NIKI POPPER
Ich simuliere nur!
Von mathematischen Modellen,virtuellen Muttermalen und demVersuch, die Welt zu verstehen
Aufgezeichnetvon Ursel Nendzig
Mit 41 Abbildungen
Bildnachweis
Archiv drahtwarenhandlung/Grafik: Tino Klissenbauer (24, 62, 64/65, 67, 69, 70, 134/135, 156, 168/169, 189), dwh GmbH/TU Wien ( 28/29, 31, 32, 106/107, 124/125, 164/165, 186, 201, 230), Archiv drahtwarenhandlung ( 40, 90, 113, 141, 147, 148, 151, 182, 231, 240), Archiv drahtwarenhandlung/Collage: Hannes Landsiedl ( 41, 43, 44, 48, 115, 120/121, 197, 207, 210, 211), DWH/Hannes Landsiedl (177)
Der Verlag hat alle Rechte abgeklärt. Konnten in einzelnen Fällen die Rechteinhaber der reproduzierten Bilder nicht ausfindig gemacht werden, bitten wir, dem Verlag bestehende Ansprüche zu melden.
Gefördert von der Stadt Wien Kultur
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2022 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Johanna Uhrmann
Umschlagfoto: © Stefan Knittel
Lektorat: Martin Bruny
ISBN 978-3-99050-218-1
eISBN 978-3-903217-91-1
Für alle Mitmodellierer, Co-Simuliererund jene, die immer wieder fragen, was das alles sollund ob wir einfach nur raten.
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1Simulationsforschung
Ein Blick auf die Uhr, viele Daten und doch ein bisschen Corona
Job-Description
Das Bevölkerungsmodell
Blick in die Zukünfte
Kompetenzgrenzen
Kapitel 2Die Drahtwarenhandlung
Ein einzigartiges Lokal, Antithesen zu Planung und Prognose
Wenn Mathematiker planen
Der Gong
Business was?
Wachstum
Apropos Austausch
Kapitel 3System Dynamics
Eine andere Sicht auf die Welt, in der Menschen auch Kommazahlen sein können
Im Großen und Ganzen
Elegante Beschreibungen und ein erster Überblick
Die Welt verstehen
Kapitel 4Das Gesundheitssystem
Porsche, Payers, Providers und Patients
Die TU-HVB-dwh-Kooperation
Nichtkapitalistisch?
Eine (ausschließlich wissenschaftliche) Goldgrube
Kapitel 5Agentenbasierte Modelle
Schach, ein Rückschritt und Muttermale
Ein Fall für Agenten
Füchse und Hasen
Die Vielfalt der Agenten
Rechenleistung
Kapitel 6Projekt »More Space«
Mehr Platz in weniger Räumen, Auslastung und Ausnutzung
Wunderschön, in der Theorie
Auslastung versus Ausnutzung
Keine Zauberei
Wieder einmal im Fokus: der Mensch und seine Umwelt
Kapitel 7Zelluläre Automaten
Endliche Freiheit, unendliche Dimensionen, Spiel des Lebens
»Game of Life«
Stark limitiert
Klingt kompliziert, ist es auch
Kapitel 8Benchmarking
Hüpfende Bälle, ein halbes Jahr in Barcelona und Modelle und Modellierer auf dem Prüfstand
Den Finger in die Wunde
Kapitel 9 Modellvergleich
Von der Unzulänglichkeit von Modellen und warum Demut erforderlich ist
Von Modellierung und Modell
Pneumokokken, again
Das Modell als Krücke
Verifikation und Validierung
Modellvergleich
Vergleich im Dreiklang
Wie jetzt vergleichen?
Mathematischer Vergleich
Die Sache mit der Demut
Kapitel 10dwh versus INiTS
Babyunternehmen, Inkubatoren und beratungsresistente Antikapitalisten
Nicht skalierbar
Kapitel 11Modellkopplung
Ein Flughafen, mehrere Modelle und zwei Probleme
Von Agenten zu Entities
Problem eins: das Timing
Problem zwei: das Level
Die All-in-One-Lösung
Kapitel 12Didaktik
Berechenbare Liebe, ein virtuelles Pendel und »Pulp Fiction«
Berechnete Liebe
Die richtige Frage
Epidemie, Weltuntergang
Kapitel 13Modelle in Zukunft
Existenzielles, Allmachtsfantasien und Visionen
Subjektivität
Woher kommen die Daten?
Existenziell, nicht optional
Handeln bewerten
Kapitel 14Corona
Die große Pandemie, Freitag, der 13., und eine zweifelhafte Ehre
Jänner 2020
Februar 2020
März 2020
Verantwortung
Missverständnisse
Ein Prozess, immer auf Messers Schneide
Trotzdem, ein Blick in die Zukunft
Anmerkungen
Glossar
Danksagung
Vorwort
Die Idee, ein Buch zu schreiben, haben heutzutage viele Menschen. Speziell dann, wenn sie in den Medien vorkommen. Und ich denke, dass jede oder jeder, der oder die diese Idee hat, sich fragt: Was habe ich eigentlich Neues zu erzählen? Zumindest sollte er oder sie sich das fragen. Gibt es irgendetwas, das in den vielen und hohen Buchstapeln in den Läden nicht schon abgehandelt ist?
Mit dieser Frage im Hinterkopf habe ich mir überlegt, was ich schreiben könnte, das nicht schon erzählt worden ist. Naheliegend wäre es gewesen, ein Buch darüber zu schreiben, was sich in der Zeit der Corona-Pandemie alles ereignet hat. Ein Covid-Buch ist es aber nicht geworden, auch wenn wir am Schluss ein wenig darauf eingehen.
Vielmehr wollte ich über zwei Themen schreiben, und dazu haben wir das Buch in zwei Teile geteilt.
Einerseits geht es darum, warum ich und wir – wer »wir« ist, dazu kommen wir noch – unsere Modelle so bauen, wie wir es tun. Wie ich seit meiner Kindheit die Welt betrachte und warum es mir so wichtig ist, Modelle zu bauen, um diese Welt besser zu verstehen, täglich etwas dazuzulernen oder auch manchmal Dinge zu verbessern. Die Kapitel mit ungerader Nummer und in normaler Schrift sind aus meiner Perspektive geschrieben. In ihnen geht es um Modelle, Simulationen, ein bisschen Mathematik und Informatik – und sie bereiten mir ehrlich gesagt großes Bauchweh. Denn es ist nicht so einfach, so etwas so zu erzählen, dass es verständlich, unterhaltsam und dabei trotzdem faktisch halbwegs korrekt bleibt. Im Sinne des Vernetzens von Gedanken, des Erklärens von Hintergründen habe ich in diesen Kapiteln mehr vereinfacht, als ich meinem Bauch eigentlich zumuten kann. Vieles ist nicht ganz korrekt, manches sogar ein wenig »verbogen«. Mathematikerinnen und Informatiker (oder umgekehrt) werden mir also – mit Recht – vorwerfen, Ungenaues oder gar Falsches zu schreiben. Insofern bitte ich alle Profis, mir diese Unschärfen und Ungenauigkeiten zu verzeihen. Aber mit strengem und gütigem Auge hat meine Mitautorin Ursel Nendzig darauf geachtet, dass die Texte verständlich bleiben – auch für Leserinnen und Leser, die nichts mit Mathematik, Programmieren oder Simulation am Hut haben. Diese Texte dienen vor allem dazu, zu erklären, wie Modellierung meiner Ansicht nach funktionieren könnte, warum wir etwas tun oder eben nicht tun. Es geht auch darum, zu erklären, wann Mathematik gut funktioniert und wann wir uns eher an die Informatik halten – und umgekehrt – und welche Anwendungen sich mehr für Simulation eignen und welche weniger. Diese Kapitel eignen sich also sehr gut, um viele Diskussionen über das »richtige« Modell zu starten. Wir glauben, dass es kein gutes Modell gibt, sondern nur möglichst wenig schlechte.
Diese Modelle entstehen andererseits in Köpfen, in Computern – und an einem ganz speziellen Ort, der Drahtwarenhandlung, die neben meiner akademischen Welt existiert und eine Art geniales Biotop ist. Ihren doch etwas ungewöhnlichen Namen hat sie, weil sie vor uns tatsächlich ein Geschäft beherbergte, in dem es alles aus und mit Draht zu kaufen gab. In den Kapiteln mit geraden Nummern, die aus der Sicht der Besucherin geschrieben sind, soll es darum gehen, wie ich und meine Kolleginnen und Kollegen dorthin kamen, wo wir heute sind – räumlich und inhaltlich, und warum es hier neben Artificial Intelligence und Simulation ein echtes Lokal mit Speisen und Getränken gibt und eine Filmproduktion und Animationsfirma beherbergt wurde (und im Kleinen noch wird).
Die Drahtwarenhandlung habe ich gemeinsam mit Thomas Peterseil und Michael Landsiedl gegründet. Sie wurde von uns als Ort erdacht, der uns die Möglichkeit gibt, so zu arbeiten, wie wir uns das vorstellen. Es ist auch der Drahtwarenhandlung zu verdanken, dass wir die Dinge so umsetzen konnten, wie wir es eben taten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden dort ein hoffentlich meist angenehmes Umfeld vor, wir empfangen Gäste aus dem In- und Ausland und sahen und sehen unsere Kinder hier aufwachsen.
Die Drahtwarenhandlung wirkt vielleicht auf manche Menschen unprofessionell. Sie glänzt nicht wie ein Consulting-Unternehmen, und sie strahlt auch nicht die Weisheit eines Auditorium Maximum aus. Aber sie ist der beste Nährboden für kreative und wissenschaftliche Arbeit und der perfekte Ort, um sich ohne Einschränkungen und Limitierungen des Denkens mit neuen Modellen zu beschäftigen.
Die meisten Leserinnen und Leser kennen mich hoffentlich als Forscher, der versucht, Dinge greifbarer zu machen (manchmal auch, soweit möglich, heiter), aber dabei jedenfalls professionell und ernsthaft zu agieren. Das mache ich auch, denn die Dinge, die uns beschäftigen, sind ernst. Krankheiten wie Covid, der Krieg in der Ukraine, Klimawandel, die Verteuerung in der Energieversorgung und vieles mehr. Aber ich denke, das widerspricht sich nicht. Mein Vater, pensionierter Architekt und Künstler, malt traurige Bilder, auch um seine eigene Geschichte von Flucht und Krieg aufzuarbeiten, und meine Mutter kümmert sich oft um kranke oder traurige Menschen. Das gut und mit Freude zu tun, was wir können, und das gerne machen, womit wir beitragen können, erscheint mir als das Beste, was wir mit unserem Leben tun können. Und dabei Freude zu haben und nicht immer auf das eigene Image zu achten auch.
Die Universität, die Wissenschaft sowie ihre Mechanismen und all die ernsthaften Dingen gab und gibt es in meinem Leben (nach einer langen Pause zwischen 2000 und 2010), und sie sind mir sehr wichtig. Dass sie in diesem Buch, bis auf einige Verweise auf hoffentlich, soweit möglich, allgemein verständlich ausgewählte Publikationen, kaum vorkommen, ist bewusst so gewählt. Es wäre sonst ein »anderes« Buch geworden.
Dieses Buch wird es der Leserin und dem Leser nicht ermöglichen, selbst Modelle zu entwickeln (also im Kleinen schon, wie zum Beispiel ein Modell, um eine Party zu planen). Es bietet auch keine neuen, »großen« Lösungen. Es erzählt nichts darüber, wie wir die Probleme der Zukunft lösen können. Das wäre vermessen in der aktuellen Zeit. Ich glaube nicht daran, dass es da eine Patentlösung gibt.
Vielmehr ist dieses Buch der Versuch, eine Art Mindset zu beschreiben – die Art Mindset, die es ermöglicht, offen an Probleme heranzugehen, ohne zu glauben, dass es nur eine Möglichkeit gibt, die Welt zu beschreiben. Es erzählt davon, wie Modelle dabei helfen können, die Welt besser zu verstehen.
Wir können nur versuchen, Prozesse besser zu begreifen und dieses Wissen mit anderen Menschen teilen. Das sollte man immer mit viel Demut tun, aber auch mit dem freudigen Blick auf das Potenzial, das diese Arbeit uns gibt.
Wenn Sie all das interessiert, würde es uns freuen, wenn Sie unser Buch lesen. Lesen Sie nur die Kapitel mit ungeraden Nummern, wenn Sie mehr über Modelle und Simulation erfahren möchten. Lesen Sie nur die Kapitel mit geraden Nummern, wenn Sie der »Gossip« mehr interessiert. Lesen Sie abwechselnd, kreuz oder quer. Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, auf die Welt zu schauen.
Wir bauen keine Brücken, wir entwickeln keine Impfungen, und wir erfinden kein neues Material, das die Welt besser macht.
Ich simuliere nur.
Kapitel 1Simulationsforschung
Ein Blick auf die Uhr, viele Daten und doch ein bisschen Corona
Wenn wir auf eine Uhr schauen, sehen wir, wie sich der Zeiger bewegt. Immer im gleichen Abstand, jede Sekunde einen Tick weiter. Hätten wir keine Information über das Uhrwerk, würden wir dieses Muster ablesen und dennoch nach einiger Zeit daraus prognostizieren können, wie sich der Zeiger weiterbewegen wird. Unsere Analyse beruht auf den Daten, die wir ablesen – je länger wir das tun, umso schlauer werden wir.
In unseren Modellen versuchen wir hingegen, das Uhrwerk auseinanderzunehmen – zu verstehen, wie die Rädchen ineinandergreifen – und nachzubauen. Das ist der Kern unserer Arbeit: Wir wollen die Welt im Computer nachbauen. Mit all ihrer Kausalität, ihrer Widersprüchlichkeit.
Dabei gibt es viele unterschiedliche Systeme. Ein Uhrwerk kann man gut beschreiben – aber was, wenn es sehr viel komplizierter ist? Wenn es um ein System wie eine Welt geht, mit ihren Menschen, die sich in einem System, ihrer Welt, bewegen, Entscheidungen treffen, ihren Gewohnheiten nachgehen?
Dieses Nachbauen bringt große Vor- und Nachteile mit sich. Als Methode ist es nicht unbedingt immer dafür geeignet, bessere Prognosen zu machen, als es beispielsweise mit einfachen Modellen, etwa einem simplen Excel-Sheet, möglich wäre.
Darum geht es aber oft gar nicht. Es geht darum, dass wir sehr komplizierte Systeme mit vielen Mechanismen abbilden und daraus virtuelle Zukünfte, Szenarien abbilden können und schauen, wie sie sich voneinander unterscheiden. Wir sind in der Lage, dadurch Varianten zu unterscheiden. Das ist der Mehrwert unserer Methode. Wir können Handlungsmöglichkeiten vergleichen und, wenn man es technisch noch ein Stück weiter analysiert, eine Aussage dazu treffen, mit welcher Sicherheit eine Variante besser ist als eine andere. Das hat mit der Sensitivität (siehe Glossar) unseres Systems zu tun, also der Frage, wie stark sich Änderungen auswirken. Vergleichbar ist das mit dem berühmten Schmetterling, der mit seinem Flügelschlag einen Orkan auslösen kann. Wenn eine solche kleine Veränderung große Auswirkungen hat, ist das immer schlecht für Systeme – oder für die Stabilität einer Vorhersage.
Job-Description
Es ist nicht einfach, zu fassen, worin unser Job besteht. Ich werde oft gefragt: »Was sollen wir bei Ihnen als Beruf dazuschreiben?« Und ich antworte meistens: »Simulationsforscher.« Das war bis vor ein paar Jahren kein geflügeltes Wort, inzwischen ist es ein bisschen bekannt. Warum es so schwer zu fassen ist, ist einfach erklärt: weil das, was wir tun, eine wilde Mischung aus Programmieren, Datensammeln, Datenanalyse, mathematischem Modellieren, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Visualisierung (siehe Glossar) ist, gespickt mit den Besonderheiten des jeweiligen wissenschaftlichen Feldes, mit dem wir es zu tun haben. Epidemiologie etwa. Vor 30 Jahren gab es kaum eine dieser Berufsbeschreibungen wirklich, und wenn es sie gab, hat damals jeder dieser Berufe völlig anders ausgesehen.
Ich wollte jedenfalls schon immer genau diese wilde Mischung machen. Ich habe Mathematik studiert – aber nicht, um Mathematiker zu werden. Ich bin eigentlich ein grottenschlechter Mathematiker im Vergleich zu vielen Kolleginnen und Kollegen rund um mich. Ich wollte nie geometrische Figuren erforschen oder neue Primzahlen finden – Gebiete, worüber es spannende Bücher gibt. So stellt man sich ja eigentlich Mathematiker vor. Vielmehr hat mich schon in der Schulzeit interessiert, wie die Welt funktioniert.
Wenn man sich die Welt anschaut, ist es ja fast nie so, dass es einen Punkt gibt, von dem aus die Entwicklung linear weitergeht, vielmehr gibt es meistens Rückkoppelungseffekte. Norbert Wiener, einer der Begründer der Kybernetik, hat genau das in seinem Buch Cybernetics1 schon im Jahr 1948 beschrieben. Ein einfaches Beispiel daraus: Ein Thermostat sorgt dafür, dass eine Heizung so lange das Wasser erwärmt, bis ein Sollwert erreicht ist, dann hört sie auf. Genau solche Systeme haben mich interessiert: selbstregelnde Systeme.
Als ich 1992 nach der Matura am Rainergymnasium im 5. Wiener Gemeindebezirk eine Berufsmesse besuchte und gefragt habe: »Ich möchte solche Dinge beschreiben und simulieren, was soll ich studieren?«, war die Empfehlung: »Studier Mathematik! Dann hast du die formalen Grundlagen. Das Programmieren, das kann man zusätzlich lernen oder jemandem anvertrauen, der darauf spezialisiert ist.« Damit macht man sich bei meiner heutigen zweiten Heimatfakultät, der Informatik, zwar keine Freunde, und sicher wäre es auch umgekehrt gegangen. Aber es war ein guter Weg. Und genau so ist es 2003 mit der Gründung der »Drahtwarenhandlung« tatsächlich gekommen. Was die Drahtwarenhandlung ist, dazu komme ich später.
Ich habe also Mathematik studiert, aber immer mit der Intention, Modelle zu bauen und zu simulieren. Schon bald habe ich an der TU bei der Forschungsgruppe »Modellbildung und Simulation« von Felix Breitenecker am Institut für Analysis und Scientific Computing angedockt, die am ehesten das gemacht hat, was ich machen wollte: ganz unterschiedliche Systeme aus dem echten Leben modellieren und simulieren.
Damals waren das recht einfache Dinge: Warteschlangen im Restaurant, Produktionsanlagen oder einfache ökologische Systeme mit Füchsen und Hasen. Ich hätte es damals nicht für möglich gehalten, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich 25 Jahre später europaweite Logistikprozesse für die ÖBB simulieren und optimieren, neuartige Modellkonzepte für Produktionsnetzwerke entwickeln, um energieeffizienter zu produzieren, oder weltweite Pandemien modellieren werden.
Es ist ein praktischer Zufall (oder vielleicht auch nicht, vielleicht war es eine Art Vorahnung und hat mich genau deshalb interessiert?), dass Modelle heute diese hohe Relevanz haben.
Als das Coronavirus Anfang 2020 in China begann, um sich zu greifen, waren wir schnell. Schon Ende Jänner suchten wir die ersten chinesischen Studien aus Wuhan heraus und berechneten erste Szenarien. Der Grund dafür, dass wir so schnell agieren konnten, war, dass wir die Daten nur in unser bereits bestehendes Modell einspeisen mussten. Und zwar in ein Modell, das nicht einfach Daten verarbeitet, sondern versucht, die Dynamik von Epidemien im Computer nachzubilden.
Um das zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurücktreten und den Unterschied zwischen kausalen (siehe Glossar) und datengetriebenen Modellen betrachten, wie schon zu Beginn mit dem Uhrwerk. Zwei unterschiedliche Methoden, in einem Beispiel erklärt: Wenn ein Auto mit 200 km/h frontal in eine Mauer kracht, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Fahrer, die Fahrerin des Autos diesen Aufprall nicht überleben wird – eine kausale Folge des Zusammenstoßes.
Ein Mensch, der nur datengetriebenen Modellen glaubt, würde sagen: »Das kann ich so nicht bestätigen. Ich müsste es erst viele Male ausprobieren, mir dann die Häufigkeiten der Ergebnisse anschauen – und kann dir danach hochrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Crash tödlich endet.«
Abgesehen davon, dass das hoffentlich nicht wirklich jemand ausprobiert: Das extreme Beispiel bringt uns in die Versuchung, zu meinen, dass das ja ohnehin klar ist und beides gleich gut funktioniert. Der datengläubige Mensch wird feststellen, dass in 100 Prozent der Fälle die Daten übereinstimmen werden. Und das kausale Modell führt wohl zum gleichen Ergebnis: Berechnet man auf Basis der physikalischen Gleichungen und mit einigen medizinischen Annahmen den Aufprall, kommt ein eindeutiges Ergebnis heraus.
Aber was, wenn es nicht so eindeutig ist? Wenn wir zum Beispiel herausfinden wollen, wie schnell das Auto sein darf, um unter einem gewissen Schaden zu bleiben, oder welche Maßnahmen man zusätzlich setzen müsste, um die Passagiere in Sicherheit zu halten?
Wir mit unserem kausalen Modell versuchen, die Welt so nachzubauen, wie sie ist – oder zumindest, was wir davon verstehen. Wir würden also, basierend auf physikalischen Gesetzen und mechanischen Grundsätzen, den Unfall am Computer nachbauen, ablaufen lassen und zusammen mit medizinischen, anatomischen Annahmen erkennen, was passiert. In einem Modell können wir der Realität dann mit immer mehr Daten immer näher kommen.
Beide Ansätze haben also ihre Berechtigung. Wir werden die Realität nie exakt beschreiben können, aber immer und immer genauer nachbauen, bis wir mit fast völliger Sicherheit vorhersagen können, was passieren wird, oder bis wir feststellen, dass es nicht funktioniert, vernünftige Aussagen zu treffen. Auch das ist uns schon oft passiert.
Das Bevölkerungsmodell
Mit der Intention, möglichst genaue Aussagen zu treffen, sind wir Anfang der 2010er-Jahre an die Modellierung unseres Bevölkerungsmodells gegangen. Wir haben ein kausales Modell geschaffen, das die Bevölkerung so genau wie möglich nachempfindet. Wir haben uns gefragt: Welche Menschen wohnen wo? Wie bewegen sie sich? Wie interagieren sie? Und im nächsten Schritt: Welche anderen Dinge spielen mit? Wie funktioniert zum Beispiel die medizinische Versorgung? Wie die Energieversorgung? Wie die Mobilität?
Die Schwierigkeit dabei sind die vielen Unsicherheiten, was das System betrifft. Es liegt der Bevölkerung ja nicht eine einfache Gleichung zugrunde, sondern es handelt sich um ein irrsinnig komplexes Zusammenspiel Tausender Faktoren. Allein die Tatsache, wie Menschen netzwerken – bis vor wenigen Jahren hätten wir keine Chance gehabt, ein solches Modell zu bauen, weil es nicht die nötigen Daten dafür gegeben hat.
Die Idee, die Welt nachzubauen, ist wahrscheinlich sehr, sehr alt, zumindest mehrere Jahrhunderte. Nichts Neues also … Womit wir aber zumindest in Österreich ziemlich die Ersten waren: Wir haben eine Bevölkerung für Österreich am Computer nachgebaut, ein Modell programmiert, das über viele Jahre für sehr unterschiedliche Fragestellungen einsetzbar ist. Eine Verbindung zwischen mathematischer Modellierung und Software-Programmierung.
Das Modell selbst ist ein sogenanntes Agentenmodell, in der Wissenschaft sagt man dazu auch allgemeiner mikroskopisches Modell, im Gegensatz zu makroskopischen Modellen, die zum Beispiel auf Differentialgleichungen basieren. Dies sind die zwei Arten von Modellen, die wir unterscheiden.
Die Idee, mit Agenten zu modellieren, ist schon etwa 50 bis 70 Jahre alt und stammt ursprünglich unter anderen vom Mathematiker John von Neumann, wobei es hier viele Wurzeln gibt. Wir betrachten dabei die Welt so, als würden wir Objekte identifizieren, die ein eigenständiges Verhalten haben. Die Agenten sind dabei erst einmal zwei Objekte, die koexistieren. Das ist die Grundbedingung, und, dass sie miteinander und mit der Umwelt interagieren, wie es im lateinischen Wort »agere« (handeln) schon steckt.
Angenommen, das Modell ist so programmiert, dass diese zwei Agenten, die sich immer in Bewegung halten müssen, immer einen Mindestabstand von 10 Zentimetern haben. Lassen wir einen Agenten sich bewegen, so bewegt sich auch der andere. Falls ihm der andere zu nahe rückt, dann grundsätzlich in die andere Richtung. Schon haben wir ein dynamisches System mit zwei einfachen Regeln. Es ist ein etwas triviales System, die beiden Agenten werden zufrieden vor sich hin mäandern und sich entweder umkreisen oder irgendwohin streben.
Ein einfaches Agentenmodell: Die Agenten (Kugeln) folgen einer einfachen Regel, nämlich: Haltet stets den gleichen Abstand zueinander (oben). Komplizierter wird es mit mehreren Agenten (unten) und raffinierteren Regeln, etwa: Der Abstand muss mindestens 10, maximal 20 cm sein. Die Agenten versuchen, den angestrebten Zustand zu erreichen.
Spannender wird es, wenn wir mehr Agenten nehmen und nur etwas kompliziertere Regeln aufstellen. Etwa folgende: Der Abstand zu allen Agenten sollte mindestens 10 Zentimeter sein, aber nicht größer als 20 Zentimeter. Die Agenten werden nun versuchen, den angestrebten Zustand zu erreichen, es wird ihnen aber nie perfekt gelingen, denn es ist kaum möglich, dass für eine große Zahl an Agenten diese Regeln genau eingehalten werden. Was wir beobachten können, ist das dauernde Streben nach dem perfekten Zustand. Und die realistische Einsicht, diesen nie zu erreichen – oft im Leben gibt man sich dann mit weniger zufrieden. Agenten geht es da auch nicht anders. Wir können also auch beobachten, wie gut solche Modelle die Realität abbilden können.
In unserem Bevölkerungsmodell ist diese Dynamik natürlich noch etwas komplizierter. Menschen bewegen sich zwar auch, aber auf vielen verschiedenen Ebenen. Sie stehen in der Früh auf und gehen zum Beispiel in die Arbeit oder in die Schule. Das bestimmt, wo sie sich im Tagesverlauf befinden. Zwischenmenschliche Interaktionen finden auf einer detaillierteren Ebene statt. Wie nahe bewege ich mich an andere Menschen heran, und wovon hängt das ab? Das ist zum Beispiel nicht nur interessant, wenn es um Covid-19 geht, sondern etwa um sexuell übertragbare Krankheiten. Aber das ist ein anderes Thema. Auf einer dritten Ebene betrachten wir dann Interaktionen wie Urlaubs- oder Geschäftsreisen oder Menschen, die zeitweise oder ganz umziehen.
Das Neue an unserem Bevölkerungsmodell ist also, dass wir das konkrete Thema der Bevölkerung quasi ein für alle Mal modellieren wollten, um damit die Möglichkeit zu haben, es für viele Fragen und Forschungspartner einsetzen zu können, ohne immer wieder die gleichen Fehler machen zu müssen.
Dazu mussten wir das Modell bewusst sehr einfach und modular halten, weil wir schon am Anfang, vor über zehn Jahren, gelernt haben, dass es die Eier legende Wollmilchsau nicht gibt. Man kann nicht ein Modell programmieren und damit alle Fragen der Welt (oder zumindest jene, die die Bevölkerung Österreichs betreffen) simulieren. Wäre das so einfach, hätte es längst jemand erfunden.
In seinem Kern ist das Bevölkerungsmodell auf gut Wienerisch watscheneinfach und besteht aus den Parametern Alter und Geschlecht. Diese beiden Parameter werden für fast alle Fragestellungen gebraucht. Der Wohnort ist schon nicht mehr für alle Fragen relevant, es reicht oft grob der Bezirk. Eigenschaften wie Raucher oder Nichtraucher, Wohnsituation und Ausbildung werden dem Modell bei Bedarf hinzugefügt. Genauso wie etwa Wetterdaten: Die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) hat uns freundlicherweise Daten über Temperatur und Niederschlag zur Verfügung gestellt, so war es uns möglich, zu testen, ob wir in Zukunft Wetterdaten einbauen können.2
Wir bekamen auch Daten vom österreichischen Forschungsprojekt zur Abwasseranalyse (abwassermonitoring.at), mit denen wir abschätzen konnten, welche Medikamente oder Krankheitserreger wo und in welcher Konzentration nachgewiesen wurden – im konkreten Fall ging es um Covid-19.3
Wir kommen also je nach Fragestellung mit vielen anderen Disziplinen zusammen, haben mit Archäologinnen, Medizinerinnen oder Historikerinnen zu tun. Jeder hat Daten für uns, die wir in unser Modell einspeisen können und mit denen wir in der Lage sind, das System »Bevölkerung« besser zu beschreiben.
All diese Daten »legen« wir auf unser Bevölkerungsmodell und können so für jeden virtuellen Menschen, jeden Agenten in unserem Modell etwa einschätzen, welches Wetter er wann erlebt hat. Für alle 8,9 Millionen. Wichtig ist, zu verstehen, dass diese Agenten keine realen Personen sind, sondern statistische Repräsentanten (siehe Glossar). Jeder Einzelne dieser Repräsentanten oder Agenten steht für eine Person – aber nur im Sinne der Statistik. So wuseln in unserem Modell die richtige Anzahl Frauen, Männer, Kinder, 47-Jährige, Akademikerinnen etc. herum. Sie sind aber keine realen Personen. Das ist auch nicht notwendig, denn die Überlegung dahinter lautet: In welchem Detailgrad möchte ich die Auswertung haben? Meist ist es völlig ausreichend, eine Auswertung auf Bezirksebene durchzuführen. Wir suchen schließlich nicht eine bestimmte Person, sondern die Aussage über ein wahrscheinliches Szenario.
Im Fall von Covid-19 (siehe Kapitel 14) waren vor allem die Ansteckungen interessant. Dafür sind Informationen darüber wichtig, wie sich die Menschen bewegen, wie oft sie mit anderen Menschen Kontakt haben – und was passiert, wenn ein Mensch krank wird. Dazu brauchen wir aber nie die tatsächlichen, exakten Daten einer gewissen Person, es reichen die statistischen Repräsentanten, die in der Dynamik immer das Richtige machen.
Ein anderer Fall wäre etwa die sogenannte Predictive Medicine (siehe Glossar) – wenn also ein Arzt einem Patienten mitteilt, mit welcher Wahrscheinlichkeit er laut seinen medizinischen Daten zum Beispiel an Krebs erkranken wird. Dafür braucht er ein exaktes, datenbasiertes Modell, das er ganz genau auf eine Person hin mit ihren persönlichen Daten auswertet. Diese Daten brauchen wir nicht. Und wir wollen sie gar nicht …
Blick in die Zukünfte
Es gibt im Grunde zwei verschiedene Möglichkeiten, wie wir aus unserem Modell Auswertungen ableiten. Zum einen ein Datenmodell, das nichts anderes ist als ein Ergebnis, verschiedene Szenarien, mögliche Zukünfte. Diese berechnen wir, und sie bestehen im einfachsten Fall aus einer Kurve. Am Beispiel von Covid-19 würde diese Kurve etwa die Erkrankungen zeigen. Es können auch viele Kurven sein, wenn die Daten nach Alterskohorten aufgeteilt werden, nach Geschlecht oder nach Wohnbezirk.
Beispiele für Kontaktnetzwerke mit gefundenen und unbekannten Fällen nach Popper et al (2021)4
Zum anderen können wir jeden einzelnen der 8,9 Millionen virtuellen Agenten einzeln exportieren. Beliebig genau. Von einem bis zu 8,9 Millionen Datensätzen, strukturiert nach Alter, Geschlecht und allen anderen Eigenschaften, die wir zuvor eingespeist haben, die wir modelliert und berechnet haben. Wir erhalten dadurch ein genaues Netzwerk unserer Individuen über den Zeitverlauf.
Je weiter außen die Punkte sind, desto länger liegt der Ursprungsfall zurück.
Und das ist das Spannende. Wir können mit diesen enormen Mengen an durch die Simulation produzierten Daten nicht nur jeden einzelnen unserer statistischen Repräsentanten beobachten und schauen, wie er sich auf einer Landkarte bewegt, sondern ihn auch von der Wiege bis zur Bahre verfolgen. Unser Modell ist dynamisch und nimmt die Menschen ebenfalls in ihrer Dynamik wahr. Das mag blumig klingen, trifft es aber auf den Punkt. Wir bekommen nicht nur Zahlen heraus, sondern dynamisches Verhalten. Wie genau dieses Verhalten mit der Realität übereinstimmt, ist eine wichtige Frage, um die es später gehen soll.
Ein Aspekt, den wir bei unseren Analysen zum Coronavirus dadurch besser verstehen konnten, ist die Dunkelziffer, also die unentdeckten Krankheitsfälle, und wie sich die Immunität gegen die Coronaviren entwickelt. Dazu haben wir möglichst viele Studien, die es bis dahin zu diesem Thema gab, in unser Modell eingerechnet. Es zeigte sich eine Kurve, die nicht parallel zu den entdeckten Fällen verlief, sondern unterschiedlich starke Zu- oder Abnahmen aufwies. Jene Virologinnen und Virologen, mit denen wir zusammenarbeiten, waren erstaunt darüber, vor allem, weil sich diese Kurve mit ihrem eigenen Bauchgefühl deckte.
Bei einem Anstieg der Infektionen war die Dunkelziffer der Infizierten zuerst sehr hoch. Kausal betrachtet ergibt das durchaus Sinn: Wenn das Virus erstmals beginnt, sich auszubreiten, findet man in dieser Anfangsphase die Leute nicht. Vielleicht, weil wenig getestet wird, aber auch wegen der Latenzzeit (der Zeitspanne zwischen Infektion und Infektiosität, also bis zu dem Zeitpunkt, ab dem man ansteckend ist) und der Inkubationszeit (der Zeitspanne zwischen Ansteckung und Symptomatik, also dem Auftreten von Krankheitsanzeichen). Ein evolutionär effektiver Virus hat eine sehr kurze Latenzzeit und eine möglichst lange Inkubationszeit, denn das ist genau die Phase, in der man andere ansteckt, ohne es zu merken. Im Anschwingen der Kurve ist es also nur logisch, dass jene, die später als Erkrankte erkannt werden, schon als unentdeckte Fälle vorhanden sind. Das ist eine Erklärung dafür, dass die ansteigende Kurve der »undetected cases« nach vorn verschoben ist – und eine spannende Erkenntnis, die wir dank unseres Modells gewinnen konnten, die mit einem klassischen, datenbasierten Modell nicht abbildbar gewesen wäre. (https://bit.ly/3riKCCy)
Berechnung der Entwicklung der Covid-19-Dunkelziffer mit Stand 1. März 2021. Darunter die daraus resultierende Immunisierung gegen Infektion in der Bevölkerung, nach Bicher et al (2022)5. Wir simulieren in diesem Fall nicht eine Zukunft, sondern versuchen eine »hinter den gemessenen Daten« liegende Dynamik besser zu verstehen.
Mit einem kausalen Modell wie diesem ist es also nicht nur möglich, Input und Output anzuschauen, sondern, dank der Regeln, die im Dazwischen wirken, Zusammenhänge herzustellen. Mit diesen »modellierten« Zusammenhängen gehen wir dann zu jenen Menschen, die sich mit der Materie auskennen, entwickeln die Annahmen weiter und können so neue virtuelle Experimente entwickeln. Spannend ist daran auch, um wie viel komplizierter Systeme über die Zeit werden.
Die gleiche Auswertung mit Stand 1. Mai 2022 zeigt die verschiedenen Virusvarianten. In der daraus resultierenden Immunisierung gegen Infektion erkennt man Anwachsen, Abfallen. Das ist wichtig, um die beste Impfstrategie entwickeln zu helfen. (https://bit.ly/3riKCCy)
Aber jedes Modell hat auch Schwächen. Es muss mit enorm vielen Daten und all ihren Unsicherheiten und Mängeln kalibriert werden. Ein extrem schwieriges Unterfangen. Es gibt Größen, die man einfach nicht messen kann. Eine davon ist, um beim Beispiel Covid-19 zu bleiben, die Saisonalität.