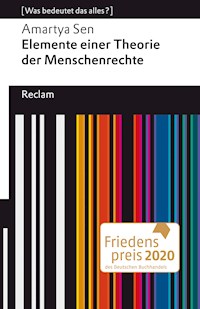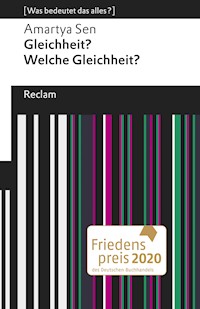9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Gewalt wird dadurch angefacht, dass man leichtgläubigen Leuten, die in die Hände von kundigen Fachleuten des Terrors fallen, ausschließliche Identitäten aufschwatzt.“
Amartya Sen
Identität kann eine Quelle von Stolz und Freude, Kraft und Selbstvertrauen sein – und sie kann töten. Hemmungslos töten. Das geschieht, wenn Identität durch die Ausgrenzung von anderen Menschen zementiert wird und so Differenz in Hass umschlägt. Aber diese Identitäten sind Konstrukte und verabsolutieren einzelne Merkmale. Lange vor dem Aufstieg identitärer Bewegungen überall auf der Welt hat der indische Philosoph und Nobelpreisträger Amartya Sen in diesem Buch gezeigt, dass Identitäten niemals statisch sind und kein Mensch nur eine einzige Identität besitzt. Es hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren und legt überzeugend dar, warum die Einsicht in die universale Vielfalt der menschlichen Existenz der Schlüssel zu einer friedlicheren Welt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Amartya Sen
IDENTITÄT UND GEWALT
Aus dem Englischen vonFriedrich Griese
Mit einem Nachwort zur deutschen Neuausgabe
Aus dem Englischen von
Andreas Wirthensohn
C.H.Beck
Zum Buch
«Gewalt wird dadurch angefacht, dass man leichtgläubigen Leuten, die in die Hände von kundigen Fachleuten des Terrors fallen, ausschließliche Identitäten aufschwatzt.» Amartya Sen sagt all jenen den Kampf an, die uns auf eine einzige Identität festlegen wollen, in der es statt Freiheit Vorurteile und statt Vielfalt nur noch Stereotypen gibt. Wenn wir eine Zukunft wollen, in der Gerechtigkeit, Kooperation und Toleranz den Sieg über Fundamentalismus, Vereinfachung und Gewalt davontragen, dann müssen wir uns mit den unverändert aktuellen Thesen von Sen auseinandersetzen. In einem eigens für die deutsche Neuausgabe dieses Buches geschriebenen Nachwort zeichnet der Nobelpreisträger die beunruhigenden Entwicklungen des letzten Jahrzehnts in knapper Form nach und betont dabei die unveränderte Notwendigkeit, radikalen Identitätsfixierungen im Namen einer pluralistischen Gesellschaft entgegenzutreten.
Über den Autor
Amartya Sen ist Professor für Philosophie und Professor für Ökonomie an der Harvard Universität. 1998 erhielt er den Nobelpreis für Ökonomie, 2020 wurde ihm der Friedenspreis des deutschen Buchhandels zuerkannt. Mehr als 100 Ehrendoktorate weltweit wurden ihm zuerkannt. Bei C. H. Beck sind von ihm erschienen: «Die Idee der Gerechtigkeit» (22020), «Indien. Ein Land und seine Widersprüche» (2014, mit Jean Drèze) und zuletzt «Die Welt teilen. Sechs Lektionen über Gerechtigkeit» (2020).
Inhalt
Prolog
Vorwort
1. KAPITEL Die Gewalt der Illusion
2. KAPITEL Was heißt Identität?
3. KAPITEL Gefangen in der Kultur
4. KAPITEL Religionszugehörigkeiten und muslimische Geschichte
5. KAPITEL Westen und Antiwesten
6. KAPITEL Kultur und Unterdrückung
7. KAPITEL Globalisierung und Widerspruch
8. KAPITEL Multikulturalismus und Freiheit
9. KAPITEL Freiheit zu denken
Nachwort
Anmerkungen
Personenregister
Für Antara, Nandana, Indrani und Kabirin der Hoffnung auf eine weniger inIllusionen gefangene Welt
Prolog
Als ich vor einigen Jahren von einer kurzen Auslandsreise nach England zurückkam (ich war damals Rektor – Master – des Trinity College in Cambridge), stellte mir der Beamte der Einwanderungsbehörde in Heathrow, der meinen indischen Pass sehr eingehend prüfte, eine einigermaßen knifflige philosophische Frage. Wegen des Wohnsitzes, der auf dem Einwanderungsformular angegeben war (Master’s Lodge, Trinity College, Cambridge), wollte er wissen, ob der Rektor, dessen Gastfreundschaft ich augenscheinlich genoss, ein enger Freund von mir sei. Das stimmte mich nachdenklich, denn mir war nicht ganz klar, ob ich behaupten konnte, ein Freund von mir zu sein. Nach einiger Überlegung kam ich zu dem Schluss, dass die Frage zu bejahen war, denn ich bin oft ziemlich freundlich zu mir, und außerdem kann ich, wenn ich dumme Sachen sage, sofort sehen, dass ich angesichts von Freunden, wie ich einer bin, keine Feinde brauche. Da es einige Zeit in Anspruch nahm, das alles zu klären, wollte der Beamte der Einwanderungsbehörde genau wissen, warum meine Antwort auf sich warten ließ und ob mit meinem Aufenthalt in Großbritannien etwas nicht stimmte.
Nun, dieses praktische Problem wurde schließlich gelöst, aber das Gespräch war ein Wink, wenn es denn eines solchen bedurfte, dass Identität eine komplizierte Sache sein kann. Natürlich können wir uns unschwer davon überzeugen, dass ein Objekt mit sich selbst identisch ist. Der große Philosoph Wittgenstein bemerkte einmal, es gebe «kein schöneres Beispiel eines nutzlosen Satzes» als den, dass etwas mit sich selbst identisch ist, der aber doch, so fuhr Wittgenstein fort, «mit einem Spiel der Vorstellung verbunden ist».
Noch komplizierter wird es, wenn wir von der Vorstellung, dass etwasmit sich selbst identisch ist, zu jener übergehen, dass man mit anderen von einer bestimmten Gruppe eine Identität teilt (das ist die Form, welche die Vorstellung von sozialer Identität sehr oft annimmt). Aus dem Anspruch, den unterschiedliche Gruppen auf unvereinbare Identitäten erheben, entstehen denn auch viele politische und soziale Konflikte, weil der Begriff der Identität unser Denken und Handeln auf vielerlei Weise beeinflusst.
Mit den gewaltsamen Vorfällen und Greueltaten der letzten Jahre hat eine Zeit schrecklicher Verwirrung und furchtbarer Auseinandersetzungen begonnen. Die Politik der globalen Konfrontation gilt vielfach als natürliche Folge religiöser oder kultureller Spaltungen der Welt. Die Welt wird sogar, wenn auch nur implizit, zunehmend als ein Verbund von Religionen oder Zivilisationen verstanden, wobei man sich über alle anderen Blickwinkel, unter denen die Menschen sich selbst sehen, hinwegsetzt. Dieser Sichtweise liegt die merkwürdige Annahme zugrunde, dass es nur ein einziges, überwölbendes System gebe, nach dem man die Menschen einteilen kann. Wenn man die Weltbevölkerung nach Zivilisationen oder Religionen unterteilt, gelangt man zu einer «solitaristischen» Deutung der menschlichen Identität, wonach die Menschen einer und nur einer Gruppe angehören (die hier durch Zivilisation oder Religion definiert ist, während man früher die Nationalität oder die Klassenzugehörigkeit in den Vordergrund stellte).
Mit einer solitaristischen Deutung wird man mit ziemlicher Sicherheit fast jeden Menschen auf der Welt missverstehen. Im normalen Leben begreifen wir uns als Mitglieder einer Vielzahl von Gruppen – ihnen allen gehören wir an. Eine Person kann gänzlich widerspruchsfrei amerikanische Bürgerin, von karibischer Herkunft, mit afrikanischen Vorfahren, Christin, Liberale, Frau, Vegetarierin, Langstreckenläuferin, Historikerin, Lehrerin, Romanautorin, Feministin, Heterosexuelle, Verfechterin der Rechte von Schwulen und Lesben, Theaterliebhaberin, Umweltschützerin, Tennisfan, Jazzmusikerin und der tiefen Überzeugung sein, dass es im All intelligente Wesen gibt, mit denen man sich ganz dringend verständigen muss (vorzugsweise auf englisch). Jede dieser Gruppen, denen allen diese Person gleichzeitig angehört, vermittelt ihr eine bestimmte Identität. Keine von ihnen kann als die einzige Identitäts- oder Zugehörigkeits-Kategorie dieser Person aufgefasst werden. Angesichts unserer unausweichlich pluralen Identität müssen wir im jeweils gegebenen Kontext entscheiden, welche Bedeutung wir unseren einzelnen Bindungen und Zugehörigkeiten zumessen.
Um ein menschliches Leben zu führen, muss man also nachdenken und eine Wahl treffen. Der Gewalt wird dagegen Vorschub geleistet, wenn wir die Ansicht hegen, wir müssten unausweichlich eine angeblich einzigartige – oft streitbare – Identität haben, die augenscheinlich weitreichende (und zuweilen höchst unangenehme) Forderungen an uns stellt. Das Auferlegen einer angeblich einzigartigen Identität gehört oft als entscheidender Bestandteil zu der «Kampfkunst», sektiererische Auseinandersetzungen zu schüren.
Viele gutgemeinte Bemühungen, solche Gewalt zu unterbinden, werden leider dadurch erschwert, dass unsere Identitäten erkennbar nicht frei gewählt sind, was unsere Fähigkeit, die Gewalt zu besiegen, ernsthaft beeinträchtigt. Sieht man, wie es zunehmend der Fall ist, die Chancen für gute Beziehungen zwischen unterschiedlichen Menschen vornehmlich in der «Freundschaft zwischen Kulturen», im «Dialog zwischen religiösen Gruppen» oder in «freundschaftlichen Beziehungen zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften» (unter Absehung von den vielfältigen sonstigen Möglichkeiten, wie Menschen sich aufeinander beziehen), so wird der Mensch, noch ehe die geplanten Friedensprogramme eingeleitet sind, schwerwiegend verkürzt.
Unser gemeinsames Menschsein wird brutal in Frage gestellt, wenn man die vielfältigen Teilungen in der Welt auf ein einziges, angeblich dominierendes Klassifikationsschema reduziert, sei es der Religion, der Gemeinschaft, der Kultur, der Nation oder der Zivilisation – ein Schema, dem in Sachen Krieg und Frieden jeweils einzigartige Wirkung zugeschrieben wird. Die Aufteilung der Welt nach einem einzigen Kriterium stiftet weit mehr Unfrieden als das Universum der pluralen und mannigfaltigen Kategorien, welche die Welt prägen, in der wir leben. Sie läuft nicht nur der altmodischen Ansicht zuwider, dass «wir Menschen alle ziemlich ähnlich sind» (über die man heutzutage gern – und nicht ganz unbegründet – spottet, weil sie allzu unbedarft ist), sondern auch der seltener erwähnten, aber sehr viel plausibleren Auffassung, dass wir auf mannigfaltige Weise verschieden sind. Die Hoffnung auf Eintracht in der heutigen Welt beruht in hohem Maße auf einem klareren Verständnis der Vielzahl unserer menschlichen Identitäten und der Einsicht, dass diese sich überschneiden und damit einer scharfen Abgrenzung nach einem einzigen unüberwindlichen Einteilungskriterium entgegenwirken.
Neben bösen Absichten trägt nämlich auch die gegenwärtige Begriffsverwirrung erheblich zu der Unruhe und Grausamkeit bei, die wir ringsum beobachten. Die Illusion der Schicksalhaftigkeit insbesondere der einen oder anderen ausschließlichen Identität fördert die Gewalt in der Welt sowohl durch Unterlassungen als auch durch Taten. Wir müssen deutlich erkennen, dass wir viele verschiedene Zugehörigkeiten haben und auf sehr viele unterschiedliche Weisen miteinander umgehen können, gleichgültig, was die Aufwiegler und ihre aufgeregten Gegner uns sagen. Wir selbst können über unsere Prioritäten entscheiden.
Die Vernachlässigung der Vielfalt unserer Zugehörigkeiten und der Pflicht, nachzudenken und eine Wahl zu treffen, verfinstert die Welt, in der wir leben. Sie treibt uns hin zu den erschreckenden Aussichten, die Matthew Arnold in «Dover Beach» geschildert hat:
And we are here on a darking plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night.
(Wir sind hier wie in einer dunklen Bucht,
Wo – von Alarmen, die sie nicht verstehen, gehetzt –
bei Nacht sich schlagen zwei Armeen.)
Das kann nicht alles sein.
Vorwort
Oscar Wilde stellte die rätselhafte Behauptung auf: «Die meisten Menschen sind jemand anderes.» Das mag nach einem seiner ausgefallenen Wortspiele klingen, doch in diesem Fall begründete Wilde seine Ansicht sehr überzeugend: «Ihre Gedanken sind die Meinungen anderer, ihr Leben ist Nachahmung, ihre Leidenschaften sind Zitate.» Tatsächlich werden wir in erstaunlichem Maße von Menschen beeinflusst, mit denen wir uns identifizieren. Sektiererischer Hass kann sich, wenn er aktiv geschürt wird, zu einem Flächenbrand ausweiten – das haben wir in letzter Zeit im Kosovo, in Bosnien, Ruanda, Timor, Israel, Palästina, im Sudan und an vielen anderen Orten auf der Welt gesehen. Das Gefühl der Identität mit einer Gruppe kann, entsprechend angestachelt, zu einer mächtigen Waffe werden, mit der man anderen grausam zusetzt.
Viele der Konflikte und Grausamkeiten in der Welt beruhen denn auch auf der Illusion einer einzigartigen Identität, zu der es keine Alternative gibt. Die Kunst, Hass zu erzeugen, nimmt die Form an, die Zauberkraft einer vermeintlich überlegenen Identität zu beschwören, die andere Zugehörigkeiten überdeckt, und in einer entsprechend kriegerischen Form kann sie auch jedes menschliche Mitgefühl, jede natürliche Freundlichkeit, die wir normalerweise besitzen mögen, übertrumpfen. Das Ergebnis ist dann entweder krude elementare Gewalt oder heimtük-kische Gewalt und Terrorismus im globalen Maßstab.
Tatsächlich ist die Annahme, man könne Menschen ausschließlich aufgrund der Religion oder Kultur zuordnen, eine kaum zu unterschätzende Ursache potentieller Konflikte in der heutigen Welt. Der darin enthaltene Glaube an die alles andere beherrschende Macht einer singulären Klassifikation kann die ganze Welt in ein Pulverfass verwandeln. Oft wird die Welt ausschließlich als eine Ansammlung von Religionen (oder «Zivilisationen» oder «Kulturen») betrachtet, unter Absehung von anderen Identitäten, welche die Menschen haben und schätzen, darunter Klasse, Geschlecht, Beruf, Sprache, Wissenschaft, Moral und Politik. Eine solche einseitige Einteilung löst mehr Konflikte aus als das Universum der pluralen und mannigfaltigen Zuordnungen, welche die Welt prägen, in der wir heute leben. Der Reduktionismus der hohen Theorie kann, oft ungewollt, zur Gewalt der niederen Politik beitragen.
Weltweite Bemühungen um die Überwindung dieser Gewalt werden zudem nicht selten durch eine ähnliche begriffliche Unklarheit behindert; wenn explizit oder implizit eine einzige Identität hingenommen wird, werden dadurch viele der naheliegenden Möglichkeiten des Widerstandes verbaut. Religiös begründete Gewalt wird dann am Ende nicht durch eine Stärkung der Zivilgesellschaft bekämpft, sondern durch die Einsetzung von «gemäßigten» Religionsführern, die die Extremisten in einer innerreligiösen Auseinandersetzung besiegen sollen, indem sie beispielsweise die Forderungen der jeweiligen Religion neu definieren. Wenn man die zwischenmenschlichen Beziehungen nur unter dem Aspekt der Beziehungen zwischen Gruppen sieht, etwa der «Freundschaft» oder des «Dialogs» zwischen Zivilisationen oder Religionsgemeinschaften, und dabei andere Gruppen ignoriert, denen die betreffenden Menschen gleichzeitig angehören (seien es Zusammenschlüsse wissenschaftlicher, sozialer, politischer oder sonstiger kultureller Natur), dann geht vieles, was im menschlichen Leben von Bedeutung ist, gänzlich unter, und man steckt die Menschen in kleine Kästchen.
Dieses Buch handelt von den erschreckenden Folgen einer solchen Verkürzung des Menschen. Sie verlangen von uns eine Überprüfung und Neubewertung etablierter Begriffe, darunter die ökonomische Globalisierung, der politische Multikulturalismus, der historische Postkolonialismus, die soziale Ethnizität, der religiöse Fundamentalismus und der globale Terrorismus. Die Chancen auf Frieden in der heutigen Welt könnten sehr wohl davon abhängen, dass wir die Pluralität unserer Zugehörigkeiten erkennen und anerkennen und dass wir als gemeinsame Bewohner einer großen Welt von der Vernunft Gebrauch machen, statt uns gegenseitig unverrückbar in enge Schubladen zu stecken. Vor allem müssen wir klar erkennen, wie wichtig die Freiheit ist, die wir bei der Bestimmung unserer Prioritäten haben können. Und im Zusammenhang damit müssen wir die Rolle und Wirksamkeit des wohlüberlegten öffentlichen Widerspruchs in den einzelnen Ländern und weltweit angemessen würdigen.
Das Buch ist hervorgegangen aus sechs Vorlesungen über Identität, die ich, der freundlichen Einladung von Professor David Fromkin vom Pardee Center folgend, zwischen November 2001 und April 2002 an der Universität Boston gehalten habe. Das Zentrum widmet sich der Zukunftsforschung, und als Titel der Vorlesungsreihe wurde «Die Zukunft der Identität» gewählt. Doch mit ein wenig Hilfe von T. S. Eliot konnte ich mich davon überzeugen, dass «Gegenwart und Vergangenheit... beide vielleicht gegenwärtig in der Zukunft [sind]». Als das Buch fertig war, zeigte sich, dass es sowohl von der Rolle der Identität in früheren und gegenwärtigen Zusammenhängen als auch von Prognosen für die Zukunft handelt.
Tatsächlich hatte ich zwei Jahre vor den Bostoner Vorlesungen, im November 1998, an der Universität Oxford unter dem Titel «Vernunft vor Identität» einen öffentlichen Vortrag über die Rolle der Vernunft bei der Wahl der Identität gehalten. Obwohl es bei der «Romanes Lecture», die regelmäßig an der Universität Oxford gehalten wird (den ersten Vortrag hatte 1892 William Gladstone gehalten, den von 1999 hielt Tony Blair), sehr förmlich zugeht und ich, kaum war der letzte Satz gesagt (und ehe noch ein Zuhörer eine Frage stellen konnte), in einer Prozession, an deren Spitze die leitenden Herren der Universität in bunten Gewändern marschierten, aus dem Saal geleitet wurde, erreichten mich hinterher doch noch einige hilfreiche Stellungnahmen, weil der Vortrag in einer kleinen Broschüre veröffentlicht wurde. Ich habe mich beim Verfassen dieses Buches auf den Text der Romanes Lecture und daneben auf die Erkenntnisse gestützt, die ich dank dieser Stellungnahmen gewonnen habe.
Überhaupt habe ich sehr profitiert von Kommentaren und Anregungen, die mir nach einer Reihe anderer öffentlicher Vorträge zugingen, welche ich über verwandte Themen (mit einem gewissen Bezug zum Thema Identität) gehalten habe; ich nenne hier die Annual Lecture vor der Britischen Akademie im Jahr 2000, einen Sondervortrag am Collège de France (auf Einladung von Pierre Bourdieu), die Ishizaka Lectures in Tokio, einen öffentlichen Vortrag in der St. Paul’s Cathedral, die Phya Prichanusat Memorial Lecture am Vajivarudh College in Bangkok, die Dorab Tata Lectures in Bombay und Delhi, die Eric Williams Lecture bei der Zentralbank von Trinidad und Tobago, die Gilbert Murray Lecture bei OXFAM, die Hitchcock Lectures an der Universität von Kalifornien in Berkeley, die Penrose Lecture vor der American Philosophical Society und die B. P. Lecture des Jahres 2005 im British Museum. Hilfreich waren auch die Diskussionen im Anschluss an diverse Vorlesungen, die ich im Laufe der letzten sieben Jahre in verschiedenen Ländern gehalten habe: am Amherst College, an der Chinesischen Universität Hongkong, der Columbia-Universität in New York, der Universität Dhaka, der Hitosubashi-Universität in Tokio, der Koc-Universität in Istanbul, dem Mt. Holyoke College, der New York University, der Universität Pavia, der Pierre Mendès France-Universität in Grenoble, der Rhodes University in Grahamstown, Südafrika, der Ritsumeikan-Universität in Tokio, der Universität Rovira i Virgili in Tarragona, der Universität Santa Clara, der Technischen Universität Lissabon, der Universität Tokio, der Universität Toronto, der Universität von Kalifornien in Santa Cruz und der Universität Villanova, natürlich zusätzlich zur Harvard-Universität. Diese Diskussionen haben mir sehr geholfen, ein besseres Verständnis der betreffenden Probleme zu entwickeln.
Dank für sehr nützliche Kommentare und Anregungen schulde ich Bina Agarwal, George Akerlof, Sabina Alkire, Sudhir Anand, Anthony Appiah, Homi Bhabha, Akeel Bilgrami, Sugata Bose, Lincoln Chen, Martha Chen, Meghnad Desai, Antara Dev Sen, Henry Finder, David From-kin, Sakiko Fukuda-Parr, Francis Fukuyama, Henry Louis Gates Jr., Rounaq Jahan, Asma Jahangir, Devaki Jain, Ayesha Jalal, Ananya Kabir, Pratik Kanjilal, Sunil Khilnani, Alan Kirman, Seiichi Kondo, Sebastiano Maffetone, Jugnu Mohsin, Martha Nussbaum, Kenzaburo Oe, Siddiq Osmani, Robert Putnam, Mozaffar Qizilbash, Richard Parker, Kumar Rana, Ingrid Robeyns, Emma Rothschild, Carol Rovane, Zainab Salbi, Michael Sandel, Indrani Sen, Najam Sethi, Rehman Sobhan, Alfred Stepan, Kotaro Suzumura, Miriam Teschl, Shashi Tharoor und Leon Wieseltier. Mein Verständnis der Vorstellungen Mahatma Gandhis über Identität wurde enorm gefördert durch Diskussionen mit seinem Enkel Gopal Gandhi, der Schriftsteller und gegenwärtig Gouverneur von Westbengalen ist.
Robert Weil und Roby Harrington, meine Lektoren bei Norton, haben mir durch zahlreiche wichtige Anregungen sehr geholfen, und ich habe von Diskussionen mit Lynn Nesbit profitiert. Amy Robbins hat beim Lektorat meines alles andere als sauberen Manuskripts Hervorragendes geleistet, und Tom Mayer hat das Ganze wunderbar koordiniert.
Profitiert habe ich nicht nur von der produktiven akademischen Atmosphäre an der Harvard-Universität, an der ich lehre, sondern auch von den Vorzügen des Trinity College in Cambridge, besonders in den Sommermonaten. Das Centre for History and Economics des King’s College in Cambridge war mir als eine sehr effiziente Basis für Recherchen behilflich, und besonders dankbar bin ich Inga Huld Markan, die sich um die Lösung vieler damit verbundener Probleme gekümmert hat. Ananya Kabirs Forschung über verwandte Themen am dortigen Zentrum war ebenfalls eine große Hilfe für mich. Für exzellente Hilfe beim Recherchieren danke ich David Mericle und Rosie Vaughan. Der Ford Foundation, der Rockefeller Foundation und der Mellon Foundation schulde ich großen Dank für ihre gemeinsame Unterstützung bei der Deckung der materiellen Kosten meiner Forschungsaktivitäten.
Schließlich muss ich auch meinen Dank abstatten für den Gewinn, den ich auf dem World Civilization Forum aus umfassenden Diskussionen mit Teilnehmern aus zahlreichen Ländern gezogen habe; dieses Forum fand, von der japanischen Regierung organisiert, im Juli 2005 in Tokio statt, und ich hatte die Ehre, es zu leiten. Profitiert habe ich auch von den Diskussionen der Tagung, die Globus et Locus im Jahr 2004 unter der Leitung von Piero Bassetti in Turin veranstaltete, und vom Symi Symposium über das verwandte Thema der globalen Demokratie, das unter der Leitung von Georgios Papandreou im Juli 2005 in Heraklion, Kreta, stattfand.
Wenngleich es tragische und verstörende Ereignisse sind, denen das aktuelle öffentliche Interesse und Engagement für Fragen der globalen Gewalt entspringt, so ist es doch gut, dass diese Herausforderungen breite Beachtung finden. Da ich mich mit dem größten Nachdruck dafür einsetze, dass wir verstärkt unsere Stimme im Namen einer globalen Zivilgesellschaft (klar abzugrenzen von militärischen Initiativen und strategischen Aktivitäten von Staaten und Staatenbündnissen) erheben, sehe ich mich durch diese interaktiven Entwicklungen ermutigt. Das, denke ich, macht mich zum Optimisten, aber viel wird davon abhängen, wie wir an die uns gestellte Aufgabe herangehen.
Amartya Sen
Cambridge, Massachusetts
Oktober 2005
1. KAPITEL
Die Gewalt der Illusion
Der afro-amerikanische Schriftsteller Langston Hughes schildert in seiner 1940 erschienenen Autobiographie The Big Sea die unbändige Freude, die ihn ergriff, als er New York hinter sich ließ, um nach Afrika zu reisen. Er warf seine amerikanischen Bücher ins Meer: «Damals glaubte ich, mir eine Million Ziegelsteine vom Herzen zu laden, als ich die Bücher ins Wasser warf.» Er war auf dem Weg in «mein Afrika; Mutterland der schwarzen Völker!» Was er bald erleben würde, war «Afrika! Greifbare, sichtbare Wirklichkeit, kein Buchwissen mehr!»1 Ein Identitätsgefühl kann eine Quelle nicht nur von Stolz und Freude, sondern auch von Kraft und Selbstvertrauen sein. Es überrascht nicht, dass die Idee der Identität so allgemeine Zustimmung erfährt, vom Grundsatz der Nächstenliebe bei den kleinen Leuten bis hin zu den anspruchsvollen Theorien des sozialen Kapitals und der kommunitaristischen Selbstdefinition.
Und dennoch kann Identität auch töten – und zwar hemmungslos töten. Ein starkes – und exklusives – Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann in vielen Fällen mit der Wahrnehmung einer Distanz und Divergenz zu anderen Gruppen einhergehen. Solidarität innerhalb der Gruppe kann Zwietracht zwischen Gruppen verstärken. Es kann passieren, dass wir plötzlich erfahren, dass wir nicht nur Ruander, sondern speziell Hutus sind («wir hassen die Tutsis»), oder dass wir eigentlich nicht nur Jugoslawen sind, sondern genaugenommen Serben («wir können Muslime absolut nicht ausstehen»). Aus meiner Kindheit erinnere ich mich an die Zusammenstöße zwischen Hindus und Muslimen in den 1940 erJahren im Zusammenhang mit der Teilung Indiens, und ich weiß noch, wie schnell sich die Menschen, die sich im Januar noch kaum voneinander unterschieden, in die grausamen Hindus und die bösen Muslime vom Juli verwandelten. Hunderttausende verloren ihr Leben durch Leute, die, angeführt von den Kommandeuren des Gemetzels, andere im Namen ihres «eigenen Volkes» töteten. Gewalt wird dadurch angefacht, dass man leichtgläubigen Leuten, die in die Hände von kundigen Fachleuten des Terrors fallen, ausschließliche und kriegerische Identitäten aufschwatzt.
Das Identitätsgefühl kann unsere Beziehungen zu anderen – seien es Nachbarn, Mitglieder derselben Gemeinschaft, Mitbürger oder Anhänger derselben Religion – beträchtlich stärken und intensivieren. Die Ausrichtung auf eine bestimmte Identität kann unsere Bindungen bereichern und uns dazu bewegen, vieles füreinander zu tun, und sie kann dazu beitragen, uns aus unserer egozentrischen Lebensführung zu befreien. Die neuere Literatur über das «soziale Kapital», das von Robert Putnam und anderen eindrucksvoll erforscht wurde, hat klar zutage gefördert, dass eine mit anderen in derselben sozialen Gemeinschaft geteilte Identität das Leben aller in dieser Gemeinschaft erleichtern kann; ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft wird daher als Ressource betrachtet, genau wie das Kapital.2 Diese Erkenntnis ist wichtig, muss aber ergänzt werden durch die Einsicht, dass ein Identitätsgefühl viele Menschen entschieden ausschließen kann, während es andere freudig einschließt. Die wohlintegrierte Gemeinde, deren Bewohner mit großartiger Unmittelbarkeit und Solidarität instinktiv absolut wunderbare Dinge füreinander vollbringen, kann genau dieselbe Gemeinde sein, in der Zuwanderern, die von außerhalb in die Gegend ziehen, die Fensterscheiben eingeworfen werden. Die Not der Exklusion kann unter Umständen Hand in Hand gehen mit den Wohltaten der Inklusion.
Die im Zusammenhang mit Identitätskonflikten kultivierte Gewalt scheint sich in aller Welt mit zunehmender Beharrlichkeit zu wiederholen.3 Obwohl sich die Machtverhältnisse in Ruanda und im Kongo geändert haben mögen, werden die Angriffe einer Gruppe auf die andere mit Nachdruck fortgesetzt. Eine aggressiv auftretende sudanesisch-islamische Identität hat zusammen mit der Ausbeutung ethnischer Unterschiede dazu geführt, dass hilflose Opfer im Süden dieses erschreckend militarisierten Staates vergewaltigt und ermordet werden. Israel und Palästina leiden nach wie vor an dem Wahn dichotomischer Identitäten, die bereit sind, der anderen Seite abscheulichen Schaden zuzufügen. Al Qaida stützt sich stark auf die Kultivierung und Ausbeutung einer militanten islamischen Identität, die sich speziell gegen Menschen des Westens richtet.
Und immer wieder kommen aus Abu Ghraib und von anderen Orten Berichte, dass amerikanische oder britische Soldaten, die ausgesandt wurden, um für Demokratie und Freiheit zu kämpfen, sich äußerst inhumaner Methoden bedienten, um Gefangene zu «zermürben». Die unbeschränkte Macht über das Leben verdächtiger feindlicher Kombattanten oder mutmaßlicher Übeltäter errichtet eine eindeutige Schranke zwischen Gefangenen und Aufsehern auf der Grundlage tiefsitzender unterschiedlicher Identitäten («sie sind ein anderer Schlag als wir»). Oft genug werden dadurch andere, nicht im gleichen Maße trennende Merkmale der Menschen auf der anderen Seite der Schranke verdrängt, zu denen unter anderem die Tatsache gehört, dass auch sie der Menschheit angehören.
Anerkennung konkurrierender Zugehörigkeiten
Wo ist Abhilfe zu finden, wenn ein auf Identität basierendes Denken zu so brutalen Machenschaften führen kann? Sie kann wohl kaum darin bestehen, die Berufung auf die Identität generell zu unterdrücken. Die Identität kann ja eine Quelle von Reichtum und Freundlichkeit wie auch von Gewalt und Terror sein, und es wäre nicht sinnvoll, die Identität insgesamt als ein Übel zu betrachten. Wir müssen uns vielmehr die Einsicht zunutze machen, dass die Stärke einer kriegerischen Identität durch die Macht konkurrierender Identitäten eingeschränkt werden kann. Diese können natürlich auch die große Gemeinsamkeit einschließen, dass wir alle Menschen sind, aber daneben viele sonstige Identitäten, die jeder gleichzeitig hat. Das führt zu anderen Einteilungen der Menschen und beschränkt die Möglichkeit, eine besonders aggressive Anwendung einer bestimmten Einteilung auszubeuten.
So mag sich ein Hutu-Arbeiter aus Kigali beispielsweise gedrängt fühlen, sich selbst ausschließlich als Hutu zu verstehen, und dazu angestachelt, Tutsis zu töten, und dennoch ist er nicht nur Hutu, sondern auch Einwohner Kigalis, Ruander, Afrikaner, Arbeiter und Mensch. Es gilt nicht nur, die Pluralität unserer Identitäten und ihre vielfältigen Implikationen anzuerkennen; entscheidend ist auch die Einsicht, dass die zwingende Kraft und Bedeutung bestimmter Identitäten mit ihrer unausweichlichen Verschiedenheit eine Sache unserer freien Wahl ist.
So einleuchtend das auch sein mag, muss man doch sehen, dass diese Illusion von den Anhängern geachteter – und wirklich sehr achtbarer – Denkschulen gutgemeinte, aber in ihrer Wirkung verheerende Unterstützung erfährt. Zu den Unterstützern gehören unter anderem engagierte Kommunitaristen, denen zufolge die Gemeinschaftsidentität von vornherein, quasi von Natur aus, unvergleichlich und bestimmend ist, ohne dass es eines menschlichen Willensaktes bedarf (es genügt, um einen sehr beliebten Terminus zu verwenden, die «Anerkennung»), aber auch unbeirrbare Kulturtheoretiker, die die Weltbevölkerung in kleine Kästchen unvereinbarer Kulturen einteilen.
Im normalen Leben verstehen wir uns als Mitglieder einer Vielzahl von Gruppen, denen allen wir angehören. Staatsangehörigkeit, Wohnort, geographische Herkunft, Geschlecht, Klassenzugehörigkeit, politische Ansichten, Beruf, Arbeit, Essgewohnheiten, sportliche Interessen, Musikgeschmack, soziale Engagements usw. – das alles macht uns zu Mitgliedern einer Vielzahl von Gruppen. Jedes dieser Kollektive, denen ein Mensch gleichzeitig angehört, verleiht ihm eine bestimmte Identität. Keine seiner Identitäten darf als seine einzige Identität oder Zugehörigkeitskategorie verstanden werden.
Zwänge und Freiheiten
Viele kommunitaristische Denker neigen zu der Ansicht, eine dominierende gemeinschaftliche Identität sei lediglich eine Sache der Selbsterkenntnis, nicht aber der Wahl. Es fällt jedoch schwer zu glauben, dass ein Mensch wirklich keine Wahl hat, zu entscheiden, welche relative Bedeutung er den verschiedenen Gruppen beimisst, denen er angehört, und dass er seine Identitäten lediglich zu «entdecken» braucht, so als handele es sich um ein rein natürliches Phänomen (wie etwa bei der Feststellung, ob es Tag oder Nacht ist). In Wirklichkeit treffen wir alle – und sei es auch nur stillschweigend – ständig Entscheidungen über die Prioritäten, die wir unseren verschiedenen Zugehörigkeiten und Mitgliedschaften beimessen. Die Freiheit, über unsere Loyalitäten und die Rangfolge der Gruppen, denen wir angehören, selbst zu entscheiden, ist eine besonders wichtige Freiheit, die anzuerkennen, zu schätzen und zu verteidigen wir allen Grund haben.
Aus der Wahlfreiheit folgt natürlich nicht, dass es keine Zwänge gibt, die diese Freiheit einschränken. Eine Wahl wird immer innerhalb der Grenzen dessen getroffen, was wir für machbar halten. Die Machbarkeit wird, was die Identitäten angeht, von den individuellen Merkmalen und Umständen abhängen, welche die uns offenstehenden Möglichkeiten bestimmen. Das ist nun aber keine ungewöhnliche Tatsache. Es gilt für alle Entscheidungen auf allen erdenklichen Gebieten. Nichts könnte elementarer und universaler sein als die Tatsache, dass Entscheidungen immer und überall innerhalb bestimmter Grenzen getroffen werden. Wenn wir beispielsweise entscheiden, was wir auf dem Markt kaufen, können wir uns kaum darüber hinwegsetzen, dass unseren Ausgaben Grenzen gesetzt sind. Der «Budgetzwang», wie die Ökonomen ihn nennen, ist allgegenwärtig. Dass jeder Käufer Entscheidungen treffen muss, heißt nicht, dass es keinen Budgetzwang gibt, sondern nur, dass Entscheidungen innerhalb des jeweiligen Budgetzwangs zu treffen sind.
Was für das elementare Wirtschaften gilt, das gilt auch für komplizierte politische und soziale Entscheidungen. Auch wenn man in den eigenen Augen und in den Augen anderer unausweichlich als Franzose, Jude, Brasilianer, Afro-Amerikaner oder (speziell im Zusammenhang mit den aktuellen Konflikten) als Araber oder Muslim wahrgenommen wird, muss man immer noch entscheiden, welche Bedeutung man dieser Identität im Vergleich zu den anderen Kategorien beimisst, denen man ebenfalls angehört.
Andere überzeugen