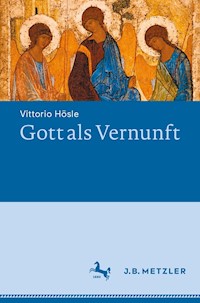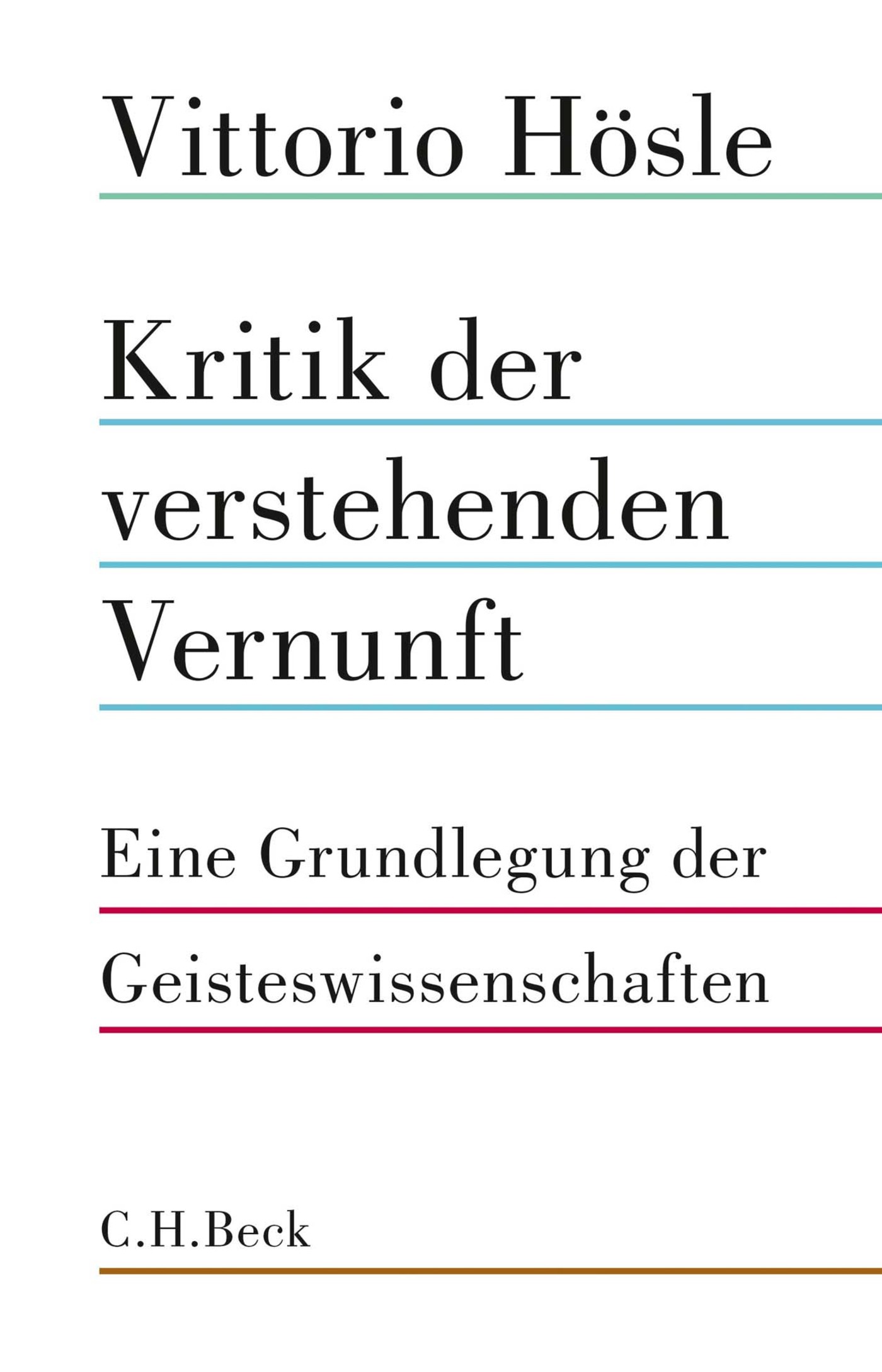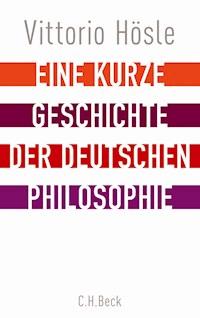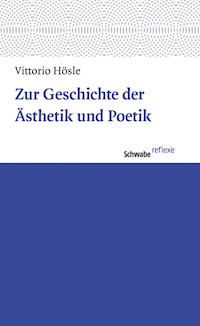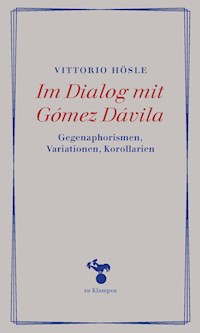
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: zu Klampen
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Erst gegen Ende seines Lebens wurde der kolumbianische Philosoph Nicolás Gómez Dávila durch sein brillantes Aphorismenwerk international bekannt. Seit dieses Werk aber in nahezu alle wichtigen Sprachen übersetzt wurde, fasziniert es weltweit Leserinnen und Leser jeder politischen Couleur. Vittorio Hösle hat sich über viele Jahre mit Gómez Dávilas Denken auseinandergesetzt. Im Zuge seiner intensiven Beschäftigung mit dem provokant anachronistischen Autor Gómez Dávila entstanden die Gegenaphorismen, Variationen, Annotationen, die in diesem Band versammelt sind. Sie begründen zugleich ein neues literarisches Genre. Die Einführung in Rezeption, Leben und Denken Gómez Dávilas, die zumal dessen systematischstes Werk, die »Textos«, philosophie- und ideengeschichtlich einordnet, liefert einen unverzichtbaren Beitrag zum Verständnis des »katholischen Reaktionärs aus den Anden«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
VITTORIO HÖSLE
Im Dialog mit Gómez Dávila
Gegenaphorismen, Variationen, Korollarien
zu Klampen
Inhalt
Vorbemerkung
Einführung
Bibliographie
Zum ersten Band der »Escolios a un texto implicito«
Zum zweiten Band der »Escolios a un texto implicito«
Zum ersten Band der »Nuevos escolios a un texto implicito«
Zum zweiten Band der »Nuevos escolios a un texto implicito«
Zu den »Sucesivos escolios a un texto implicito«
Für Ludwig Steinherr, Lyriker, Aphoristiker, katholischen Hegelianer, in Freundschaft
»Wer ein Buch von Maximen kauft, kauft in Wahrheit zwei Bücher, denn vielleicht gibt es keine Maxime, die, wenn sie so umgewendet wird, daß sie das Gegenteil sagt, nicht eine ebenso evidente, und ebenso grundlose, Wahrheit verkündet.«
Notas 341
Vorbemerkung
2002 weilte ich zu Vorlesungen an der Javeriana, der Universität der Jesuiten, in Bogotá. Einer meiner zwei liebenswürdigen Gastgeber, Professor Dr. Alfonso Florez Florez, der Direktor des Philosophischen Seminars, brachte mich gleich am Abend meiner Ankunft in eine Buchhandlung, die Librería Nacional. In ihr lagen zahlreiche Exemplare der im Oktober 2001 erschienenen einbändigen Auswahlausgabe der »Escolios a un texto implícito« von Nicolás Gómez Dávila aus. Ich hatte diesen Namen erstmals um 1990 gehört, als mir Reinhart Maurer freundlicherweise seine Rezension der »Einsamkeiten« von 1987 zugeschickt hatte, der ersten Auswahl-Übersetzung der Aphorismen des Kolumbianers in irgendeine Fremdsprache. Zwar hatte ich, durch die Besprechung neugierig geworden, den Autor auf meine geistige Liste noch zu lesender Autoren gesetzt, aber, aufgrund anderer Verpflichtungen, doch recht weit unten und ihn weiter nicht verfolgt. Nun aber erinnerte ich mich, packte die Gelegenheit beim Schopf und erwarb mir sofort ein Exemplar. Einige Tage später fuhr mich mein anderer Gastgeber, Professor Dr. Vicente Durán Casas, der Dekan der Fakultät, den ich seit 1991 kannte und der mich eingeladen hatte, um die große Tudor-Villa des Denkers herum, die nach seinem und später seiner Frau Tode im Erdgeschoß nicht mehr bewohnt wurde, 2002 allerdings noch seine einzigartige Bibliothek beherbergte. Durán verdanke ich auch eine Einladung bei Gómez Dávilas Tochter, Rosa Emilia Gómez de Restrepo, die mir in ihrer Wohnung u. a. ein bisher noch unveröffentlichtes, auf Französisch verfaßtes Manuskript ihres Vaters aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges zeigte.
Noch in der ersten Nacht las ich mich in dem erworbenen Buche fest und konnte kaum einschlafen. Es war nicht nur eine leichte Form von Höhenkrankheit, wie sie die meisten Touristen befällt, die in die mehr als in 2600 Meter Höhe gelegene Hauptstadt Kolumbiens reisen; einer Krankheit, zu der Schlafstörungen aufgrund von Hypoxie als verbreitetes Symptom gehören. Es war vielmehr die geistige Höhenluft dieses Buches, von der ich mich nicht losreißen konnte. Die unprätentiöse Brillanz seines Spanischs, die enorme Bildung, der Sinn für zahlreiche fundamentale philosophische Probleme, der feine ästhetische Geschmack, die subtile Religiosität, schließlich der intellektuelle Mut bei den Angriffen gegen die sonst nicht mehr hinterfragten Befindlichkeiten spätmoderner liberaler Demokratien begeisterten mich. Gleichzeitig empörte mich nicht etwa die Selbststilisierung als Reaktionär (denn es gibt Schlimmeres als zurückzuwollen, wenn man den Eindruck hat, die eigene Kultur habe sich in eine Sackgasse verrannt), aber doch der Hohn gegenüber dem Universalismus, der den moralischen Kern der Moderne ausmacht.
Was macht man in einer solchen Konfliktsituation? Ich begann noch in Bogotá, teils Schlußfolgerungen aus Gómez Dávilas Aphorismen niederzuschreiben, teils diese zu variieren und zu verallgemeinern, teils gegen sie explizite Gegenaphorismen zu verfassen. Der deutsche Brauch, Festschriften für verdiente Kollegen zu verfassen, gab mir Gelegenheit, bis 2020 in fünf Beiträgen immer wieder zu den »Escolios« zurückzukehren und an meiner gegenaphoristischen Antwort weiterzuarbeiten.1
Sie liegt nun hier in Gänze vor, begleitet von einer Einleitung, die kurz in Gómez Dávilas Rezeption, sein Leben, seine Bibliothek und sein Werk einführt, allerdings mit Ausnahme der »Escolios«, um die es ja im Hauptteil dieses Buches geht. Ich suche den »impliziten Text« anzudeuten, der in den Scholien vorausgesetzt, aber nicht expliziert wird, um deren Verständnis zu erleichtern, und nenne einige seiner Quellen, die sehr zahlreich sind, aber bisher nur unzureichend erforscht wurden, weil der Autor sie fast nie zitiert. Die Abschnitte über die »Notas« und die »Textos« sind die originellsten Beiträge dieses Buches.
Auch wenn Gómez Dávilas Werk inzwischen ganz auf Deutsch vorliegt, benutze ich als Ausgangspunkt meiner Gegenaphorismen ebenso wie bei den Zitaten in der Einleitung stets meine eigene Übersetzung. Ich danke dem Karolinger-Verlag, der sich um die Verbreitung des Werkes des Kolumbianers große Verdienste erworben hat und dem dieser die Rechte für die Übersetzungen in sämtliche Sprachen übertrug, für die freundliche Erlaubnis, es zu tun. Besonderen Dank schulde ich Rosa Emilia Gómez de Restrepo für die Einladung und Beantwortung meiner Fragen 2002, Juan Fernando Mejía Mosquera für höchst kompetente Auskünfte zu Gómez Dávila zwanzig Jahre später sowie Vicente Durán und Alfonso Florez für die sorgfältige kritische Lektüre dieser Einführung.
1 Die Texte wurden erstmals publiziert als: 1. Variationen, Korollarien und Gegenaphorismen zum ersten Band der »Escolios a un texto implícito« von Nicolás Gómez Dávila, in: Die Ausnahme denken. Festschrift zum 60. Geburtstag von K.-M. Kodalle, hg. von C. Dierksmeier, 2 Bde., Würzburg 2003, II, 149–163 (spanische Übersetzung in: Vittorio Hösle, El tercer mundo como problema filosófico y otros ensayos, Bogotá 2003, 97–111); 2. Variationen, Korollarien und Gegenaphorismen zum zweiten Band der »Escolios a un texto implícito« von Nicolás Gómez Dávila, in: Kritische Theorie zur Zeit. Für Christoph Türcke zum sechzigsten Geburtstag, hg. von O. Decker und T. Grave, Springe 2008, 94–108 (italienische Übersetzung in: Nicolás Gómez Dávila e la crisi dell’Occidente, hg. von F. Meroi und S. Zucal, Pisa 2014, 67–84; spanische Übersetzung in: Eikasia. Revista de Filosofía 77 [Octubre 2017], 124–139 [online]); 3. Variationen, Korollarien und Gegenaphorismen zum ersten Band der »Nuevos escolios a un texto implícito« von Nicolás Gómez Dávila, in: Gott und Denken… Für F. Hermanni zum 60. Geburtstag, hg. von Ch. König und B. Nonnenmacher, Tübingen 2020, 437–455; 4. Variationen, Korollarien und Gegenaphorismen zum zweiten Band der »Nuevos escolios a un texto implícito« von Nicolás Gómez Dávila, in: Christlicher Humanismus. Festschrift für Sigmund Bonk, hg. von S. Biber und V. Neumann, Regensburg 2019, 151–163; 5. Variationen, Korollarien und Gegenaphorismen zu den »Sucesivos escolios a un texto implícito« von Nicolás Gómez Dávila, in: Senex non semper optimus, senectus autem optima. Festschrift zu Ehren des 90. Geburtstags von H. Holz, hg. von M. Woesler, Bochum 2020, 185–210. Der Leser wird erkennen, daß die letzten drei Texte unter Trump geschrieben sind.
Einführung
1. Der Mythos
Einer der Gründe für den erst in seinen letzten Lebensjahren einsetzenden, seitdem kontinuierlich zunehmenden Ruhm Nicolás Gómez Dávilas ist sicher die Tatsache, daß er zu den wenigen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts gehörte, denen dieser gleichgültig war. Und dies, obgleich er ihm erstens gebührte und er zweitens sehr genau wußte, daß er ihm zukam. Aber er war teils zu religiös, teils zu stolz, um eitel zu sein. Warum sollte ihn die Rezeption seines Werkes zu seinen Lebzeiten interessieren, wenn er sich dessen sicher war, daß es ihn überleben würde und, viel wichtiger noch, daß er die ihm von Gott gesetzte Aufgabe erfüllt hatte? Es wäre zwar absurd, seine Abstinenz vom Kulturbetrieb subjektiv als eine besonders listige Weise zu deuten, schließlich doch das Weltinteresse zu wecken. Aber objektiv ist sein Erfolg zweifellos auch mit seiner radikalen Andersheit gegenüber einer Welt inzwischen an globale Standards angepaßter intellektueller Selbstvermarktung zu erklären, die es kaum glauben mag und in Erregung dadurch versetzt wird, daß es noch jemanden gibt, der nicht wie sie funktioniert. Mindestens ebenso wie sein Werk hat die Persönlichkeit Gómez Dávilas, seitdem sie bekannt wurde, das Publikum in Bann geschlagen.
Die Verbürgerlichung, Professionalisierung und Professorisierung der Philosophie mag, wie so vieles am sogenannten Fortschritt, ihre guten Gründe gehabt haben. Und doch wird man den Verdacht nicht los, mit den philosophischen Charakterköpfen aus Antike, Mittelalter und früher Neuzeit sei der Philosophie etwas verlorengegangen, was durch alle Wunder des heutigen Universitäts- und Kongreßbetriebs noch nicht ganz wettgemacht worden ist. Und ein solcher Charakterkopf schien in diesem exotischen, geistesaristokratischen Philosophen aus einem fernen Land in den Anden wiedererstanden zu sein, der nur zweimal sein Heimatland verließ; der Autodidakt war, keinen Studienabschluß vorzuweisen hatte (denn »ein Zahnarztdiplom ist respektabel, ein philosophisches grotesk«, EI 164) und nie an einer Universität unterrichtete; der an einem vorkonziliaren Katholizismus festhielt und für viele Ideen der Moderne nur Verachtung übrig hatte; der einen großen Teil seines Lebens in seiner exquisiten Privatbibliothek, am Ende mit etwa 30.000 Bänden in vielen Sprachen und mit zahlreichen Erstausgaben, verbrachte; der in dieser gewaltigen, aber anders als bei Jorge Luis Borges’ Bibliothek von Babel endlichen und geordneten Bibliothek nach ausgiebigen, fast die ganze europäische Geistesgeschichte erfassenden Lektüren ohne jeden Zeitdruck seine kurzen Texte schrieb, und zwar auf Spanisch, auch wenn seine stilistischen Vorbilder offenkundig Franzosen wie Michel de Montaigne, François de La Rochefoucauld, Nicolas Chamfort oder Antoine de Rivarol waren; der zwei seiner drei Bücher nur als Privatdrucke für Freunde herausbrachte und dessen sehr spätes Erleben der ersten Phase des Ruhms ein Zufall war.
Es ist dagegen schwerlich ein Zufall, daß einer seiner ersten Rezipienten in Deutschland Botho Strauß war, dessen Leiden an der metaphysischen Öde und penetranten Geistlosigkeit der Gegenwart unter allen deutschen Schriftstellern vermutlich am aufrichtigsten und keinesfalls Pose ist. In seinem Nachwort zu Georges Steiners »Von realer Gegenwart« (1991) finden wir nach einer scharfen Polemik gegen eine »Thersites-Kultur (…), für deren Verbreitung die deutsche Intelligenz nach dem Krieg ihr Bestes gab, Zug um Zug häßlicher und liebloser werdend«, den apotropäischen Rückgriff auf den noch weitgehend unbekannten Kolumbianer, aus dessen gerade erstmals auf deutsch erschienenen Aphorismen er ausgiebig zitiert. Er sei »einer der großen spirituellen Reaktionäre«, und das sei gleichbedeutend mit »ein unbeirrter Zeitfremdling, voll scharfsinniger Frommheit«.1 Weiter ging der Katholik Martin Mosebach, der selber nach Kolumbien reiste und dessen persönliche Besuche bei Gómez Dávila gleichsam spätmoderne Äquivalente von Pilgerfahrten ins Heilige Land waren: »Ich war Tausende von Kilometern zu ihm gereist; am ganzen Kontinent Südamerika interessierte mich er allein, und auch in Kolumbien würde für mich nur bedeutsam sein, was mit ihm in Verbindung stand« (2005, S. 7 f.). Der Weise von Bogotá war ihm ein »Einsiedler von der Art der großen Wüstenväter« (S. 10). Diese Aussage ist angesichts seiner Gegenstellung zur gegenwärtigen Kultur auf den ersten Blick verständlich; allerdings hinkt der Vergleich aus zwei Gründen. Erstens waren die Wüstenväter durchaus die Avantgarde ihrer Zeit und hatten die Zukunft der nächsten Jahrhunderte ganz auf ihrer Seite; sie waren alles andere als Reaktionäre. Und zweitens hatten ihre Zellen (um von den Kapitellen der Säulen der Styliten zu schweigen) nicht ganz den Komfort einer Tudor-Villa aufzuweisen.
Auch wenn die Anerkennung der Originalität der schriftstellerischen und philosophischen Leistung Gómez Dávilas in Deutschland begann, war das nur der Anfang seiner internationalen Rezeption. Nicht nur in Kolumbien, auch in Spanien und anderen spanischsprachigen Ländern wird er heute ausgiebig studiert. In Italien erreichte er eine der deutschen vergleichbare Popularität auch außerhalb philosophischer Fachkreise: Der Mittelalter-Historiker Marco Tangheroni etwa ließ sich bei seinem Buch zu der Methodologie der Geschichtswissenschaften
2. Das Leben
Gómez Dávila wurde am 18.5.1913 in Bogotá geboren, wo er am Tag vor seinem einundachtzigsten Geburtstag verstarb. Er entstammte einer einflußreichen und vermögenden kolumbianischen Familie; der Großvater war General, der Vater Unternehmer und Bankier gewesen. Ja, er war Ururenkel Antonio Nariños (1765–1824), der 1794 durch seine Übersetzung der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte die Unabhängigkeit der spanischen Kolonien vorbereitete, Präsident des kurzlebigen unabhängigen Freistaates von Cundinamarca war (mit Bogotá als Hauptstadt) und in der letzten Strophe der heutigen kolumbianischen Nationalhymne als Prediger der Menschenrechte gepriesen wird – also einer Angelegenheit, die seinem Nachkommen weniger am Herzen lag. Am Ort des Hauses, in dem Nariño geboren wurde, steht seit 1908 der Amtssitz des kolumbianischen Präsidenten, die Casa Nariño. Etwa 1920 zog die Familie nach Paris, von wo Nicolás erst 1936 zurückkehrte, später als seine Eltern. Er wurde in einer Benediktinerschule erzogen, für einige Jahre wegen einer Lungenerkrankung von Privatlehrern zu Hause. Er erwarb in dieser Zeit seine bedeutende Kenntnis der beiden antiken und der wichtigsten modernen europäischen Sprachen (außer des Russischen, dafür später auch des Dänischen), u. a. durch regelmäßige Sommeraufenthalte in Großbritannien. Die europäische Literatur und Philosophie las er somit im Original. Die französische Sprache wurde ihm zur zweiten Muttersprache – seine Tochter berichtete mir, selbst gebetet habe er bis zum Ende seines Lebens nicht auf Spanisch, sondern auf Französisch.
Eine katholische Erziehung im Frankreich der 1920er Jahre war unweigerlich vom Renouveau catholique beeinflußt, der schon im 19. Jahrhundert als gegen die Aufklärung und Französische Revolution gerichtete Reaktion einsetzte und seit Ende des 19. Jahrhunderts sich zumal gegen den Positivismus wandte. Ganz in diesem Sinne lesen wir bei Gómez Dávila, das stärkste Argument für das Ancien Régime sei die Französische Revolution (N 113), »die Katastrophe von 1789« (N 198); und ihre größten Erfolge habe die objektivierende wissenschaftliche Psychologie nur als Psychopathologie eingefahren (N 81), denn alles Wesentliche zum Menschen fänden wir schon bei den Griechen und in der Bibel (N 237). Politisch eine sehr heterogene Bewegung (er umfaßte Sozialisten wie Charles Péguy und Faschisten wie Charles Maurras), hatte der Renouveau catholique doch im Affekt gegen die Moderne, die als zu individualistisch und als jahrhundertealten Traditionen gegenüber zerstörerisch empfunden wurde, einen gemeinsamen Nenner. Und doch ist der Renouveau catholique, anders als die Neuscholastik, eine durch und durch moderne Bewegung. François-René de Chateaubriand, einer ihrer ersten Vertreter, war einer der bedeutendsten Romantiker – der Fokus auf die eigenen Empfindungen ist ihm viel wichtiger als die Erarbeitung einer metaphysisch konsistenten Theorie von Gott (vgl. N 123). Bezeichnet sich jemand als »authentischen« Reaktionär, wie Gómez Dávila im Titel eines Aufsatzes, so hat er, ob er es weiß oder nicht, einen zentralen Begriff der Moderne adoptiert.2
In der Tat ist Gómez Dávilas Katholizismus, anders als derjenige der naiven französischen Gegenaufklärer Joseph de Maistre (1753–1821) und Louis-Gabriel-Ambroise de Bonald (1754–1840) oder des großen spanischen Antiliberalen Juan Donoso Cortés (1809–1853), mit dem er oft verglichen wird, alles andere als eine schlichte Form von Traditionalismus, den er als explizite politische Doktrin ablehnte (N 69, 397), auch wenn er betonte, daß Originalität nur innerhalb einer geistigen Tradition gedeihen könne (N 310). Er hat etwa Nietzsche sehr genau und voller Bewunderung gelesen und ist ihm als Psychologe kaum unterlegen.3 Man denke etwa an seinen Aphorismus zu den klebrigen und schmierigen Lastern, die, anders als die theatralischen, von der professoralen Ethik aus Scham ignoriert würden (N 152 f.), oder an seine Bemerkung, jeder könne, wie Prokop über Justinian, neben der offiziellen Historie auch eine geheime Skandalgeschichte über sich selbst verfassen (N 168). Wie Thomas Mann betrachtet er den Geist als eine Krankheit des Lebens (N 357). Ja, auch gegenüber der Kirche wendet er die psychologische Betrachtungsweise an (etwa in der Verspottung der urchristlichen Millenaristen, N 230), gibt ihr aber immer wieder eine überraschende Wendung. So räumt er freimütig ein, nicht wenige der katholischen Heiligen hätten ernste psychische Probleme gehabt, preist aber die Kirche, die diesen Menschen einen Weg wies, wie sie trotzdem Großartiges leisten konnten, statt sie in einem hygienischen Sanatorium wegzusperren (N 247; vgl. 353). Das nimmt Foucault vorweg und übertrifft ihn zugleich. Oder er gibt zu, der Katholizimus sei widersprüchlich und absurd – ganz so wie das Leben (N 348). Das Meßopfer weise auf die Altsteinzeit, und die Offenbarung komme nicht kompakt von außen, sondern ergebe sich nur in langsamen geschichtlichen Prozessen (N 433). Die Schönheit der Figur der Heiligen Jungfrau verdanke sich sowohl den heidnischen Göttinnen, die sie beschwöre oder ersetze, als auch der Art und Weise, wie sie sie transzendiere (N 432).
Man mag Donoso Cortés wegen seines asketischen Lebenswandels vorziehen; nicht nur stilistisch, auch intellektuell kann er Gómez Dávila das Wasser nicht reichen. Mit den modernen anthropologischen Theorien der Genese der Religion ist dieser ebenso vertraut wie mit Sigmund Freud. Er kennt das Labyrinth der menschlichen Seele mit ihren schlafenden Fledermäusen (N 449); und über Sexualität spricht er präzise und ohne katholische Hemmungen. »Jeder Pädagoge ist ein verschämter Päderast.« (N 428) Die großen Scholastiker dagegen mochte er nicht und kannte er kaum. Er bewegte sich viel leichter in der Antike und in der Neuzeit ab dem 16. Jahrhundert als im Mittelalter. Und doch ist die Gómez Dávila eigentümliche Form der Gegenaufklärung keineswegs nihilistisch, wie die seines Zeitgenossen Emil Cioran (1911–1995), oder eine Instrumentalisierung der Religion für politische Zwecke, wie beim agnostischen oder sogar atheistischen katholischen Nationalisten Maurras (1868–1952). Jeder Nationalismus war Gómez Dávila fremd (man denke nur an sein vernichtendes Urteil über die Kolumbianer, N 225), da ihm sein Vaterland die Intelligenz war (N 391), und an seiner Religiosität ist nicht zu rütteln. Das einzige, was er nie bezweifelt habe, sei die Existenz Gottes (N 174), hingegen durchaus die Unsterblichkeit der Seele (N 182).4 Er sei nämlich sinnlich, skeptisch und religiös (N 332 f., 345). Auch vertritt er, wie wir noch sehen werden, einen klaren Wertrealismus. Doch spielen innerhalb seines Wertsystems zentrale moralische Werte nicht nur der Moderne, sondern auch des Katholizismus, wie etwa die Gerechtigkeit, nicht die geringste Rolle. Gómez Dávila ist gegenüber der Tradition anders, aber nicht weniger selektiv als der von ihm gehaßte nachkonziliare Katholizismus.
Kurz nach seiner Rückkehr nach Kolumbien heiratete Gómez Dávila 1937 María Emilia Nieto Ramos, die ebenfalls aus der Oberschicht des Landes stammte und ihm eine Tochter und zwei Söhne gebar. Seine Frau war in Wahrheit schon verheiratet gewesen, aber es gelang ihr, eine kirchliche Annullierung der ersten Ehe zu erhalten. (Man riskiert nicht viel mit der Vermutung, ihr sozialer Status sei auf eine größere Milde der kirchlichen Tribunale gestoßen.) Mit seiner Gattin unternahm Gómez Dávila 1949 eine längere Autoreise durch Europa, das zweite und letzte Mal, das er Kolumbien verließ. Sie überzeugte ihn, daß Europa nur noch von seiner Vergangenheit lebe (N 267). Sein eigenes Leben war das eines sich stets weiterbildenden vermögenden Gentlemans, der das antike Ideal des »otium cum dignitate«, der würdevollen Muße, pflegte. Zwar stimmt es nicht, daß er keine wirtschaftlichen Aktivitäten ausübte – mit Unterbrechungen saß er von 1944 bis 1964 im Aufsichtsrat der von seinem Großvater und seinem Vater eröffneten Bank. Er wirkte beratend mit bei der Gründung der privaten Universidad de los Andes, heute eine der besten Lateinamerikas. Auch war er gelegentlich in staatlichen Kommissionen tätig. Anscheinend lehnte er Angebote der Ernennung zum Berater des Präsidenten und zum Botschafter ab, angeblich sogar den Vorschlag, selber als Staatspräsident zu kandidieren.5 Doch vermutlich geht die letztere Anekdote auf die Tatsache zurück, daß dieser Antrag 1958, vergeblich, seinem Halbbruder Hernando Gómez Tanco gemacht wurde. Einsam war er keinesfalls. Nicht nur war er Familienmensch mit zahlreicher Dienerschaft, er hatte einen weiten Freundeskreis, in dem er »Don Colacho« genannt wurde und mit dem er sich regelmäßig zu tertulias traf, war ein im Jockey-Club aktiver Herrenreiter, der aufgrund eines Reitunfalls hinkte, und verbrachte gerne Zeit in seiner Hacienda in Soacha unweit von Bogotá. Kurz, er führte eine Existenz, wie sie die reiche Oberschicht des Bürgertums auch in Europa bis zum Ersten Weltkrieg liebte und nach der heutige Intellektuelle eher Nostalgie zu empfinden scheinen als nach derjenigen der Wüstenväter.
3. Die Bibliothek
Aber das, was ihn von seinen Standesgenossen unterschied, die er als Klasse verachtete (kaum ein Marxist hat sich so vernichtend über die Bourgeosie geäußert), war nicht so sehr der Besitz seiner außerordentlichen Bibliothek (denn diese kann auch ein Ersatz für Denken sein, N 166, und Bücher wissen, daß man sie nicht einfach kaufen kann, N 419) als vielmehr die höchst intensive Aneignung ihrer geistigen Schätze. Und doch ist zuzugeben, daß der Reiz der Existenz dieses Mannes nicht einfach in der Präsenz großer Teile der Tradition des Abendlandes in seinem Geiste bestand, sondern durchaus auch in der physischen Gegenwart dieser Ideen in physisch anziehenden, oft auch bibliophil wertvollen Ausgaben. Die Bibliothek war sein Lebensraum – als er erkrankte und nicht mehr die Treppe benutzen konnte, wurde sein Bett in das Erdgeschoß in die Bibliothek gebracht, wo er zwischen seinen Büchern starb.6 Zwar konnte ich 2002 die für das Publikum unzugängliche Bibliothek nicht betreten, aber seine Tochter gab mir den Katalog zur Durchsicht, bei dem mir das Wasser im Munde zusammenlief. Da sich angesichts ihres hohen Preises noch kein Käufer gefunden hatte und da ich an einer der vermögendsten Privatuniversitäten der USA, der katholischen University of Notre Dame in Indiana, unterrichte, schlug ich sofort nach meiner Rückkehr meiner Universitäts-Bibliothek vor, einen Kauf zu prüfen. Das Interesse war da, aber als ich meine jesuitischen Freunde in Kolumbien davon informierte, war die Reaktion ein Tadel: Sei dies mein Dank für die Gastfreundschaft des Landes, daß ich versuchte, einen derartigen kulturellen Schatz aus dem Lande zu schaffen? Beschämt mußte ich ihnen recht geben und verfolgte die Angelegenheit nicht weiter. Es dauerte allerdings noch neun Jahre, bis der Großteil der Bibliothek in der Biblioteca Luis Ángel Arango in Bogotá als Fondo Nicolás Gómez Dávila aufgestellt werden konnte, einer der bedeutendsten öffentlichen Bibliotheken Lateinamerikas, die der kolumbianischen Zentralbank gehört. Sie ist nach deren ehemaligem Direktor benannt, der ein starker Befürworter öffentlicher Bibliotheken gewesen war. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob Gómez Dávila über die derzeitige Aufstellung seiner Bibliothek glücklich wäre (vielleicht hätte er Notre Dame vorgezogen), aber ich hege keinen Zweifel daran, daß dies der moralisch richtige Ort für sie ist – auch wenn ich mich beim Verfassen meiner Gegenaphorismen manchmal bei dem Gedanken erwischte, es wäre angenehm, jene mythische Bibliothek in Laufnähe zu haben.7 Selbst das Pflichtbewußtsein tilgt Neigungen nicht.
Der Fondo Nicolás Gómez Dávila besteht aus 27.582 Bänden, aber nur 16.935 Titeln, weil viele Werke mehrbändig sind. Deren große Mehrzahl, 7106, ist auf Französisch, es folgen englische (4937) und deutsche Titel (2816). Nur 718 sind auf Spanisch, 69 auf Portugiesisch, das vom Italienischen, Lateinischen und Griechischen übertroffen wird. (Nur die Griechen, zumal Homer, könnten von der Vulgarität und Barbarei der Moderne befreien, lesen wir N 210 und 263.) Ein besonderes Interesse an Lateinamerika hatte der Sammler offenbar nicht; in der Tat fehlt in seiner Bibliothek sogar das berühmteste Buch der kolumbianischen Literatur, die »Cien años de soledad« (»Hundert Jahre Einsamkeit«) seines Zeitgenossen, des Nobelpreisträgers Gabriel García Márquez. Dafür enthält sie drei Inkunabeln und zahlreiche Klassikerausgaben des 16. und 17. Jahrhunderts, 390 Bände der griechischen und lateinischen »Patrologia« Mignes, aber durchaus auch viele moderne Autoren, wie Schopenhauer, Marx, Engels, Nietzsche, Heidegger, Bertolt Brecht oder James Joyce. Auffallend ist, daß die Bücher ohne Marginalien sind; auch Exzerpte aus ihnen sind nicht bekannt. Die Lektüren verwandelten sich offenbar direkt in das eigene Werk. Das hat die für den Philologen unerfreuliche Konsequenz, daß wir nicht genau wissen, was Gómez Dávila wirklich gelesen hat; denn angesichts der Größe der Bibliothek läßt sich nicht aus dem bloßen Besitz eines Buches auf dessen gründliches Studium schließen, und weitere Indizien fehlen in der Regel. Immerhin teilt uns der Katalog der Biblioteca Luis Ángel Arango mit, ob ein Werk aus dem Fondo Nicolás Gómez Dávila stammt. Das ist immerhin eine erste Spur.