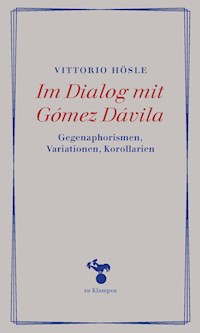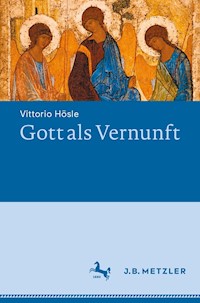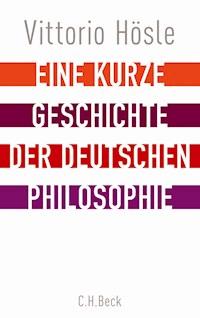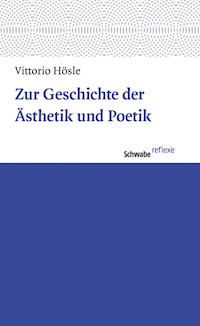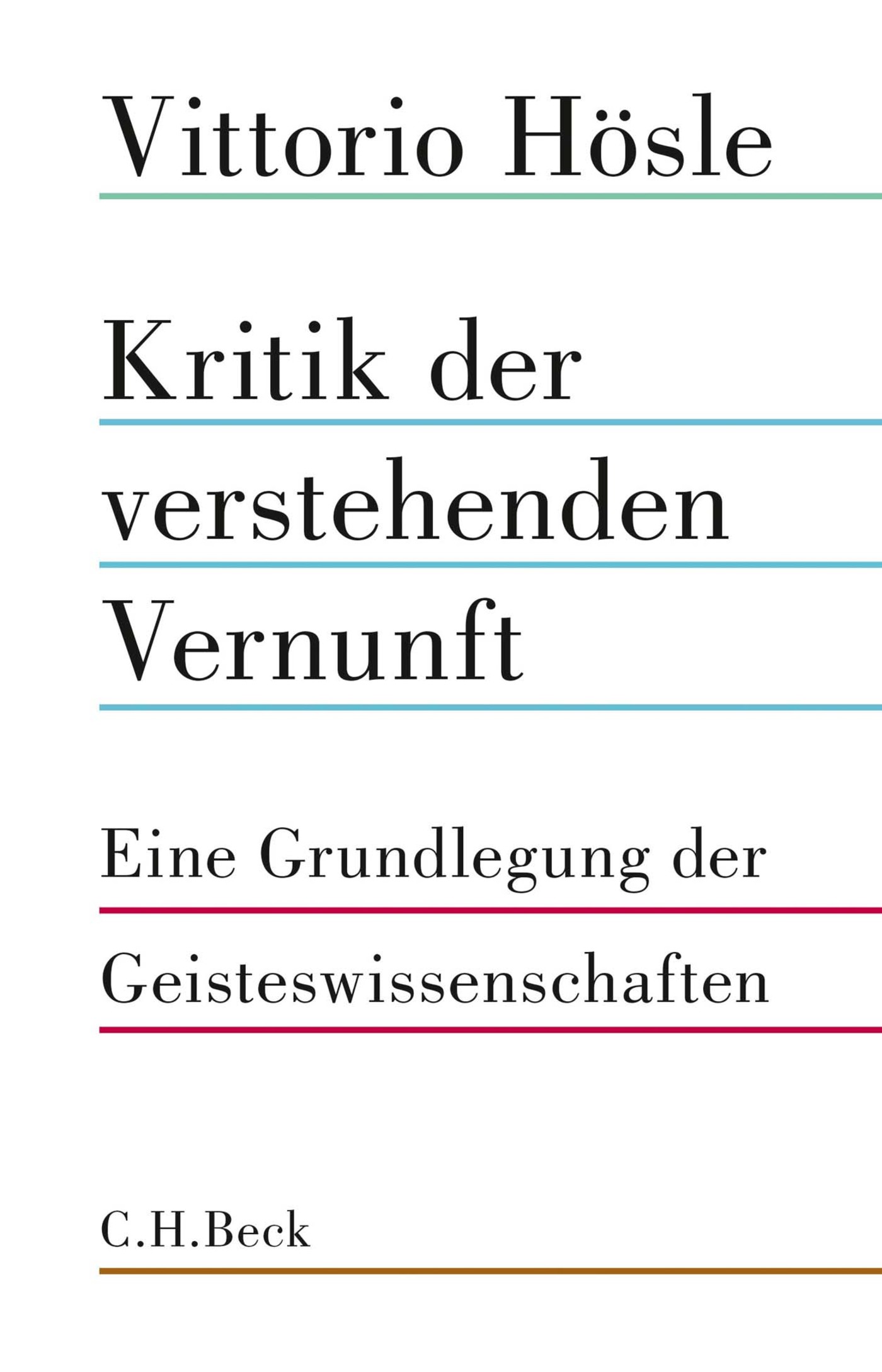
28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Beliebigkeit, die für die Geisteswissenschaften zu Anfang des 21. Jahrhunderts kennzeichnend ist, hat viele Ursachen. Eine zentrale ist das Fehlen von Klarheit hinsichtlich grundlegender Begriffe, Methoden und Aufgaben dieser Wissenschaften. Die Beseitigung dieses Mankos unternimmt Vittorio Hösle mit seinem neuen großen Buch. Insbesondere geht es ihm darum, die Möglichkeit intersubjektiv gültigen Verstehens aufzuzeigen. Denn das Bestreiten dieser Möglichkeit, wie es postmodern gang und gäbe geworden ist, gefährdet die Geisteswissenschaften bis ins Fundament. Hösles Ausführungen setzen mit der Erkenntnis ein, dass zwischen dem Verstehen von Aussagen in der eigenen Muttersprache und den akrobatischen Interpretationsleistungen, die etwa der Entzifferer einer verschollenen Schrift vollbringt, zwischen Lebenswelt und Geisteswissenschaft also, eine erstaunliche Kontinuität waltet. Dabei geht er davon aus, dass die Hermeneutik eine Unterdisziplin der Erkenntnistheorie und daher normativ ausgerichtet ist – es geht in ihr darum, richtiges Verstehen von Missverstehen zu unterscheiden. Denn man kann nicht nur anders, man kann auch besser oder schlechter verstehen, ja, auch etwas völlig missverstehen. Doch Hösles Buch bietet nicht nur eine ausführliche, von Kant inspirierte Analytik und Systematik der komplexen Akte des Verstehens unter Berücksichtigung etwa auch der Jurisprudenz und der Theologie. Ebenso unterzieht es einseitige hermeneutische Theorien der Kritik, darunter auch Freuds Psychoanalyse. Ein abschließender Teil bietet eine kurze Geschichte der Hermeneutik von der Antike bis Gadamer und Davidson mit einem Ausblick auf die Geisteswissenschaften der Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Vittorio Hösle
Kritik derverstehenden Vernunft
Eine Grundlegung derGeisteswissenschaften
C.H.Beck
Epiphanie
Du blätterst die Seitendes Lichts umund plötzlich entdeckst duzum ersten Mal:du hast das meiste überblättert –
jede Seite besteht aus zahllosenviel dünneren Seitendu spitzt deinen Atemschärfst die Fingernägel zu Katzenkrallenum ihr Geheimnis zu öffnen –
unendlich feine Seitenfächern sich aufund wiederumunendlich feinere Seiten –
dünner als Blattgolddünner als die Luftzwischen Liebendendünner als ein sengender Blick –
immer weitere öffnen sichunter jedem Hauch
kein Mensch kann sie lesen
nicht einmal die Ewigkeitwäre lang genug –
doch du blätterstund blätterst
in gleißenderEuphorie
Ludwig Steinherr
Zum Buch
«Man kann nicht nur anders, man auch besser und schlechter verstehen, ja, auch etwas völlig mißverstehen.»
Die Beliebigkeit, die die Geisteswissenschaften zu Anfang des 21. Jahrhunderts kennzeichnet, hat viele Ursachen. Eine zentrale ist das Fehlen von Klarheit hinsichtlich grundlegender Begriffe, Methoden und Aufgaben dieser Wissenschaften. Die Beseitigung dieses Mankos unternimmt Vittorio Hösle in diesem wegweisenden Buch. Insbesondere geht es ihm darum, die Möglichkeit intersubjektiv gültigen Verstehens aufzuzeigen. Doch Hösles von Kant inspiriertes Werk bietet nicht nur eine ausführliche Analytik und Systematik der komplexen Akte des Verstehens unter Berücksichtigung etwa auch der Jurisprudenz und der Theologie. Ebenso unterzieht es einseitige hermeneutische Theorien der Kritik, darunter auch Freuds Psychoanalyse. Ein dritter und abschließender Teil schließlich liefert eine kurze Geschichte der Hermeneutik, von der Antike bis Gadamer und Davidson, mit einem Ausblick auf die Geisteswissenschaften der Zukunft.
Über den Autor
Vittorio Hösle ist Paul Kimball Professor of Arts and Letters an der University of Notre Dame (USA). Bei C. H.Beck liegen u.a. von ihm vor: Moral und Politik. Grundlagen einer politischen Ethik für das 21. Jahrhundert (1997); Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie (31997); Das Café der toten Philosophen. Ein philosophischer Briefwechsel für Kinder und Erwachsene (zus. mit Nora K., 32004), Der philosophische Dialog (2006), Eine kurze Geschichte der deutschen Philosophie (2013).
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Analytik des Verstehens
1.1. Formale Kennzeichen des Verstehens
1.1.1. Einleitende Begriffsklärungen: Verstehen, Auslegen, Deuten, Interpretieren, Hermeneutik, Geisteswissenschaften
1.1.2. Universalität des Verstehens?
1.1.3. Die besondere Schwierigkeit, Verstehen zu erklären. Der Behaviorismus als Kurzschlußreaktion. Eine Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit des Verstehens als Ausweg aus dem Zirkel
1.2. Gegenstände und Akte des Verstehens
1.2.1. Die Stufenordnung des Mentalen
1.2.1.1. Eigenschaften des Mentalen. Das Problem des Unbewußten
1.2.1.2. Formen der Intentionalität
1.2.1.3. Formen der Rationalität
1.2.2. Ausdrucksformen des Mentalen
1.2.2.1. Der Ausdruck von Affekten und Emotionen
1.2.2.2. Die Handlung als Ausdruck von Mentalem
1.2.2.3. Das Werk als Ausdruck von Mentalem
1.2.2.4. Die sprachliche Äußerung als Ausdruck propositionaler Einstellungen
1.2.2.4.1. Sprache als nicht-natürliches Zeichensystem
1.2.2.4.2. Der Weg von Signalen zu einem nicht-natürlichen Zeichensystem
1.2.2.4.3. Sprache als willkürliches Zeichensystem
1.2.2.4.4. Die Funktionen der Sprache und die Natur von Sprechakten
1.2.2.4.5. Die Abweichungen der menschlichen Sprache von dem Ideal einer logischen Kunstsprache: Nicht-verbale Kommunikation; indirekte Mitteilung; die poetische Funktion der Sprache
1.2.3. Verstehen der Ausdrucksformen des Mentalen
1.2.3.1. Formen des Verstehens: Perzeptuelles, noetisches und noematisches Verstehen
1.2.3.1.1. Zum perzeptuellen Verstehen. Prinzipien der Textkritik. Perzeptuelles Verstehen und ästhetischer Genuß
1.2.3.1.2. Zum noetischen Verstehen. Theoretisches, widerhallendes und sympathetisches Verstehen. Internes und externes noetisches Verstehen
1.2.3.1.3. Zum noematischen Verstehen. Explizites und impliziertes Noema. Jemanden besser verstehen, als er sich selbst versteht. Produktive Mißverständnisse
1.2.3.2. Direktes und erschließendes Verstehen. Verstehen und Erklären
1.2.3.3. Verstehen der vier Ausdrucksformen des Mentalen
1.2.3.3.1. Verstehen des Ausdrucks von Affekten
1.2.3.3.2. Handlungsverstehen
1.2.3.3.3. Werkverstehen
1.2.3.3.4. Sprachverstehen
1.2.3.4. Wann muß Verstehen sich an der Autorintention orientieren, wann darf oder muß es sie überschreiten?
1.2.3.4.1. Beispiele legitimen und illegitimen Überschreitens der Autorintention
1.2.3.4.2. Das besondere Problem des Auslegens von mehreren Autoren verfaßter, zumal autoritativer Texte
1.2.3.4.2.1. Jurisprudenz
1.2.3.4.2.2. Theologie
1.2.3.5. Die Verflechtung der Geisteswissenschaften mit den anderen Wissenschaften
1.2.3.6. Deuten der Wirklichkeit und der Geistesgeschichte
1.3. Bedingungen der Möglichkeit des Verstehens. Transzendentalphilosophie und objektiver Idealismus
1.3.1. Transzendentale Ästhetik der Hermeneutik: Was wahrgenommen werden muß, damit Verstehen möglich ist
1.3.2. Transzendentale Logik der Hermeneutik: Unterstellung von Rationalität
1.3.3. Transzendentale Pragmatik der Hermeneutik: Unterstellung von Rationalität zweiter Ordnung und Kooperationswille
2. Dialektik des Verstehens
2.1. Behavioristische Hermeneutik. Die Fokussierung auf das Verhalten bei Quine
2.2. Noetische Hermeneutik. Die Fokussierung auf das Erleben bei Dilthey
2.2.1. Die Ursachen des mentalen Lebens. Quellen und die Absicht zu wirken
2.2.2. Die unbewußten Ursachen: Freuds psychoanalytische Hermeneutik
2.2.3. Die Wirkungen des mentalen Lebens. Gadamers Projekt
2.3. Noematische Hermeneutik
2.3.1. Legitimer und illegitimer Anachronismusvorwurf
2.3.2. Leo Strauss’ Verfolgungshermeneutik
2.3.3. Werk ohne Subjekt
3. Eine kurze Geschichte der Hermeneutik
3.1. Antike und Mittelalter: Wahrheit statt Sinn
3.1.1. Warum es in der klassischen Antike keine philosophische Hermeneutik gibt
3.1.2. Interpretation autoritativer Texte, zumal der Bibel
3.1.3. Augustinus’ Synthese von Zeichenphilosophie und Bibelhermeneutik
3.1.4. Mittelalterliche Innovationen
3.2. Das Verstehen von Sinn unabhängig von seiner Wahrheit
3.2.1. Spinozas Revolution der biblischen Hermeneutik
3.2.2. Die Herausforderung des Historismus
3.2.2.1. Von Vico zu Schleiermacher
3.2.2.2. Die Selbstaufhebung des Historismus bei Dilthey
3.3. Die Wiedergewinnung der Wahrheitsdimension der Hermeneutik bei Gadamer und Davidson
3.4. Die Geisteswissenschaften der Zukunft
Anhang
Bibliographie
Personenregister
Für Johannes Hösle (1929–2017), den weisen Menschen, ersten Lehrer und idealen Vater, in nie nachlassender Dankbarkeit und Liebe
Vorwort
Als Kant sein großes Unternehmen einer kritischen Prüfung der Ansprüche auf Wissen begann, die in seiner Zeit bestanden, behandelte er, neben der Ethik und Teilen der Ästhetik, die Naturwissenschaften und in bescheidenen Ansätzen die Psychologie; an eine Grundlegung der Geisteswissenschaften dachte er nicht. Das hatte zwei Gründe: Einerseits hat die nachcartesische Philosophie den Gegensatz zwischen res extensa und res cogitans, physischem und mentalem Sein, zu ihrem Ausgangspunkt genommen, und es ist nicht leicht, in dieses Schema die Geisteswissenschaften zu klemmen. Andererseits standen die Geisteswissenschaften zur Zeit Kants noch relativ am Anfang ihrer Entwicklung, die er kaum zur Kenntnis nahm. Das 19. Jahrhundert freilich hat einen beispiellosen Aufstieg der Geisteswissenschaften erlebt, und auch wenn das Desiderat, die von Kant gelassene Lücke zu füllen, durchaus gespürt wurde – Wilhelm Dilthey erwog schon für die «Einleitung in die Geisteswissenschaften» den Titel einer «Kritik der historischen Vernunft» (1883; V, 145) –, hat doch niemand es befriedigt. Das Chaos, in dem die Geisteswissenschaften sich nun, zu Anfang des 21. Jahrhunderts, tummeln, hat viele Ursachen; aber eine wichtige ist zweifelsohne das Fehlen von Klarheit hinsichtlich grundlegender Begriffe, Methoden und Aufgaben dieser Wissenschaften. Man kann damit leben, daß sich die Geisteswissenschaften inzwischen weitgehend als wertfreie Disziplinen ausgeben; denn in der Tat haben, wie wir noch sehen werden, die Geisteswissenschaften keine besondere Kompetenz hinsichtlich der Erkenntnis moralischer Werte und Normen. Was die Geisteswissenschaften bis ins Mark gefährdet, ist dagegen das Bestreiten der Möglichkeit intersubjektiv gültigen Verstehens.
Verstehen erfolgt auf verschiedenen Ebenen; doch es ist eine der Thesen dieses Buches, daß zwischen dem Verstehen von Aussagen in der eigenen Muttersprache und den akrobatischen Interpretationsleistungen, die etwa der Entzifferer einer verschollenen Schrift und der Deuter eines hermetischen Gedichtes vollbringen, zwischen Lebenswelt und Geisteswissenschaft also, eine erstaunliche Kontinuität waltet. Ihre Tätigkeiten unterliegen den gleichen Prinzipien, wenn auch ihre Anwendung auf sehr unterschiedlichen Komplexitätsniveaus erfolgt. Da man das Einfache leichter als das Zusammengesetzte begreift, will ich mit den einfachsten Formen des Verstehens beginnen statt mit einer so komplexen wie dem Kunstverstehen. Daß Hans-Georg Gadamer seine philosophische Hermeneutik in «Wahrheit und Methode» bei letzterem hat einsetzen lassen, erklärt zum Teil die Skepsis hinsichtlich der Normen des Verstehens, zu der er gelangt ist. Anders als er gehe ich davon aus, daß die Hermeneutik eine Unterdisziplin der Erkenntnistheorie und daher normativ ausgerichtet ist – es geht in ihr darum, richtiges Verstehen von Mißverstehen zu unterscheiden. Denn man kann nicht nur anders, man kann auch besser und schlechter verstehen, ja, auch etwas völlig mißverstehen. Das gilt für geisteswissenschaftliche Theorien nicht minder als für lebensweltliche Interaktionen, und man tut den Geisteswissenschaften einen Bärendienst, wenn man dies bestreitet – man beraubt sie nämlich ihrer Wissenschaftlichkeit, die daran hängt, daß man ein externes Ziel, die Wahrheit, treffen oder verfehlen kann.
Meine Ausrichtung an der normativen Frage, der quaestio juris, erklärt, warum ich, soweit nur eben möglich, dem natürlich unerreichbaren Vorbild Kants folge, zumal seiner Einteilung in einen konstruktiven und in einen auf den ersten gegründeten destruktiven Teil, die auch ich hier «Analytik» und «Dialektik» nenne. Der bei weitem wichtigste und längste Teil des Buches ist die konstruktive Analytik. Wie Kant gehe ich davon aus, daß Verstehen nur möglich ist, weil es von bestimmten synthetisch-apriorischen Prinzipien geleitet wird; diese wenigstens anzudeuten, ist eines der Ziele meines Buches. Da mein Gegenstandsbereich ein anderer als der seine ist, werden die konkreten Prinzipien, die ich entwickle, über die Kantischen hinausgehen; jeder Kenner wird rasch sehen, wieviel ich William James’ Grundlegung einer wissenschaftlichen Psychologie und zumal Husserls epochemachender Analyse intentionaler Einstellungen verdanke, wieviel ich John Searles Theorie der Sprechakte entnommen habe, wie stark ich von Paul Grice’ und Donald Davidsons innovativer Anwendung transzendentaler Prinzipien auf die Lehre des Verstehens beeinflußt bin und wie sehr mich Oliver Scholz’ bedeutende hermeneutische Studien inspiriert haben. Anders als Ludwig Wittgenstein haben diese Denker keine Scheu gehabt, die Grundlegung der Sprachphilosophie in einer Theorie subjektiver Intentionen zu suchen. Allerdings lehne ich Kants subjektivistische Engführung der transzendentalen Fragestellung ab, die im Fall der Hermeneutik noch gefährlicher ist als im Fall der Erkenntnis der Natur. Was meinen zweiten Teil mit Kants «Transzendentaler Dialektik» verbindet, ist die Überzeugung, daß es, wenn nicht notwendige, so doch höchst naheliegende Fehler der Vernunft gibt – hier freilich geht es nicht um Irrtümer der metaphysisch konstruierenden, sondern der verstehenden, zumal in den Geisteswissenschaften sich manifestierenden Vernunft. Diese Irrtümer ergeben sich aus reduktionistischen Verabsolutierungen einzelner der zahlreichen Momente, die bei einem gelungenen Verstehen mitwirken.
Gadamers wirkungsgeschichtliche Lösung des normativen Problems des Verstehens ist ein solcher Reduktionismus und als solcher unhaltbar. Aber das bedeutet keineswegs zu bestreiten, daß es genetische Voraussetzungen des Verstehens gibt, sofern man sie nur säuberlich von den geltungstheoretischen unterscheidet. Die Geschichte der Hermeneutik teleologisch einzuholen ist Ziel meines mit dem zweiten Teil von Gadamers Hauptwerk konkurrierenden, allerdings viel kürzeren dritten Teils, der der Methodenlehre der teleologischen Urteilskraft in Kants dritter Kritik entspricht und die eigentliche, objektiv-idealistische Pointe meiner hermeneutischen Theorie deutlich macht: Es geht darum, die erkennende Annäherung an die normativen Prinzipien, die selbst ungeschichtlich sind, im Rahmen der Geistesgeschichte derart zu begreifen, daß zugleich jene Prinzipien selbst zur Anwendung kommen. Die hermeneutischen Prinzipien somit sowohl zur Norm als auch zum Gegenstand des eigenen Verstehens zu machen ist als methodischer Kunstgriff aus der Hegelschen Geistphilosophie vertraut. Freilich hat Hegel selber keine ausgearbeitete Hermeneutik vorgelegt, während jedem Kenner klar sein wird, wieviel meine konkreten Unterscheidungen Friedrich Schleiermachers «Hermeneutik und Kritik» verdanken. Trotz aller Kritik an Diltheys andersgeartetem Reduktionismus und seinem Historismus ist ferner offenkundig, wieviel ich auch ihm verdanke – nicht nur, aber zumal in der ersten Untergliederung des umfangreichsten Teiles dieses Buches, Kap. 1.2.
Was die Genese meines eigenen Versuchs betrifft, so empfinde ich dieses Buch in vielerlei Hinsicht als eine Einholung von noch nicht ausreichend geklärten Präsuppositionen mehrerer meiner früheren Werke. Interpretationen konkreter philosophischer und literarischer Werke, darunter solcher wie derjenigen Vicos und Hegels, denen wir Entscheidendes zur Grundlegung der Geisteswissenschaften verdanken, haben mich seit langem beschäftigt; und in «Der philosophische Dialog» (2006a) sind einige meiner erkenntnisleitenden hermeneutischen Prinzipien explizit zum Ausdruck gekommen. Aber mein frühes Interesse an der metaphysischen Struktur der Philosophiegeschichte und an der Ontologie der sozialen Welt hatte die erkenntnistheoretische Analyse der Operation des Verstehens mehr oder weniger abgedrängt, die ich hier nachholen möchte. Wichtige Vorarbeiten sind mein Vergleich von Davidson und Gadamer (2004a), meine Typologie von Reduktionismen in der Hermeneutik (2012a), der Artikel «Hermeneutics» für die «Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics» (2012b) sowie mein Brückenschlag zwischen Schleiermacher und Grice (2018a) gewesen.
Daß ich dabei unweigerlich auch Teilgebiete der Philosophie der Psychologie und der Sprachphilosophie berühre, ohne die die Hermeneutik nicht begründet werden kann, mag das Buch auch Lesern nützlich werden lassen, die nicht primär an Interpretation interessiert sind. Dieses Werk ist ein zentraler Bestandteil des objektiven Idealismus der Intersubjektivität, an dem ich seit Jahrzehnten arbeite; denn ohne Verstehen gibt es keine Intersubjektivität. Allerdings gibt es ohne eine starke Theorie der Subjektivität auch keine Theorie der Intersubjektivität, was ich u.a. dank eines langen Briefwechsels mit Manfred Wetzel, dem Autor von «Prinzip Subjektivität», inzwischen deutlicher begriffen habe als früher. Methodisch wird man in diesem Buche den Einfluß einiger der besten analytischen Philosophen spüren, auch wenn mein Thema ein klassisch kontinentales ist. Mir scheint der unsinnige Gegensatz von «analytisch» und «kontinental» den einzig interessanten zu verdecken, den zwischen guter und schlechter Philosophie. Die ideale Philosophie ist sowohl durch Präzision als auch durch einen Sinn für den Ort eines Einzelproblems im Ganzen des Denkens und durch Vertrautheit mit der Ideenfülle der großen Denker der Vergangenheit gekennzeichnet. Zudem muß eine philosophische Regionaldisziplin mit den Ergebnissen der entsprechenden Einzelwissenschaften vertraut sein. Der ständige Brückenschlag zwischen spezifisch philosophischen Fragestellungen und geisteswissenschaftlichen Problemen und Resultaten mag zur Schwierigkeit dieses Buches beitragen, dessen Lektüre gewisse Kenntnisse sowohl in der Philosophie als auch in den Geisteswissenschaften voraussetzt. Aber vielleicht ist der Lohn dieser Schwierigkeit eine größere Fruchtbarkeit meiner Theorie, wenn man sie kontrastiert mit abstrakten philosophischen Theorien des Verstehens einerseits, die nicht gesättigt sind durch konkrete hermeneutische Erfahrungen, und konkreter interpretatorischer Arbeit, die jede Methodenreflexion verweigert, andererseits.
Mit Dankbarkeit erwähne ich hier meinen Vater Johannes Hösle und meinen Onkel Mario Geymonat, die mir früh Interpretationsmethoden beibrachten, meine Regensburger Lehrer Imre Tóth und Franz von Kutschera, meine Tübinger Lehrer Dieter Wandschneider, Paul Thieme, der auch als Methodologe erstrangig war, Konrad Gaiser und Hans Krämer, der nicht nur als Interpret höchst Innovatives vollbracht hat, sondern mich schon als Studenten auf die Unhaltbarkeiten in Gadamers Hermeneutik hinwies, und meine germanistischen Freunde in Notre Dame Mark Roche und Carsten Dutt sowie in Bamberg Friedhelm Marx, mit denen ich manche Themen dieses Buches erstmals besprach. Meinen philosophischen Freunden und Kollegen Jens Halfwassen und Anton Koch danke ich für die Einladung nach Heidelberg, wo ich im Sommersemester 2015 den ersten Teil dieses Buches in einer Vorlesung einer interessierten und kritisch fragenden Hörerschaft von Studenten vortrug. Der dritte Teil geht auf ein Seminar an der University of Notre Dame zurück. Bei einer Diskussion der Grundthesen dieses Buches mit Kollegen und Studenten profitierte ich besonders von den kritischen Fragen und Anregungen von Gustav Melichar, Christoph Poetsch, Felix Rohls, Andreas und Christian Spahn, Fernando Suarez Müller sowie Changjiang Xing.
Dutt war Gadamers wichtigster Gesprächspartner in seinem letzten Lebensjahrzehnt, und es ist ein untrügliches Zeichen von Gadamers echter philosophischer Natur, daß er Menschen förderte, von denen er wußte, daß sie nicht mit ihm übereinstimmten, deren philosophische Berufung er aber spürte. Auch ich habe Gadamers geistige und menschliche Großzügigkeit genießen dürfen, und wenn meine Kritik an ihm in diesem Buch mir nicht schwergefallen ist, so nur, weil ich weiß, daß er an einem sachorientierten, und d.h. unvermeidlicherweise stets auch kritischen, Gespräch über seine Theorie wahrhaft interessiert war.
1.Analytik des Verstehens
Wie ist richtiges Verstehen möglich? Offenkundig kann diese Frage nur beantwortet werden, wenn wir einerseits wenigstens einen vorläufigen Begriff von Verstehen und andererseits einen Überblick über die Fülle an zu verstehenden Gegenständen gewinnen. Ziel der «Analytik», des konstruktiven Teiles dieses Werkes, ist es, erstens grundlegende Begriffe zu klären, den Platz des Verstehens innerhalb der anderen epistemischen Leistungen zu bestimmen sowie seine besondere Bedeutung ebenso wie die eigentümlichen Schwierigkeiten, die mit ihm verbunden sind, zu begreifen (1.1.). Alsdann sollen in concreto die Gegenstände, die im Prinzip verstehbar sind, ebenso wie die Grundformen des Verstehens erörtert werden. In diesem Zusammenhang werden die erkenntnistheoretischen Untersuchungen unweigerlich ontologische Fragen einbeziehen müssen, weil unterschiedlichen Ausdrucksformen von Mentalität verschiedene Formen des Verstehens entsprechen müssen (1.2.). Ich setze in diesem zweiten Abschnitt einfach voraus, daß es Fremdpsychisches als Gegenstand des Verstehens gibt; es handelt sich, wenn man in Anlehnung an Kant so sprechen will, um eine metaphysische Erörterung. Die Bedingungen der Möglichkeit des Verstehens dieser Gegenstände werden erst im dritten Abschnitt diskutiert, der am ehesten Kants transzendentaler Deduktion entspricht (1.3.). Er umfaßt ebenfalls eine transzendentale Ästhetik und eine transzendentale Logik; zudem enthält der Abschnitt eine transzendentale Pragmatik.
1.1.Formale Kennzeichen des Verstehens
1.1.1.Einleitende Begriffsklärungen: Verstehen, Auslegen, Deuten, Interpretieren, Hermeneutik, Geisteswissenschaften
Was eigentlich ist Verstehen? Die Alltagssprache ist nie ein letztes Kriterium der Philosophie, aber da eine der Thesen dieses Buches ist, daß in der Sprache durchaus ein beträchtliches Ausmaß an Vernunft geronnen ist, weil wir sonst einander gar nicht verstehen könnten, ist es durchaus legitim, vom Sprachgebrauch auszugehen, wenn auch um ihn kritisch zu normieren. Soweit ich sehe, wird «verstehen» zumindestens in folgenden acht sehr unterschiedlichen Kontexten verwendet.
«Sprich lauter – ich habe dich nicht verstanden, weil ich schwerhörig bin» – hier bezieht sich «verstehen» auf das Erfassen akustischer Phänomene.
«Sprechen Sie bitte Deutsch – ich verstehe leider kein Russisch» – hier bezieht sich «verstehen» auf das Erfassen von durch Phoneme ausgedrückten Bedeutungen. Dabei kann «verstehen» sowohl einen einzelnen Akt als auch eine entsprechende Fähigkeit bezeichnen, die im Augenblick nicht aktualisiert ist. «Er versteht Russisch» kann von jemandem auch dann wahr sein, der gerade nicht Russisch hört.
«Wiederholen Sie das bitte – ich habe Ihren schnell vorgetragenen Beweis der Vollständigkeit der Aussagenlogik nicht verstanden» – hier bezieht sich «verstehen» auf den inneren Zusammenhang des Gesagten, nicht auf die Bedeutung einzelner Wörter.
«Ich kann Hitlers Verhalten durchaus verstehen, verwerfe es aber um so schärfer» – hier bezieht sich «verstehen» auf die Rückführung von Verhalten auf Wertüberzeugungen und Tatsachenannahmen des Handelnden.
«Statt ihn zu verurteilen, müssen wir versuchen, ihn zu verstehen» – hier bedeutet «verstehen» «billigen» oder zumindest «entschuldigen».
«Sie verstehen sich prächtig miteinander» – hier bezeichnet «verstehen» eine symmetrische Relation des Teilens gemeinsamer Werte und Überzeugungen.
«Erst dank des Gesprächs mit dir habe ich verstanden, wie sehr ich sie liebe» – hier bezieht sich «verstehen», anders als in den sechs vorigen Fällen, nicht auf fremdes, sondern auf eigenes Verhalten.
«Endlich habe ich die Polynomialformel (bzw. das allgemeine Relativitätsprinzip) verstanden» – hier bezieht sich «verstehen» weder auf fremdes noch auf eigenes Verhalten und die ihm zugrundeliegenden Bewußtseinszustände, sondern auf ein mathematisches Prinzip bzw. ein Prinzip der Natur.
Als Kernbedeutung von «verstehen», diejenige, um die es in diesem Buche geht, sehe ich die intellektuelle Operation, in der ein Subjekt die mentalen Akte eines ihm nicht unmittelbar gegebenen, normalerweise also anderen Subjektes erfaßt, also die unter 2 und 3 angeführte. Da uns die mentalen Akte anderer oft durch einen sprachlichen Ausdruck gegeben sind, der im allergrößten Teil der Menschheitsgeschichte akustischer Natur war, leuchtet es ein, warum in vielen Sprachen für Situationen wie 1, 2 und 3 dasselbe Wort verwendet wird – obwohl die Ursachen der drei Formen regelmäßigen Nichtverstehens, Schwerhörigkeit, Sprachunkenntnis und Dummheit, miteinander nichts zu tun haben.[1] Sprechakte sind Handlungen, die in der Regel darauf abzielen, verstanden zu werden – und wie noch zu zeigen sein wird, ist das nur möglich, weil der Verstehende dem Sprecher Rationalität unterstellt. Ebendiese Unterstellung gilt freilich für alle Handlungen, insofern sie von bloßen physikalischen und biotischen Vorgängen unterschieden werden – damit kommt es zur vierten Bedeutung. Zur fünften Bedeutung führt die (falsche) ethische Theorie, ein Verhalten, das auf das rationale Eigeninteresse des Handelnden zurückgeführt wird, sei damit auch schon legitimiert oder wenigstens entschuldigt: Tout comprendre c’est tout pardonner. Die sechste Bedeutung erweitert diese normative Aufwertung des Verstehens; «sich miteinander verstehen» weist auf Einverständnis in praktischen Fragen. Die achte Bedeutung schließlich ergibt sich daraus, daß, mit der wichtigen, aber seltenen Ausnahme der Entdecker, die meisten Aneignungen wissenschaftlicher Theorien durch die Aufnahme von mündlichen oder schriftlichen Darbietungen erfolgen. Im Normalfall ist mein Zugang zu mathematischen Propositionen durch Lehrbücher vermittelt; diese müssen in der Tat verstanden werden – aber doch, anders als in 3, nur zu dem Zwecke, zu einem Begreifen der Propositionen und der sie verbindenden Ableitungsbeziehungen vorzudringen. Bezeichnet man letzteres als «Theorie», kann man Theorien nicht im hier eingeführten Sinne verstehen; wohl aber, wenn man «Theorie» die realen sprachlichen Gebilde nennt, die eine Theorie im ersteren Sinne des Wortes artikulieren. Ich werde darauf unten S. 174 f. zurückkommen.
Wie läßt sich Verstehen (in der genannten Kernbedeutung) epistemologisch einordnen? Verstehen ist erstens eine Form von Erfahrungserkenntnis und als solche unterschieden von Operationen des reinen Denkens, die nicht auf Erfahrung gestützt sind, wie sie etwa die Logik und Mathematik charakterisieren. Es ist auch unterschieden von der normativen Bewertung, wie sie etwa Ethik und Ästhetik kennzeichnet. Dies bedeutet natürlich nicht, daß begriffliche Operationen und Schlußfolgerungen oder Bewertungen im Verstehensprozeß keine Rolle spielen – es heißt nur, daß sie keine ausschließliche Rolle spielen. Wer Archimedes’ Schrift über die Quadratur der Parabel verstehen will, muß mathematisch mitdenken; aber er vollzieht intellektuelle Operationen, die über diejenigen dessen hinausgehen, der selbständig über die Quadratur einer Parabel nachdenkt, und zwar selbst dann, wenn sich die Gedanken des letzteren in den gleichen Bahnen wie diejenigen des griechischen Mathematikers entwickeln sollten. Denn nur der erste, aber nicht der zweite, schreibt außerdem dem realen Individuum Archimedes eine bestimmte Ansicht zu, und das ist eine Form von empirischer Erkenntnis, die dem Mathematiker abgeht. Analog kann man selbstredend auch einen ethischen Traktat verstehen, und dazu bedarf es eines Sinnes für ethische Argumente; aber der Ethikhistoriker ist nicht primär an der Frage interessiert, ob diese Argumente gültig sind, sondern ob ihr Autor sie für gültig gehalten hat. Wenn er das, was er selber für richtig hält, ohne weiteres dem Autor zuschreibt, verfehlt er die spezifische Aufgabe des Verstehens auch dann, wenn das, was er für richtig hält, es in der Tat ist, solange der interpretierte Autor nicht mit ihm übereinstimmt. Ja, selbst wenn dieser zufälligerweise mit ihm übereinstimmen sollte, ist dieser Zufallstreffer von einem wirklich erkennenden Verstehen zu unterscheiden.
Aber Verstehen ist zweitens ein ganz besonderer Typus von Erfahrungserkenntnis. Es unterscheidet sich sowohl von der Wahrnehmung eines äußeren Gegenstandes – «Diese Katze ist schwarz», «Draußen regnet es» – als auch von der Introspektion, der inneren Wahrnehmung, mit der ein Subjekt Gegebenheiten des mit der Beobachtung etwa gleichzeitigen eigenen Bewußtseinsstroms in den Blick bekommt – «Ich dachte gerade an meinen Vater», «Ich bin heute melancholisch gestimmt». Seit dem 17. Jahrhundert werden diese als die beiden Grundtypen von Erfahrungserkenntnis unterschieden (in der Terminologie John Lockes als «sensation» und «reflection»).[2] Der Unterschied des Verstehens von Wahrnehmung einerseits und Introspektion andererseits besteht darin, daß im Verstehen mir, anders als in der Sinneswahrnehmung, mentale Akte, doch anders als in der Introspektion mentale Akte, die nicht unmittelbar gegeben sind, also normalerweise die eines anderen Subjektes, zugänglich werden.
Manche Erkenntnistheoretiker, etwa Thomas Reid, nehmen auch das Gedächtnis als eigenes Vermögen an, das sich auf Ereignisse in der Vergangenheit richtet. Sowohl die Gegenstände von Wahrnehmungen als auch die von Introspektionen und Verstehensprozessen («Er war da»/«Ich war erschrocken»/«Er war verliebt») sowie diese Akte selber («Ich sah ihn»/«Ich merkte, wie erschrocken ich war»/«Ich fühlte, daß er verliebt war») können erinnert werden. Das, was die Erinnerung kennzeichnet, ist die Bezugnahme auf vergangene Ereignisse, unabhängig von ihrer spezifischen Natur. Sie ist daher allgemeiner als die anderen Formen der Erfahrungserkenntnis. Da sie sich auf vergangene Ereignisse bezieht, umgreift sie nicht die Gegenstände reinen Denkens, die zeitlos sind. Ich kann mich nicht erinnern, daß man kein regelmäßiges Siebeneck in endlich vielen Schritten mit Zirkel und Lineal konstruieren kann; ich kann mich nur erinnern, daß ich das einmal gelesen oder gehört habe.
Erfahrungserkenntnis geht dank des anschaulich Gegebenen über das reine Denken hinaus. Doch bedeutet das keineswegs, sie sei nicht begrifflich artikuliert. Im Gegenteil, sie ist dies unweigerlich und kann damit im Prinzip sprachlich ausgedrückt werden. Allerdings kann ich hier nicht der Frage nachgehen, wie Begriffe zustande kommen. Sicher wird die Begriffsbildung nicht einfach durch das anschaulich Gegebene erzwungen – was keinesfalls heißt, daß alle Begriffsbildungen gleichberechtigt sind.[3] Die Verknüpfung von anschaulich Gegebenem und begrifflicher Kategorisierung gilt auch für die Akte des Verstehens – «Sie wünscht, daß ich gehe», «Der Dichter meint hier das Gegenteil von dem, was er sagt», «Der Logiker verwendet jetzt eine reductio ad absurdum» beziehen sich zwar auf empirische Sachlagen, doch tun sie dies dank eines Begriffsapparates, der selbst kaum empirischen Ursprungs ist.
Ich sagte oben «normalerweise die eines anderen Subjektes». Diese Einschränkung ist deswegen erforderlich, weil man durchaus zu Recht davon reden kann, jemand habe sich selbst verstanden, der etwa nach Jahrzehnten seine frühen Tagebuchaufzeichnungen liest. Der privilegierte Zugang zum eigenen Selbst gilt ja nur für die Gegenwart. Zwar mag bei diesem Verstehen die Erinnerung an das eigene damals introspektiv gegebene Erleben in verschiedenen Graden mitspielen, aber je länger der Zeitraum ist, je stärker passives Vergessen und aktives Verdrängen eingesetzt haben, desto mehr nähert sich die intellektuelle Operation, mit der man sein früheres Selbst erfaßt, dem normalen Verstehen eines anderen Menschen.[4] Wenn man unbewußtes mentales Leben annimmt – was damit gemeint ist, wird noch zu klären sein –, mag es ferner der Fall sein, daß jemand erst am eigenen Verhalten (auf das ihn vielleicht sogar erst ein Dritter hinweist, wie oben im siebten Fall) erkennt, daß er etwa in jemand anderen verliebt ist, z.B. wenn Zensurmechanismen die normale Introspektion, das Aufmerken auf das eigene mentale Leben,[5] blockieren. Auch in diesem Falle kann man zu Recht davon sprechen, daß jemand sich selbst versteht, weil er nur durch den Umweg über das Ausdrucksverhalten zu seinem eigenen mentalen Leben vorgedrungen ist. Allerdings ist in diesem Falle am Schluß des Verstehensprozesses eine Introspektion möglich, die im Falle des Fremdverstehens grundsätzlich versagt ist. Der andere bleibt stets in größerem Grade opak, u.a. weil eine Verstellung nie ganz auszuschließen ist.
Ferner kann das Verstehen anderer insofern ein Schlüssel zum eigenen Selbst sein, als gewisse Begriffsbildungen leichter an fremden Ichen geschehen, ggf. sogar an fiktiven Personen eines literarischen Werkes. Denn der Wunsch nach Selbstachtung mag die vorurteilsfreie Beschreibung des eigenen Verhaltens behindern und damit die Vorteile des direkten Zugangs der Introspektion durchaus aufheben. Haben die neuen Kategorien, etwa «Eifersucht», aber einmal den eigenen Begriffsapparat bereichert, kann man die entsprechenden Begriffe auf introspektiv Gegebenes anwenden. Dieser Fall ist von dem eben diskutierten dadurch unterschieden, daß in jenem die Introspektion, in diesem die kategoriale Durchdringung des introspektiv Gegebenen durch Verstehensprozesse vermittelt ist. Im ersten Fall verstehe ich mich selbst dank der Beobachtung meines Verhaltens, im zweiten Fall erst nach dem Verstehen des fremden Verhaltens.
Der Zugang zu mentalen Akten anderer erfolgt, zumindest im Normalfall, nicht direkt. Zwar gibt es m. W. keine apriorischen Argumente gegen die Möglichkeit telepathischer Gedankenübertragung, aber die empirische Evidenz scheint nicht ausreichend zu sein, und das Phänomen, wenn es denn existiert, kann guten Gewissens hier ausgeblendet werden. Das heißt aber, daß der Zugang zu mentalen Akten anderer durch die Wahrnehmung sinnlicher Erscheinungen vermittelt ist. Die Röte, die das Gesicht des Mädchens plötzlich überzieht, vermittelt die Einsicht, daß es verlegen ist, die artikulierten Laute «HILFE» oder die auf einer Postkarte niedergekritzelten Schriftzeichen eines Mitmenschen «Mallorca war toll» die Überzeugung, daß er Hilfe braucht bzw. daß er seinen Urlaub genossen hat. Freilich geht das Verstehen dieser Zeichen stets über ihre sinnliche Wahrnehmung hinaus, und die Richtung, in die es sich erstreckt, ist unweigerlich durch das eigene Erleben bestimmt. Denn da mir die mentalen Zustände des anderen nicht durch Introspektion zugänglich sind, kann ich sie nur dadurch erschließen, daß ich die Korrelation zu Rate ziehe, die zwischen meinen eigenen mentalen Zuständen und den sie begleitenden sinnlich wahrnehmbaren physischen Zuständen besteht. Eine derartige Korrelation ist am plausibelsten bei Artangehörigen, und daher ist im 20. Jahrhundert das, was man früher «Tierpsychologie» nannte, durch die «Verhaltensforschung» genannte Disziplin ersetzt worden. Allerdings spricht die große Übereinstimmung zwischen tierischem und menschlichem Ausdrucksverhalten dafür, auch im Mentalen eine entsprechende Übereinstimmung anzunehmen, und daher kann man auch Tieren mentale Zustände wie Emotionen zuschreiben und etwa verstehen, daß ein Hund eifersüchtig ist, weil sein Herr sich zu lange einem Besucher zuwendet.[6] Man kann dies freilich auch bestreiten, und man kann im Prinzip so weit gehen, nur bei sich selbst Mentales anzunehmen. Dieser radikale Behaviorismus ist ebenso wie der Solipsismus, nach dem es nicht einmal eine von meinem Bewußtsein unabhängige Außenwelt gibt, sondern nur mich selbst und meinen Bewußtseinsstrom, nicht formallogisch widersprüchlich, und er ist nicht empirisch widerlegbar, weil erstens jedes fremde Innenleben mir nur durch Physisches hindurch zugänglich ist und zweitens dieses Physische meinem Bewußtsein gegeben sein muß, um überhaupt wahrgenommen und erwogen zu werden.
Verstehen, wenn es denn möglich sein sollte, kann man auf jeden Fall nur Wesen mit mentalem Leben, sofern sie nicht unmittelbar mit dem verstehenden Subjekt identisch sind – bzw. die physischen Ereignisse und ggf. die dauerhaften Produkte, in denen sich dieses mentale Leben äußert, das Lüften des Hutes etwa oder das Bild, das jemand gemalt hat. Zwar ist die Ausrichtung beider Verstehensprozesse unterschiedlich – es ist nicht dasselbe, ob man einen Dichter oder sein Gedicht versteht, und zwar u.a. deshalb, weil das Gedicht, ebenso wie eine Handlung, Eigenschaften aufweisen kann, die nicht intendiert sind: Unbeabsichtigte Nebenfolgen sind nicht Thema des auf das Subjekt gerichteten, wohl aber des auf den Ausdruck oder das Produkt (die im folgenden «Interpretandum» genannt seien) gerichteten Verstehens (siehe unten Kap. 1.2.2.3. und 1.2.3.3.3.). Aber da uns das fremde Subjekt nur durch seine Objektivationen zugänglich ist und da diese Objektivationen zu verstehen, und nicht bloß wahrzunehmen, bedeutet, sie wenigstens partiell als Ausdruck des mentalen Lebens eines anderen Subjektes zu fassen, ist es nicht wirklich irreführend, daß man für beide Aktivitäten denselben Terminus verwendet. Ich halte es daher nicht für erforderlich, hier terminologisch durchgängig zu differenzieren, auch wenn ich gelegentlich jene Form des Verstehens, die sich primär auf die Objektivierung richtet und sich vom Subjekt weitgehend gelöst hat, in dem diese ihren Ursprung hat, «Auslegen» nennen werde. Der Rechtshistoriker interpretiert ein Gesetz, der Rechtsdogmatiker legt es aus (vgl. Kap. 1.2.3.4.2.1.).
Während man nach dem Gesagten im Prinzip auch Organismen verstehen kann – ab der Stufe, auf der Mentalität einsetzt –, ist es absurd, Anorganisches wie z.B. einen Stein verstehen zu wollen – wenigstens sofern man nicht Panpsychist ist.[7] Und für den Panpsychismus spricht ausschließlich der Wunsch, einen Sprung in der Entfaltung des Seins zu vermeiden. Aber «natura non facit saltus» ist kein zwingendes Prinzip, «entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» jedoch durchaus. Und es scheint abwegig, Elektronen mentale Zustände zuzuschreiben, unter denen man sich nichts vorstellen kann, zumal der Übergang von deren «Proto-Bewußtsein» zu normalem Bewußtsein ebenso rätselhaft bliebe wie die Emergenz von Bewußtsein. Ein Selbstgefühl scheint viel angemessener der Selbsterhaltung, wie sie Organismen kennzeichnet, als notwendiger, allerdings nicht hinreichender Bedingung seines Auftretens, zu entsprechen.[8]
Die zunehmende Begrenzung des Reichs des Verstehbaren, und damit auch der Disziplin Hermeneutik, eine Begrenzung, die Hand in Hand erfolgte mit der Überwindung des Animismus und der Entzauberung der Welt, ist Teil des Prozesses der Rationalisierung.[9] So wird bei Platon die hermeneutische Kunst im Zusammenhang mit der mantischen Kunst genannt; wahrscheinlich ist damit die Kunst der Interpretation der göttlichen Zeichen gemeint.[10] Während wir heute, anders als die Alten, das Fallen von Steinregen oder das Auftreten von Mißgeburten nicht mehr verstehen, sondern nur wahrnehmen und möglichst erklären wollen, mag freilich auch ein nachaufklärerischer Theologe die Aufgabe verteidigen, die Welt als ganze zu verstehen – und d.h. als Ausdruck eines übernatürlichen geistigen Wesens. Ich werde in Kap. 1.2.3.6. diese Perspektive erörtern. Für den entsprechenden, auf ein geistiges Prinzip der Wirklichkeit als ganzer Bezug nehmenden Akt des Verstehens möchte ich den Ausdruck «deuten» verwenden.[11]
Die Erfahrungserkenntnis physischer Gegenstände erfolgt auf verschiedenen Niveaus. Unsere vorwissenschaftliche Lebenswelt ist durch eine Fülle von Wahrnehmungen und Beobachtungen bestimmt, die in der Naturwissenschaft präzisiert und partiell ersetzt werden, etwa durch experimentelle Vorrichtungen, die, z.B. in Mikroskop und Teleskop, den Gegenstandsbereich des Wahrgenommenen erweitern. Dabei setzen diese Vorrichtungen aber stets – und zwar geltungstheoretisch, nicht nur genetisch – die Zuverlässigkeit wenigstens einiger Beobachtungen voraus: Ich muß in der Lage sein, die Meßergebnisse abzulesen, auch wenn bestimmte konkrete Meßprozesse an Apparate delegiert wurden. Analog muß man zwischen einem lebensweltlichen und einem wissenschaftlichen, d.h. methodisch geregelten, Einzelfälle auf allgemeine Prinzipien zurückführenden Verstehen unterscheiden. Allein das letztere will ich «Interpretieren» nennen.[12] Verstehensleistungen beginnen sehr früh: Die Einfühlung in den Gemütszustand der Mutter und die Unterscheidung später interpretierbarer sprachlicher Laute von anderem Lärm sind für das Baby nicht weniger wichtig als die Wahrnehmung von Nahrungsquellen. Interpretatorische Leistungen werden dagegen nicht von allen vollbracht: Es bedarf einer besonderen und bewußten Ausbildung, um eine Inschrift aus einer toten Sprache (selbst wenn sie eine Vorstufe der eigenen Muttersprache ist), ein komplexes philosophisches Argument oder ein literarisches Werk wie Joyce’ «Finnegans Wake» zu verstehen – hier wird also das Verstehen zum Interpretieren. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Weise, in der man die Muttersprache und viel später Fremdsprachen erlernt, kann allerdings derselbe Gegenstand – etwa die arabische Sprache – Gegenstand eines naturwüchsigen Verstehens und eines wissenschaftlichen Interpretierens werden. Das Übersetzen einer Fremdsprache hat eine Mittelstellung zwischen Verstehen und Interpretieren,[13] und in der Tat bedeuten das griechische ἑρμηνεύς und das lateinische «interpres» «Vermittler», «Ausleger» und «Dolmetscher». Auch wenn es eine scharfe Zäsur zwischen Verstehen und Interpretieren nicht gibt, kann man doch die Termini wenigstens komparativ klar unterscheiden: Der Literaturwissenschaftler ist eher interpretierend tätig als der normale Leser.
Ich spreche nicht schon von «Interpretieren», wenn besondere wissenschaftliche Vorkehrungen getroffen werden, um die physische Basis zu eruieren, auf die sich dann das Verstehen richten kann. Der Philologe, der Gioberti-Tinktur oder UV-Strahlung einsetzt, um dann ein Palimpsest besser zu entziffern, vollbringt zwar, schon bevor er zu lesen beginnt, eine wissenschaftliche Leistung – aber es handelt sich um eine naturwissenschaftliche, keine interpretatorische. Ich spreche dagegen auch dann von Interpretation, und zwar von Fehlinterpretation, wenn der Interpret sein Objekt, also das Interpretandum, vielleicht gerade aufgrund seiner methodischen Zurichtung verfehlt. So hat die allegorische Bibelinterpretation des Mittelalters, etwa des Hohen Liedes, den Text weniger richtig verstanden als der naive Leser aus der Zeit seiner Entstehung – aber es handelt sich trotzdem um eine Interpretation (obzwar um eine Fehlinterpretation), weil sie auf komplexen hermeneutischen Annahmen über den mehrfachen Schriftsinn beruhte. Natürlich gibt es Analoges im vorwissenschaftlichen Verstehen, nämlich Mißverstehen. Ich spreche dagegen von dem Scheitern eines Verstehens oder einer Interpretation, wenn das verstehende bzw. interpretierende Subjekt selbst zu dem Ergebnis kommt, ein korrektes Verstehen oder eine korrekte Interpretation sei ihm nicht gelungen. Dem entspricht in der äußeren Wahrnehmung etwa die erlebte Unfähigkeit, ein nachts vorbeihuschendes Wesen zu identifizieren, die von dessen Verwechslung mit einem anderen Wesen zu unterscheiden ist. Man beachte, daß im Deutschen «verstehen» manchmal, wie «sehen» oder «wissen», als Erfolgsverb fungiert («Er hat das verstanden»), manchmal hingegen nur auf intentionale Akte verweist, unabhängig von ihrem Erfolg («Ich habe ihn gestern so verstanden, als wolle er ‹p› sagen, aber jetzt weiß ich, daß er in Wahrheit etwas anderes meinte»). Der Kontext macht meist klar, was gemeint ist. In der ersten Bedeutung ist «verstehen» übrigens nur ein Erfolgsverb, nicht zugleich ein Leistungsverb – denn der Erfolg des Verstehens kann sich auch zufällig, durch glückliches Raten, einstellen, nicht notwendig durch methodisch disziplinierte Leistung. Im letzteren Falle will ich, wie oben auf S. 23 schon gesagt, von erkennendem Verstehen sprechen.
Weitgehend ausgeblendet aus dieser Untersuchung ist ein anderer Begriff der Interpretation, den man denjenigen der performativen Interpretation nennen mag. Gemeint ist damit die Interpretation eines Kunstwerks aus einer zeitlichen Kunst wie etwa der Musik oder dem Theater, das, anders als eine Plastik oder ein Gemälde, sinnlich voll nur gegeben ist, wenn es in einem bestimmten Zeitraum aufgeführt wird.[14] Doch ist die Interpretation von Samuel Becketts «Endspiel» durch Hans Bauer mit Bernhard Minetti und anderen Schauspielern offenbar etwas anderes als die Interpretation desselben Stückes durch Theodor W. Adorno, schon weil sie sich in ganz anderen Medien abspielt – gesprochener Sprache, Gebärden, Kostümen, Beleuchtung, Bühnenbild auf der einen, einem schriftlichen Text auf der anderen Seite. Zudem bringt die erste Interpretation das Werk zur vollen Existenz, die zweite dagegen nimmt auf es Bezug. So unterschiedlich beide Interpretationsbegriffe auch sind, so bleibt es doch richtig, daß beide das Verständnis eines Textes (bzw. einer Partitur) zur Voraussetzung haben. Ein literaturwissenschaftlicher Interpret kann daher die performative Interpretation eines Dramas kritisieren, weil sie auf dem Mißverständnis der Motivlage eines Charakters des Stückes beruhe. Eine solche Kritik setzt voraus, daß der Kritiker selber sowohl das literarische Werk als auch dessen performative Interpretation richtig verstanden hat – denn natürlich ist auch die letztere, als Äußerung eines mentalen Lebens, Gegenstand einer (nicht-performativen) Interpretation. Allerdings ist dabei zweierlei hervorzuheben: Die philologische Interpretation kann notwendige Rahmenbedingungen für eine gültige performative Interpretation setzen – aber sie wird nie in der Lage sein, hinreichende Kriterien für deren Gelingen zu entwickeln; der Dirigent, der Pianist, der Regisseur und der Schauspieler haben daher eine unveräußerliche Autonomie (was keineswegs heißt, daß sie nicht weiteren, das literarische Werk bzw. die Partitur allerdings transzendierenden Kriterien untersteht).[15] Das hat u.a. mit den Unbestimmtheitsstellen des Kunstwerkes zu tun:[16] Sophokles’ «Antigone» sagt uns nicht, welche Farbe ihre Augen haben, aber der Regisseur muß unweigerlich eine Schauspielerin mit einer bestimmten Augenfarbe auswählen; auch wenn sich keine Bemerkungen zur Kleidung einer literarischen Figur finden, ist es trotzdem keine gute Idee, sie nackt auftreten zu lassen. Und zweitens mag es sein, daß eine Aufführung des «Don Carlos» zwar eine Verfehlung des Schillerschen Stückes ist, dafür aber ein großartiges Theatererlebnis bietet, das allerdings fairerweise «Variationen zu Schillers ‹Don Carlos›» hätte benannt werden sollen. Ein Entschuldigungsgrund, warum dies nicht geschehen ist, mag sein, daß die Identitätskriterien für Kunstwerke notorisch schwierig sind – wir wissen nicht genau, wann, etwa: bis zu welchem Grade von Kürzungen, es sich noch um eine unterschiedliche Aufführung desselben Stückes handelt und wann schon die Aufführung eines neuen Stückes beginnt.[17]
Oft kann man heute lesen, Interpretation sei überall am Werke, auch bei der Wahrnehmung physischer Objekte. Denn diese sei stets konstruktiv; es werde etwas in die Sinnesdaten hineingelesen, das über ihren faktischen Inhalt hinausgehe.[18] Daran ist folgendes richtig: Ohne Zweifel nehmen wir die Wirklichkeit in komplexen Prozessen wahr, die weit über das bloße Empfindungsmaterial hinausgehen, sie erscheint uns stets als in bestimmter Weise gegenständlich strukturiert gegeben. Die Konstanzleistungen der Wahrnehmung sind allgemein bekannt: Wir nehmen ein Objekt als gleich groß wahr, wenn es sich entfernt, als gleich farbig, auch wenn die Beleuchtung sich wandelt, trotz der Veränderung der Sinnesdaten; analog wird etwa der Ausfall des Gesichtsfelds im blinden Fleck des Auges im Bewußtseinsakt des Wahrnehmens ausgeglichen. Das alles legt die Auffassung nahe, wir «interpretierten» die Daten in einer bestimmten Weise.[19] In seinen großartigen «Principles of Psychology», die leider den Verstehensprozessen kein eigenes Kapitel widmen, hat William James letztere im siebzehnten Kapitel «The Perception of ‹Things›» gestreift. Warum? Seine zentrale These ist, daß unsere Ergänzung der Sinnesdaten zu einem Bild der Wirklichkeit, das Sinn ergibt, also zu dem, was er «FIGUREDconsciousness», «gestaltetes Bewußtsein», nennt,[20] letztlich analog ist dem Verstehen eines Textes. Wir erwarten etwas und nehmen irrelevante Abweichungen gar nicht wahr – seien es fehlende Sinnesdaten im blinden Fleck, seien es fehlende Buchstaben in einem Text, den wir lesen. Die Illusion des Fahnenkorrektors, der stets weniger Fehler entdeckt, als dasind, weil er den Text sinngemäß ergänzt, wirft nach James Licht auf den Wahrnehmungsprozeß im allgemeinen (2.96 f.). Nun ist diese Analogie sicher erhellend, zumal beide Ergänzungen unbewußt erfolgen: Die Empfindungen bauen den Bewußtseinsakt auf, sind aber nicht in ihm selber gegeben. Aber es handelt sich eben um eine Analogie; sie kann als solche keine Identität beweisen. Denn der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Verstehen/Interpretation wird durch diese Gemeinsamkeit gar nicht berührt: In der Wahrnehmung ergänze ich die Empfindungen, um konstante physische Gegenstände zu erfassen, im Verstehen, um dem Autor des Interpretandums sinnvolle Bedeutungen zuzuschreiben. In beiden Akten ist ein Streben nach Ganzheit zu erkennen, wenn man will nach Sinn; aber dieser Begriff von Sinn ist offenbar viel allgemeinerer Natur als derjenige, um den es im Verstehen geht. Erst recht kann die Analogie zwischen beiden Akten nicht zeigen, daß das konstruktive Moment ein Verfehlen der «eigentlichen» Wirklichkeit zur Folge habe; dessen Existenz ist durchaus damit kompatibel, daß es allein dank seiner zu einem Erfassen von Wirklichkeit kommen kann. Und wenn dies der Fall ist, dann ist das Verweisen auf einen uns prinzipiell unzugänglichen Zugriff auf die «eigentliche» Wirklichkeit eine leere Geste.
Von dem gerade zurückgewiesenen Interpretationsbegriff streng zu unterscheiden, weil sich nun der entsprechende Akt bewußt abspielt, aber ebenfalls auf rein Physisches bezogen ist diejenige Verwendung von «interpretieren», nach der etwa der Arzt ein Röntgenbild dahingehend «interpretiert», daß ein Knochenbruch vorliegt. Das Bild ist zwar ein Zeichen für die Existenz eines Bruchs, aber es ist ein natürliches Zeichen, das auf Physisches verweist, keineswegs auf Mentales. Die Existenz des Bildes, das ein Objekt einfacher Wahrnehmung ist, wird am besten mit dem Vorhandensein bestimmter anatomischer Sachlagen erklärt. Da freilich Handlungen interpretierbar sind, insofern man sie auf ihre Motive zurückführt, kann man zwar nicht das Röntgenbild, wohl aber dessen Herstellung interpretieren, etwa indem man die entsprechende Absicht des Arztes eruiert.
Hermeneutik ist die Kunst bzw. Wissenschaft des Verstehens. Dabei kann man drei verschiedene Ebenen unterscheiden. So mag man von den hermeneutischen Fähigkeiten schon eines Kindes sprechen, sofern es andere besonders rasch und eindringend versteht; der Prinzipien, die es leiten, wird es sich dabei ebensowenig bewußt sein wie der grammatischen Regeln, die es virtuos befolgt, ohne sie als solche formulieren zu können. Zweitens gibt es eine explizite Artikulation einiger der Prinzipien, die die Interpretation steuern (daneben bleibt vieles implizites Wissen, also nicht in die Bewußtseinshelle gehobene Praxis, was einerseits unvermeidlich ist, andererseits die kritische Scheidung sinnvoller von bloß durch die Macht der Tradition oder individueller Machthaber gestützten Praktiken erschwert).[21]In diesem Sinne ist die Hermeneutik die Kunstlehre des Verstehens und Teil der Methodenlehre der Geisteswissenschaften. (Sie ist nur ein Teil, denn die Geisteswissenschaften verwenden auch andere Methoden, die sie mit den Naturwissenschaften teilen, wie zum Beispiel die Begriffsbildung, die Erklärung aufgrund allgemeiner Gesetze, den Vergleich.) Drittens kann man von philosophischer Hermeneutik reden, wenn es um die erkenntnistheoretische Rechtfertigung der Prinzipien des Verstehens und der Interpretation geht, man also die Frage diskutiert, aufgrund welcher Argumente man darauf vertrauen kann, daß derartige Methoden uns das Bewußtsein eines anderen zu erfassen gestatten. Philosophische Hermeneutik in diesem (nicht-Gadamerschen) Sinne steht im Zentrum dieses Buches, auch wenn Teilaspekte der zweiten Form von Hermeneutik immer wieder exemplifizierend herangezogen werden (manchmal in Fußnoten).
Philosophische Hermeneutik ist eine regionale Disziplin der Philosophie, auch wenn eine besonders fundamentale, da der Philosoph viel Zeit damit verbringen muß, Äußerungen von vergangenen und gegenwärtigen Kollegen zu verstehen. Aber sie ist keineswegs eine Erste Philosophie, denn sie setzt nicht nur die Logik voraus, sondern auch die Erkenntnistheorie und die Ontologie, und zwar nicht nur eine formale Ontologie, sondern u.a. Annahmen zum Verhältnis von Physischem und Mentalem. Die inflationäre Aufwertung der Hermeneutik zur Ersten Philosophie bei Heidegger und Gadamer hat ihr nicht gut getan, auch wenn wir im nächsten Abschnitt sehen werden, warum dieser Schritt eine verführerische Suggestivität hat. Abwegig ist schließlich der Gebrauch des Worts «Hermeneutik» im Sinne eines Gegenbegriffs zu argumentativ schlüssiger Philosophie, wie er sich bei Richard Rorty im Zusammenhang seiner Verteidigung erbaulicher Tätigkeiten findet (1979; 357 ff.). Nur jemand, der die frühere Geschichte der Hermeneutik so vollständig ignorierte wie Rorty, konnte auf diesen Gedanken verfallen. Der Hermeneutik ist weitaus mehr gedient, wenn sie als ein begrenzter, aber den anderen Disziplinen der Philosophie an Strenge nicht nachstehender Teilbereich der Philosophie gilt. Erstens sind Zweifel angebracht, ob der Wahrheitsanspruch der Naturwissenschaften besser begründet ist als derjenige der Geisteswissenschaften, aber selbst wenn das der Fall wäre, folgte daraus zweitens nicht, daß die Philosophie der Geisteswissenschaften derjenigen der Naturwissenschaften an argumentativer Strenge unterlegen wäre.
Aus dem Gesagten ergibt sich, daß ich unter «Geisteswissenschaften» die Wissenschaften verstehe, die auf die Operation des Verstehens angewiesen sind, das sie in der Regel zum Interpretieren verfeinern, also die hermeneutischen Wissenschaften.[22] Diese Definition weicht von verschiedenen anderen Abgrenzungen ab, die man gelegentlich findet. So sind erstens die Geisteswissenschaften, wie schon Wilhelm Dilthey (1910; 81 f.) gezeigt hat, nicht mit den Humanwissenschaften gleichzusetzen, und zwar aus zwei Gründen. Ob man Menschen als physische Wesen mit mentalen Eigenschaften oder als geistige Wesen mit einem Körper begreift: Nicht alles am Menschen ist verstehbar, und daher sind etwa Humangenetik, -anatomie und -physiologie keineswegs als Geisteswissenschaften zu verbuchen, auch wenn sie vom Menschen handeln. Umgekehrt sollte man, wie gesagt, nicht bestreiten, daß es nicht-menschliche Mentalität gibt. Selbst wenn die Psychologie der Tiere uns noch nicht ausreichenden Stoff zu einer eigenen Wissenschaft von den Emotionen und Denkleistungen der Tiere geben sollte, ist es höchstens empirisch, aber nicht begrifflich ausgeschlossen, daß es auf anderen Planeten andersartige vernünftige Organismen mit einer komplexen Kultur gibt: Deren Studium wäre Gegenstand keiner Human-, aber doch einer Geisteswissenschaft.
Die Geisteswissenschaften sollten zweitens auch nicht mit den historischen Wissenschaften als den Wissenschaften von der Vergangenheit identifiziert werden, und dies ebenfalls aus zwei Gründen. Erstens gibt es historische Wissenschaften der Natur – ich nenne nur die Erdgeschichte und die Paläontologie.[23] Und zweitens ist Verstehen von Vergangenem nur ein Teil der Aufgaben der Geisteswissenschaften: Neben einer diachronischen gibt es z.B. eine synchronische Sprachwissenschaft. Allerdings ist es kein Zufall, daß die Geisteswissenschaften sich im 19. Jahrhundert zunächst meist als historische Disziplinen verstanden haben. Denn Verstehen von vergangenen Produkten des menschlichen Geistes ist schwieriger als das von zeitgenössischen; es erfordert bewußtes, methodisch verfahrendes Interpretieren. Die Prinzipien, die Verstehen zeitgenössischer Texte in der eigenen Muttersprache ermöglichen, laufen dagegen unbewußt ab, und daher wurde erst später begriffen, daß es auch von ihnen eine Wissenschaft gibt. Begründungstheoretisch, allerdings nicht wissenschaftsgenetisch, geht die synchronische Betrachtung sogar der diachronischen voraus, denn ich muß wenigstens präreflexiv schon wissen, was Sprache oder Religion ist, bevor ich die Sprach- oder Religionsgeschichte studieren kann. Dies für die Sprachwissenschaft konkret zu begreifen bedurfte es freilich des Genies Ferdinand de Saussures (1931; 93 ff.).
Damit ist drittens auch gesagt, daß es unsinnig ist, die Geisteswissenschaften wie Wilhelm Windelband in seiner berühmten Straßburger Rektoratsrede von 1894 als idiographische, also Einzelereignisse beschreibende Wissenschaften den Naturwissenschaften als nomothetischen, also auf Gesetze abzielenden Wissenschaften entgegenzusetzen.[24] Denn auch Naturwissenschaftler beschreiben immer wieder Einzeldinge, etwa Gesteinsproben, und sie sind so erfolgreich dabei, weil sie sich auf allgemeine Gesetze stützen. Analoges gilt aber auch für die Geisteswissenschaften. Zwar ist es richtig, daß geistige Individuen von höherer Komplexität sind als physische und daher mehr Aufmerksamkeit verdienen. Aber zu einer wissenschaftlichen wird diese Aufmerksamkeit nur, wenn sie sich eines Kategoriensystems bedient, und nichts schließt aus, daß es auch im geistigen Bereich allgemeine Gesetze gibt, wenn sie auch sicher komplexerer Natur sind als etwa das Gravitationsgesetz. Ja, akzeptiert man bestimmte Theorien der Kausalität, wie z.B. diejenigen Humes oder Kants, kann man von «Ursache» auch im Geistigen nur reden, wenn es allgemeine Gesetze gibt. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man die Suche nach allgemeinen Korrelationen zwischen Elementen der verstehbaren Welt mit einem anderen Namen bezeichnet als die konkrete interpretative Tätigkeit, und manches an der gegenwärtigen Arbeitsteilung zwischen Sozial- und Geisteswissenschaften hat mit diesem Unterschied zu tun. Nur ist festzuhalten: Der genannte Unterschied hat, anders als der zwischen Chemie und Musikwissenschaft, nichts mit verschiedenen ontischen Gegenstandsbereichen zu tun, sondern nur mit unterschiedlichen kategorialen Akzentsetzungen innerhalb derselben Seinssphäre. So mag man, wenn man will, eine mehr «geisteswissenschaftlich», d.h. konkret interpretierend, von einer mehr «sozialwissenschaftlich» verfahrenden Theorie der Dichtung und ihrer Abhängigkeit von anderen Parametern der verstehbaren Welt unterscheiden. Aber beide Unternehmen ergänzen einander, so wie die Geschichts- und die Sozialwissenschaften; es handelt sich keineswegs um unabhängige Wissenschaften von unterschiedlichen Seinssphären.[25]
Man könnte freilich versuchen, die Sozialwissenschaften statt bloß methodisch inhaltlich dadurch von den Geisteswissenschaften abzugrenzen, daß es in ersteren um die oft ungewollten Wirkungen menschlicher Handlungen gehe. In der Tat erklärt sich die recht späte Entstehung der Wirtschaftswissenschaft und der Soziologie als eigener Wissenschaften m. E. daraus, daß erst im 18. Jahrhundert begriffen wurde, daß die unbeabsichtigten Folgen menschlicher Handlungen ein System mit Eigengesetzlichkeit ausmachen.[26] Aber auch wenn die Eigengesetzlichkeit des Sozialen eine einfache Reduktion auf Intentionen nicht möglich erscheinen läßt, gibt es keine Soziologie und auch keine Wirtschaftswissenschaft, die auf die Rekonstruktion von Intentionen, etwa bei Entscheidungen, verzichten kann. Von unbeabsichtigten Nebenfolgen kann man nur reden, wenn man die Absichten identifiziert hat, und das ist ohne Prozesse des Verstehens gar nicht denkbar. Insofern sind auch diese Wissenschaften Geisteswissenschaften im weiteren Sinne des Wortes. Und zudem ist auch das Kunstwerk, Gegenstand der klassischen Geisteswissenschaften, wie wir noch sehen werden, dadurch gekennzeichnet, daß es Eigenschaften hat, die nicht als solche intendiert waren.
Meine Definition impliziert nicht, daß das Verstehen die einzige Operation der Geisteswissenschaften ist, und ebensowenig wie die Benutzung nomologischer Kausalerklärungen schließt sie selbst weitgehende Formalisierung und Mathematisierung aus. Es wäre ohnehin abwegig, den Grad der Mathematisierung bei einer Einteilung der Wissenschaften zu berücksichtigen, da dieser je nach dem Stand einer Einzelwissenschaft, aber auch der Mathematik wechselt: Die Biologie ist, nach Anfängen im späten 19., erst im 20. Jahrhundert weitgehend mathematisiert worden, ohne doch ihr Thema, das Lebendige, auszutauschen, und die Spieltheorie ist eine mathematische Disziplin, zu deren Gegenstandsbereich Intentionen gehören und die daher Wirtschaftswissenschaft und Theorie der internationalen Beziehungen revolutioniert hat. Die Mathematisierung der modernen Linguistik zieht zwar einen anderen Typus von Intellektuellen an als die alte vergleichende Sprachwissenschaft, da Methoden Intellektuellentypen viel eher definieren als Gegenstandsbereiche. Aber anders als ein Intellektuellentypus ist eine Wissenschaft durch ihren Gegenstandsbereich definiert, und wenn neue Methoden einen alten Gegenstandsbereich erhellen, dann sind sie willkommen zu heißen. Denn der Gegenstand bestimmt die Methode, nicht die Methode den Gegenstandsbereich, und gerade bei komplexeren Gebilden ist von einer Methodenvielfalt auszugehen.
Geisteswissenschaften liegen also dort vor, wo der Gegenstand verstehbar ist, d.h. auf mentale Akte zurückführbar ist. Mathematik, Physik, Chemie und der größte Teil der Biologie sind somit keine Geisteswissenschaften – die Mathematik ist eine Ideal-, die anderen gerade genannten Wissenschaften sind Naturwissenschaften. Auch die Logik ist keine Geisteswissenschaft, seitdem man, spätestens mit Husserl, begriffen hat, daß sie nicht eine Unterdisziplin der Psychologie sein kann. Ja, ganz allgemein ist die systematische Philosophie, anders als die Philosophiehistorie, keine Geisteswissenschaft, denn sie bedient sich primär begriffsanalytischer und nicht hermeneutischer Operationen. Das mag angesichts der üblichen institutionellen Einordnung der Philosophie überraschen, versteht sich aber für die Logik, die Philosophie der Mathematik und der Natur angesichts ihres Gegenstandsbereichs von selber. Aber auch dieses Buch, das zur Philosophie der Geisteswissenschaften gehört, ist nicht ein geisteswissenschaftliches, weil sein Interesse nicht primär darin liegt zu verstehen, sondern zu begreifen, wie Verstehen möglich ist. Aus dem Gesagten folgt, daß der im 19. Jahrhundert im englischen Sprachraum, etwa im sechsten Buch von John Stuart Mills «A System of Logic Ratiocinative and Inductive», gebräuchliche Terminus «moral sciences» für die Geisteswissenschaften irreführend ist. Denn die Ethik ist ebensowenig wie die Logik eine Geisteswissenschaft (auch dann nicht, wenn man wie hier darunter die Sozialwissenschaften subsumiert); die Suche nach dem normativen Prinzip von Handlungen ist etwas ganz anderes als das Verstehen der Wertüberzeugungen von Geistwesen, das selbstredend in die Geisteswissenschaften gehört. Wohl aber kann man den Ursprung jenes Terminus verstehen: Die normative Frage ist wichtiger als die hermeneutische, und die ältesten Vorläufer der Geisteswissenschaften erfüllten hermeneutische Aufgaben mit dem Ziel, normative Probleme zu lösen. Das Verstehen der Klassiker, und ohnehin als geoffenbart angenommener Texte, war deswegen so wichtig, weil man erwartete, in ihnen die Antwort auf moralische, politische oder ästhetische Fragen zu finden. Dort, wo normative Fragen autoritativ, im Rückgriff auf Traditionen, beschieden wurden, waren normative und hermeneutische Fragestellung so verwoben, daß es schwerfiel, beide auseinanderzuhalten.[27] (Im Grunde gilt das auch heute noch für Jurisprudenz und Theologie.) Aber mit der aufklärerischen Kritik an tradierten Autoritäten zerbricht die wechselseitige Durchdringung von hermeneutischer und normativer Fragestellung; und das hat in vielem dem Verstehen gutgetan, weil es sich nun – ohne Hoffnung auf Bestätigung normativer Erwartungen – vorurteilslos seinen Interpretanda zuwenden konnte. Das außerordentlich hohe Niveau der Geisteswissenschaften im neunzehnten Jahrhundert verdankt sich genau dieser Loskopplung, die uns etwa die Bibel, aber auch manche Werke der klassischen Antike erstmals richtig zu verstehen lehrte. Der Preis, den die Geisteswissenschaften dafür bezahlen mußten, daß sie auf den Titel der ‹moral sciences› Verzicht leisteten, war nicht unbeträchtlich – ein gewaltiger Verlust an Lebensbedeutsamkeit (sichtbar etwa in der Umwandlung der «Klassischen» Philologie zur Altertumswissenschaft). Doch war dieser Preis zu zahlen, da die Prinzipien von Hermeneutik und Ethik in der Tat völlig unterschiedlich sind. Zudem ist es im Prinzip denkbar, nach deren säuberlicher Scheidung eine normativ ausgerichtete Geisteswissenschaft, die sich aus zwei Quellen speist, neu zu konzipieren, auch wenn unser Wissenschaftssystem noch weit davon entfernt ist, einen institutionellen Platz für eine solche Geisteswissenschaft vorzusehen. Während dieser Bedeutungsverlust den Geisteswissenschaften sowohl geschadet als auch genutzt hat, ist hingegen der zweite Schub im Selbstverständnis der Geisteswissenschaften, der in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erfolgt ist, nichts weniger als selbstmörderisch. Er besteht darin, die Allgemeingültigkeit des Verstehens und Interpretierens zu verneinen, damit in letzter Konsequenz die Wissenschaftlichkeit der Geisteswissenschaften zu vernichten und ihre institutionelle Gemeinschaft mit unstrittigen Wissenschaften wie den Naturwissenschaften zu unterminieren.
1.1.2.Universalität des Verstehens?
Verstehen ist nur eine von verschiedenen intellektuellen Operationen. Weder rein begriffliches Denken noch sinnliche Wahrnehmung noch Introspektion können auf es zurückgeführt werden, und insofern ist der Universalitätsanspruch, den die Hermeneutik gelegentlich bei Gadamer erhebt, abwegig.[28] Der Erfolg dieses Anspruchs läßt sich nur wissenssoziologisch, und zwar damit erklären, daß er Geisteswissenschaftlern, die weder eine mathematische Theorie beherrschen noch experimentieren können, ein Allmachtsgefühl vermittelt, das sie kompensatorisch um so mehr benötigen, als der Triumphzug von Naturwissenschaft und Technik die vergleichsweise Relevanz der Geisteswissenschaften jeden Tag sinnfällig in den Schatten stellt. Anders als die Lebenswissenschaften und die Medizin retten die Geisteswissenschaften kein Leben, anders als die Ingenieurwissenschaften helfen sie nicht bei der Erleichterung menschlicher Arbeit. Da trifft es sich günstig zu lesen, daß im Grunde alles Hermeneutik ist. Eines der Gadamerschen Argumente für diese These ist offenbar entweder ein Trugschluß oder ein Spiel mit Metaphern: «Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache. Das hermeneutische Phänomen wirft hier gleichsam seine eigene Universalität auf die Seinsverfassung des Verstandenen zurück … So reden wir ja nicht nur von einer Sprache der Kunst, sondern auch von einer Sprache der Natur, ja überhaupt von einer Sprache, die die Dinge führen.»[29] Wäre dem wörtlich so, wäre alle Wissenschaft Linguistik; doch sind Moleküle und Katzen, selbst menschliche Hormone keine Sprache, und daher ist deren Erkenntnis kein Verstehen.[30] Was sinnvollerweise gemeint sein mag, ist, daß im Prinzip alles sprachlich artikulierbar ist. Diese Proposition ist durchaus richtig – jedenfalls kann sie intersubjektiv gültig nicht widerlegt werden, weil dazu auf eine Gegeninstanz verwiesen werden müßte, und das könnte schwerlich anders als sprachlich erfolgen. Aber ebensowenig wie die Tatsache, daß ich nur das über die Welt wissen kann, was meinem Bewußtsein zugänglich ist, beweist, daß alles Bewußtsein ist, ebensowenig beweist die sprachliche Artikulierbarkeit eines Sachverhaltes dessen sprachliche Natur. Der sprachliche Idealismus ist nicht überzeugender als der Bewußtseinsidealismus, ja, noch viel weniger, weil nur ein interpretiertes Zeichensystem Sprache und weil Interpretation unweigerlich ein Akt des Bewußtseins (ggf. mehrerer Bewußtseine) ist. Zwar spricht viel dafür, daß das Reich des Bewußtseins durch die Sprache unabsehbar erweitert wurde – eine Formulierung, die die offenkundige Wahrheit voraussetzt, daß es einen vorsprachlichen Bewußtseinsstrom gibt. Aber die Tatsache, daß die Physik ohne Sprache nicht möglich wäre, bedeutet keineswegs, daß es in ihr um Sprache geht.
Kann also nur eine metaphorische Verwendung des Wortes «Sprache» die viel zu allgemeine These von der Universalität des Verstehens stützen, so ist umgekehrt Gadamers These, Verstehen korreliere mit Sprache, viel zu eng, wenn nun «Sprache» im gewöhnlichen Sinne verstanden wird. Denn auch wenn diese einen besonderen Platz in der Lehre vom Verstehen einnimmt, lassen sich alle Produkte, ja, selbst Ereignisse verstehen, in denen sich Mentales ausdrückt – ein Tempel ebenso wie eine Symphonie, ein Gruß ebenso wie ein unbeabsichtigtes Runzeln der Stirn. Nichts von alledem ist freilich Sprache im engeren Sinne des Wortes.
Und doch läßt sich angesichts der spezifisch menschlichen Weise des Lernens durchaus von einer fundamentalen Bedeutung, ja, geradezu einer Unhintergehbarkeit des Verstehens reden. Was das erste betrifft, so ist es richtig, daß eine intersubjektiv zugängliche physikalische Theorie sprachlich artikuliert und daher verständlich sein muß; zwar nicht ihr Gegenstand, aber sie selbst ist Objekt des Verstehens – sie handelt nicht von anderen Subjekten, aber sie wendet sich an solche. Insofern mag man behaupten, daß eine Theorie des Verstehens das expliziert, was jede Theorie, auch eine solche mathematischer Gebilde, präsupponiert, insofern sie für andere Subjekte konzipiert ist. Die Unhintergehbarkeit des Verstehens andererseits hat mit der Art und Weise zu tun, in der wir lernen – auch der innovativste Mathematiker und Physiker kann sich nicht mit eigenen Schlußfolgerungen und Experimenten begnügen, sondern muß von Lehrern unterrichtet werden und die Arbeit seiner Kollegen, zeitgenössischer wie solcher aus der Vergangenheit, studieren, bevor er hoffen kann, etwas Originelles hervorzubringen. Damit aber muß er Operationen des Verstehens ausüben. Ja, im Prinzip ist es denkbar, daß jemand etwa an mathematische Arbeit erstmals durch andere herangeführt wird: Er mag noch keine eigenen mathematischen Gedanken gehabt haben, bevor ihm solche durch andere vermittelt wurden. Aber es ist nicht möglich, daß jemand mit einer Theorie des Verstehens vertraut gemacht wird, der selber noch nicht in der Lage ist zu verstehen – und zwar aus dem offenkundigen Grund, daß ihm jene Theorie unzugänglich bliebe. Lernen von anderen kann nur dort erfolgen, wo Verstehen schon erlernt ist. Zwar kann Verstehen, wie wir noch sehen werden, ohne andere intellektuelle Operationen wie sinnliche Wahrnehmung gar nicht erfolgen; ich behaupte also keineswegs, daß Verstehen die einzige Operation ist, die bei einer Einführung in eine Wissenschaft vorausgesetzt wird. Aber wenn auch komplexer als sinnliche Wahrnehmung und Introspektion, ist Verstehen doch eine so grundlegende Operation, daß sie dem Lernen von anderen vorausgeht – sowohl wenn das, worüber man lernt, nichts mit anderen Subjekten zu tun hat als auch wenn der Lerngegenstand raffinierte Methoden des Verstehens sind. Daher kann dieses Buch nur hoffen, die Natur von Verstehensprozessen für Leser zu klären, die selbst schon schwierige Verstehensleistungen zu erbringen in der Lage sind. Nützlich mag es ihnen trotzdem sein, wenn es ihm gelingt, das explizit zu machen, was implizit das Verstehen der Leser immer schon leitet.
1.1.3.Die besondere Schwierigkeit, Verstehen zu erklären. Der Behaviorismus als Kurzschlußreaktion. Eine Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit des Verstehens als Ausweg aus dem Zirkel
Seit der Antike gibt es einen allgemeinen Zeichenbegriff, von dem die auf Mentales verweisenden Zeichen nur einen Sonderfall darstellen.[31] So ist der Rauch ein Zeichen von Feuer, weil aus seinem Vorhandensein auf dasjenige von Feuer geschlossen werden kann. Analog gilt dann etwa das Erröten als ein Zeichen von Schamgefühlen. Eine bedeutende Hermeneutik der Aufklärung, Georg Friedrich Meiers «Versuch einer allgemeinen Auslegungskunst» von 1757, gliedert in diesem Sinne den theoretischen Teil in «von der Auslegung überhaupt», «von der Auslegung der natürlichen Zeichen» und «von der Auslegung der willkürlichen Zeichen».[32] Nun kann man sicher Gemeinsamkeiten zwischen beiden Typen von Zeichen sehen – in beiden Fällen erlaubt die Wahrnehmung eines Vorgangs oder Gegenstands nach allgemeiner Auffassung die Erschließung eines anderen Vorgangs oder Gegenstandes. Und doch ist die Parallelisierung beider Typen von Zeichen deswegen irreführend, weil sie die entscheidende erkenntnistheoretische Differenz zu übersehen einlädt. Diese besteht in folgendem: Ich kann die Hypothese «Rauch ist ein Zeichen von Feuer» dadurch verifizieren, daß ich zum Ort des Ursprungs des Rauches hingehe und überall dort Feuer, oder wenigstens Spuren des Feuers, feststelle, wo Rauch aufgestiegen ist. Aber ich habe keinen Zugang zum Innenleben des anderen, der von Zeichen unabhängig ist.[33] Dagegen scheint der Einwand nahezuliegen: Kann ich denn nicht den errötenden Gesprächspartner fragen, ob es nicht wahr sei, daß er sich schäme? Gewiß; aber das verschiebt, ja, verschärft nur das Problem. Auch wenn die Sprache das Verständnis des anderen erleichtert, so ist doch noch viel schwieriger zu erklären, wie wir Sprache verstehen können, als wie wir das Erröten als Zeichen der Scham verstehen. Ganz unabhängig von der Möglichkeit der Lüge setzt dies in unserem Falle nämlich voraus, daß ich die Worte, die ich von meinem Gesprächspartner vernehme, mit ganz bestimmten mentalen Akten (nämlich gewissen propositionalen Einstellungen) korrelieren kann. Woher weiß ich aber erstens, daß er meine Frage überhaupt versteht? Und woher weiß ich zweitens, daß ich ihn verstehe, daß also sein «Ja» dasselbe bedeutet wie das, was ich meine, wenn ich «Ja» sage? Es ist offenbar lächerlich, hier auf allgemeine Wörterbücher zu verweisen; denn diese müssen ja selber verstanden werden, und wir brauchen zusätzlich Vertrauen, daß die Verfasser des Wörterbuches die Sprecher der Sprache richtig verstanden haben.[34] Aber eben dieses Vertrauen steht gerade auf dem Spiel. Um die Aussagen eines anderen zu verstehen, muß ich wissen, was er meint, und ich kann, so scheint es wenigstens auf den ersten Blick, nur wissen, was er meint, wenn ich seine Aussagen verstehe. Es ist dieser scheinbar unentrinnbare Zirkel, der Zeichen der Innenseite anderer von den natürlichen Zeichen unterscheidet.[35]
Es liegt nahe, angesichts dieses Zirkels zu verzweifeln, und der Behaviorismus ist eine natürliche Reaktion auf diese Verzweiflung