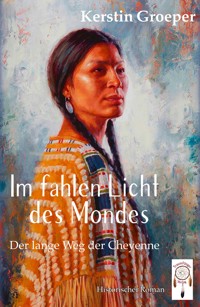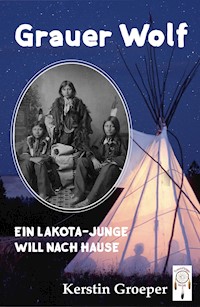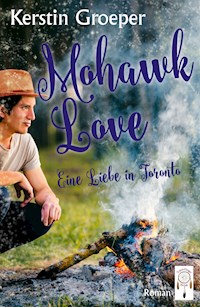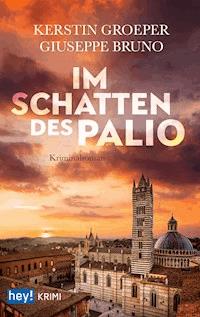4,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Pierre DuMont ist ein junger Abenteurer, der um 1809 am Yellowstone unterwegs ist, um als Voyageur sein Glück zu machen. Doch nicht nur die Wildnis ist ein unbarmherziger Gegner, sondern vor allen Dingen feindliche Indianerstämme machen ihm und seinen Freunden das Leben schwer. Er heiratet die Mandan-Indianerin Mato-wea, um eine Lebensversicherung in der Wildnis zu haben. Es ist eine Zweckehe auf Zeit, denn selbstverständlich möchte er bei seiner Rückkehr nach St. Louis eine ehrbare weiße Frau heiraten. Als die kleine Claire geboren wird, kommen ihm Zweifel an seiner reichlich pragmatischen Einstellung, denn er muss zugeben, dass ihm weit mehr an Mato-wea und der kleinen Tochter liegt, als er vorgesehen hatte. Als Blackfeet den Posten überfallen, gerät sein Leben außer Kontrolle. Eine spannende Geschichte aus der Zeit des Pelzhandels am Oberen Missouri – erzählt aus drei Blickwinkeln: dem französischen Trapper Pierre DuMont, seiner indianischen Frau Mato-wea und Wambli-luta – einem selbstbewussten und gefährlichen Lakota-Krieger. Auch Wambli-luta und Mato-wea verbindet das Schicksal, denn bei einem Angriff auf das Dorf der Mandan hatte er ihr Leben verschont und glaubt seitdem an eine Fügung der Geister. Die Lebenspfade der drei Personen verknüpfen sich auf abenteuerliche Weise. weniger anzeigen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Im Eissturm der Amsel
Historischer RomanvonKerstin Groeper
Impressum
Im Eissturm der Amsel, Kerstin Groeper
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2020
1. Auflage eBook Mai 2021
eBook ISBN 978-3-941485-97-6
Lektorat: Michael Krämer
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: Bookwire
Titelbild: James Ayers
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG,Hohenthann
Printed in Germany
Inhalt
Fort Raymond
Mato-wea
Wambli-luta
Yellowstone
Ree
Fort Lisa
Sheheke shote
Rache
Missouri
Pär
Apsalooke
Three Forks
Dachbitche-hisshi
Marie Dorion
Slim Buttes
Anpao-win
Claire
Ree
Bighorn-Berge
Blackfeet
Kriegszug
Plains
Flucht
Kanghi-win
Mato-win
Frieden
Tetschichila
St. Louis
Beglichene Schulden
Konflikte
Sonnentanz
Sacajawea
Hemdträger
Omaha
Verbündete
Louise
Dakota
Fort Shelby
Prairie du Chien
Begegnungen
Epilog
Nachwort
Fort Raymond
Louisiana Territorium im Winter 1808/1809
Pierre DuMont lag in seinem Versteck zwischen den tiefhängenden Ästen einer Fichte und beobachtete die beiden Indianer, die ganz in seiner Nähe vorbeischlichen. Er sah schwarz und rot bemalte Gesichter, Hauben mit hoch aufgerichteten Adlerfedern und nach unten hängenden Hermelinstreifen, hemdenähnliche einfache Gewänder mit langen Fransen und griffbereite Waffen. Sie hatten ihre Bisonroben abgelegt, um für den Kampf beweglicher zu sein. Pekuni! Er wusste, dass sie – verteufelt noch mal – etwas gegen seine Anwesenheit hier hatten. Die Pekuni waren erbitterte Feinde der Trapper oder auch Waldläufer, die es wagten, den Missouri entlang in ihre Jagdgründe vorzustoßen. Pierre zog ein Tuch vor seinen Mund, damit die Rothäute nicht die Atemwölkchen sahen, die in der klirrenden Kälte von seiner Nase aufstiegen. Zur Sicherheit nahm er Schnee in den Mund, um den Atem zu kühlen. In den Händen hielt er sein Gewehr. Es war geladen, aber Pierre wusste, dass allein das Klicken, wenn er den Hahn spannte, in der Wildnis weit zu hören sein würde. Obwohl die Kälte langsam in seine Glieder kroch, sammelte sich auf seiner Stirn der Schweiß. Mit einer langsamen Bewegung schob er die Biberfellmütze etwas nach oben und wischte sich die Stirn trocken. Er konnte unmöglich einen genauen Schuss abfeuern, wenn ihm der Schweiß in die Augen lief. Sein braunes lockiges Haar klebte am Haaransatz und juckte unangenehm. Eine Schweißperle lief an der Nase entlang und sammelte sich an seinem gestutzten Oberlippenbart. Mit seiner Zunge leckte er sie weg, mehr Bewegung wagte er nicht. Die beiden Indianer unterhielten sich leise in ihrer Sprache und folgten einem Pfad zum Ufer des schmalen Baches. Pierre atmete tief durch. Dort hatte er noch keine Spuren hinterlassen! Er war über den Hügel gekommen und hatte den Bach, eigentlich ein kleiner Nebenarm des breiten Yellowstone-Flusses, noch nicht erreicht. Das war vielleicht sein Glück, denn im Schnee konnte man seine Spuren nicht verwischen. Unter der Fichte lag kaum Schnee, sodass die ledernen Leggins und der warme Mantel aus dem Wollstoff der Hudson‘s Bay Company ihn etwas vor dem Frost schützten, der vom Boden aufstieg. Der Mantel war weiß und hatte im unteren Bereich und an den Ärmeln einen breiten roten Streifen. Er hatte ihn von einem französischen Trapper eingetauscht, der sonst weiter im Norden Handel mit den Assiniboine trieb. Im Moment wurden der untere Streifen verdeckt, weil er auf ihm lag, aber die Ärmel hätten ihn verraten können. Er hielt die Arme tief und hoffte, dass die Injuns das Rot nicht sahen. Mit seinen dunkelbraunen Augen beobachtete er die Indianer, dabei flogen seine Gedanken. Als fast mittelloser Sohn eines französischen Farmers in St. Louis hatte er mit sechzehn die Chance ergriffen, sich einer Brigade Trapper anzuschließen. Anfangs war ihm alles wie ein großes Abenteuer erschienen, doch das Leben hatte ihm gezeigt, dass das Fallenstellen seine Tücken hatte: Indianer und unberechenbare Wildnis. Inzwischen war er vierundzwanzig, und irgendwie hatte er noch immer keine Reichtümer ansammeln können. Er war ein Voyageur, ein Angestellter, der vertragsmäßig für einen Pelzhandelsposten arbeitete. Dieses Mal war er von Manuel Lisa, einem spanischen Bourgeois, wie die Bosse genannt wurden, angeheuert worden, der den Pelzhandel am Oberen Missouri etablieren wollte. Lisa finanzierte das Unternehmen und hatte Voyageure, Führer, aber auch erfahrene Soldaten angeworben, um in der Wildnis Handelsposten zu errichten. Der Pelzhandel brachte viel ein! Pierre schickte das meiste Geld seinen Eltern, die inzwischen außerhalb von St. Louis eine größere Farm bewirtschafteten, die er mal übernehmen sollte. Im Moment hoffte er nur, dass er hier lebend wieder rauskam. Vielleicht hätte er doch auf seine Mutter hören sollen, die ihn gebeten hatte, endlich sesshaft zu werden.
Die Stimmen kamen wieder näher, und Pierre wusste, dass er dem Kampf nicht ausweichen konnte. Mit seiner Hand tastete er an die Seite seines Gürtels und zog das Beil hervor. Er hatte vielleicht noch den Vorteil der Überraschung! Er legte das Beil griffbereit und schob vorsichtig das Gewehr an seine Schulter. Wenn er mit dem ersten Schuss traf, hätte er gegen den zweiten Mann eine Chance. Zum Laden der Pistole blieb keine Zeit mehr. Jede weitere Bewegung, jedes Aufblitzen des Metalls oder Spannen würde ihn nur verraten. Merde! Wo kamen die beiden überhaupt her? Waren vielleicht noch mehr Rothäute in der Umgebung? Dann stand es schlecht um ihn. Die Pekuni waren nicht zimperlich, wenn sie einen weißen Trapper erwischten. Oft genug wurde aus den armen Kerlen Wolfsfutter gemacht. Pierre knirschte mit den Zähnen, als er kurz die Lage einschätzte. War das Pulver trocken? Würde das Gewehr schießen? Bisher hatte er sich auf seine „Dicky“, wie er seine Dickert Rifle liebevoll nannte, verlassen können. Es regnete nicht, und es blies auch kein heftiger Wind, der den Schuss hätte beeinflussen können. Die Waffe war in gutem Zustand. Er brauchte nur ein wenig Glück!
Die beiden Indianer näherten sich langsam den Fichten, unter denen Pierre in Deckung gegangen war. Spätestens jetzt würden sie seine Spuren sehen! Er wusste, dass der Moment der Überraschung gleich vorbei wäre. Mit einem Satz richtete er sich in eine kniende Stellung auf, spannte den Hahn und drückte den Abzug. Der Hahn schlug auf die Pfanne, Funken stoben und in die Stille dröhnte ein ohrenbetäubender Knall. Rauch stieg auf, und für einen winzigen Moment konnte Pierre nichts mehr erkennen. Er ließ das Gewehr fallen, das ihm nun nichts mehr nützte, griff nach dem Beil, rollte sich zur Seite und sprang auf. Erst jetzt konnte er erkennen, dass er einen der Indianer getroffen hatte. Stöhnend wälzte sich dieser im Schnee, während der andere überrascht, aber durchaus schnell, zu seinen Waffen griff. Auch er hatte ein Gewehr in den Händen, das er nun zum Schuss anhob. Pierre hechtete zur Seite, fühlte einen Luftzug an seinem Kopf, dann rollte bereits das Echo des zweiten Schusses durch das Tal. Ehe der Indianer zum Denken kam, ging Pierre mit erhobenen Beil auf ihn los. Rücksichtslos hieb er auf den Kopf des Mannes ein und spaltete ihm den Schädel. Blut spritzte in den Schnee und traf auch Pierre, der mitleidlos zusah, wie der Mann zusammenbrach. Das Beil steckte so fest, dass er es stecken ließ und lieber seinen Dolch zog. Mit gezückter Klinge ging er zu dem verletzten Indianer, setzte ihm das blanke Metall an die Kehle und schnitt sie durch. Der Mann gurgelte und fasste sich mit den Händen an den Hals, während sein Blick die Augen von Pierre traf. Er erwartete kein Mitleid, so wie er selbst kein Mitleid empfunden hätte. Der weiße Trapper hatte ihm den Tod gebracht. Seine Augen brachen, als der Körper kraftlos in den Schnee sackte.
Pierre richtete sich auf, zog das Tuch von seinem Mund und atmete tief durch. Sein Blut rauschte, und er hörte das Herz in seiner Brust pochen. Kurz ließ er seinen Blick durch das Tal schweifen, doch bis auf ein paar aufgeschreckte Krähen blieb es still. Er wartete, bis die schwarzen Vögel sich wieder in den Wipfeln der Bäume niedergelassen hatten, dann sammelte er seine Waffen ein und wischte das Blut ab. Er nahm sich die Zeit, sein Gewehr nachzuladen, ehe er sich den beiden Körpern zuwandte, die regungslos im Schnee lagen. Dieses Mal zog er sein Messer und nahm ihnen die Skalpe. Dann schleifte er die Körper unter die Zweige der Fichten, brach einige Äste ab und legte sie über die Leichen. Wolfsfutter!
Zufrieden barg er das Gewehr des Indianers und sammelte die anderen Habseligkeiten ein. Er fand einen Köcher mit Pfeilen und einem Bogen, zwei schöne Messerscheiden samt Messern, Proviantbeutel und eine kleine Tasche mit Munition. Kaltblütig kehrte er zu den Leichen zurück und holte sich noch das Pulverhorn des einen Mannes. Er konnte sich Verschwendung nicht leisten. Dann überlegte er, wie die beiden hierhergekommen waren. Vielleicht fand er Pferde, wenn er die Spuren zurückverfolgte? Er musste vorsichtig sein, denn die alte Regel hieß: Wo ein Indianer war, konnten die anderen nicht weit sein!
Wachsam machte er sich an die Verfolgung der Spuren. Es beunruhigte ihn, dass die Rothäute aus der Richtung des Forts gekommen waren. Es stand an der Mündung des Bighorn in den Yellowstone-Fluss, wo es von Manuel Lisa, erbaut worden war. Sie trieben dort Handel mit den Apsalooke, den Crow-Indianern, die den Weißen gegenüber wohlgesonnen waren, doch die Pekuni-Blackfeet machten ihnen das Leben schwer. Sie hatten schon mehrmals das Fort angegriffen und lauerten den Trappern auf, die in der einsamen Wildnis ihre Fallen aufstellten. Lisa zahlte die Männer nicht schlecht, wobei ein großer Teil des Verdienstes dazu verwendet wurde, die Schulden zu tilgen und neue Ausrüstung zu überhöhten Preisen einzukaufen. Pierre liebte das Abenteuer, aber irgendwann wollte er als gemachter Mann in die Zivilisation zurückkehren. Auf jeden Fall wollte er sich nicht von Indianern massakrieren lassen. Es war nur eine Gruppe von dreißig Männern über den Winter im Fort geblieben. Doch nach den vielen Angriffen waren die Männer mürbe geworden und hofften auf die Verstärkung im Frühjahr.
Vorsichtig stapfte Pierre durch den Schnee und fluchte über die Schneeverwehungen, die manchmal über ruhendem Wasser lagen, sodass man plötzlich in eiskaltes Wasser trat. Das war gut für die Jagd, weil man Biber nur jagen konnte, solange die Flüsse nicht zugefroren waren, aber schlecht für die Ausrüstung. Es dauerte ewig, Stiefel oder gefütterte Mokassins zu trocknen. Der Blick über das Tal war frei, und Pierre erkannte, dass die beiden Indianer wohl allein gekommen waren. Er fand auch keine weiteren Spuren. Er selbst musste sich darüber keine Gedanken mehr machen, denn die Lage des Forts war bekannt. Es hatte keinen Sinn, etwa zu verbergen, was alle Welt inzwischen kannte. Abgesehen davon, dass das Fort ja gerade diesen Zweck hatte: mit den hiesigen Indianern Handel zu treiben. Pierre verließ die Spur, die die Pekuni hinterlassen hatten, und kürzte den Weg zum Fort ab. Aus der Ferne war leichtes Donnergrollen zu hören, ganz wie ein entferntes Gewitter, doch Pierre wusste, dass es sich um Gewehrfeuer handelte. Das Fort lag unter Beschuss!
Er hastete über den sanften Hügel und warf sich zu Boden, um sich einen Überblick zu verschaffen. Der Handelsposten, auch Factory genannt, lag in einer Biegung des Bighorn-Flusses, kurz ehe er in den Yellowstone mündete. Auf einigen sanften Anhöhen wuchsen dunkle Fichten, doch im weiteren Umkreis um die Gebäude bis zum Ufer des Flusses standen nur wenige dürre Laubbäume, deren kahle Zweige sich gespenstisch in den Himmel erhoben. Der Handelsposten stand somit auf der großen Lichtung, die durch das Abholzen der Bäume zum Bau der Gebäude und Palisaden entstanden war. Ein größeres Gebäude diente als Handelsraum; die anderen Hütten waren für die Trapper und Händler bestimmt. Die Lage war günstig, weil der Posten von fast drei Seiten durch den Fluss geschützt war, der sich dort wie eine Schlange durch das Land wand. Jetzt stieg Qualm aus den Schießscharten der Palisade auf, hinter der sich die Bewohner dem Kampf stellten. Pierre schätzte, dass vielleicht zwanzig Indianer mit wütenden Kriegsrufen gegen das Fort zogen. Er brauchte kein Fachmann zu sein, um sie als Pekuni zu identifizieren. Merde! Er fluchte leise vor sich hin.
Pierre überlegte, wie er seine Kumpel unterstützen konnte, ohne dass er selbst in Gefahr geriet. Er blickte auf die Gewehre und grinste. Beide waren Waffen für die Jagd und daher gut geeignet, Schüsse aus der Distanz abzugeben. Problematisch war nur, dass er seine Position verriet, sobald er schoss. Außerdem kannte er die erbeutete Waffe nicht. Sie hatte einen kürzeren Lauf als seine Rifle und schien neuwertig zu sein. Wahrscheinlich hatte dieser Sous-Merde, dieser Haufen Scheiße, wie er die Hudson‘s Bay Company im Norden verächtlich nannte, die Stämme mit neuen Waffen ausgestattet und sie gegen die Amerikaner aufgehetzt. Seit die Amerikaner das Louisiana Territorium und somit auch den Oberlauf des Missouri von den Franzosen abgekauft hatten, schien sich die britische Regierung nicht damit abfinden zu können, dass sich hier nun amerikanische Händler niederließen.
Pierre musterte kurz das neue Gewehr. Wahrscheinlich würde es zuverlässig schießen; nur die Treffsicherheit wäre fraglich. Aber mit seiner Pistole käme ein weiteres Überraschungsmoment hinzu. Pierre hatte wenig Lust, ein zweites Mal an diesem Tag einen Kampf durchzustehen, aber er konnte seine Freunde auch nicht im Stich lassen. Wenn die Männer im Fort Unterstützung von außerhalb bekamen, würde das die Angreifer verwirren. Außerdem konnten diese nicht wissen, um wie viele Männer es sich handelte. Wenn er die Position wechselte, dann würden sie glauben, dass mehrere Trapper zurückkamen, um ihren Freunden zu helfen. Methodisch prüfte Pierre die beiden Gewehre, lud die Pistole und schaute sich dann das Gelände an, um zu entscheiden, wo er verschwinden und wieder zuschlagen würde. Die Gegend war zerklüftet und bot ausreichend Möglichkeiten, um unterzutauchen. Leider lag Schnee, sodass man seine Bewegungen nachverfolgen konnte. Das musste er einkalkulieren. Wieder war Gewehrfeuer zu hören, und die Indianer antworteten mit wütendem Gebrüll. Pierre konnte sehen, wie sie sich im Schutz einiger Felsen und größerer Steine der Palisade näherten. Sie griffen nicht blindlings an, sondern nutzten geschickt die Deckung des Geländes.
Auch Pierre näherte sich dem Fort, um eine bessere Schussposition zu haben. Er wählte eine kleine Anhöhe, kroch dort unter die Fichten und suchte sich sein Ziel. Geduldig wartete er auf die beste Möglichkeit: einen Krieger, der hinter einem Stein hockte und sich nicht bewegte. Pierre zielte auf den Körper, weil der das größte Ziel bot. Der Schuss wäre vielleicht nicht tödlich, würde den Mann aber kampfunfähig machen. Der Oberkörper war nackt und dick mit Fett eingeschmiert, um für den Kampf mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Der Knall des Schusses rollte über das Tal, und der Mann sackte zusammen. Pierre wartete nicht ab, ob und wie schwer er den Mann getroffen hatte. Flink rutschte er außer Sichtweite, rannte im Windschatten der Felsen in südöstlicher Richtung – froh darum, dass hier nicht viel Schnee lag – und stürzte sich dann schnaufend unter einige Fichten. Vorsichtig kroch er bis an den Rand der Anhöhe und besah sich den Schaden, den er angerichtet hatte.
Wagh! Drei Indianer bewegten sich auf die Stelle zu, wo der Pulverdampf immer noch in der Luft schwebte. Je näher sie kamen, desto deutlicher waren ihre Gesichter zu erkennen: Männer mit grimmigen Mienen, die unter der schwarzen und roten Kriegsbemalung noch furchterregender wirkten. Auch sie hatten die Kleidung abgelegt und sich mit Fett eingeschmiert; ob noch mehr Indianer in der unmittelbaren Nähe waren, konnte er nicht erkennen. Dazu blieb auch keine Zeit, denn die Krieger hatten den Platz erreicht, erkannten, dass er verlassen war und machten sich auf die Suche nach dem Feind. Im Tal ging der Angriff indessen weiter: Zwei Krieger versuchten die Palisade zu überwinden, doch ein Pistolenschuss verhinderte dies im letzten Moment. Einer der Krieger stürzte innerhalb der Palisade stöhnend zu Boden, während der andere die Flucht ergriff. Von drinnen war triumphierendes Geschrei zu hören – dann krachte ein weiterer Schuss, und alle wussten, was dies zu bedeuten hatte. Die Blackfeet schrien wütend, während die Stimmen hinter den Palisaden nun zuversichtlicher wurden. „Hey, ihr Rothäute! Kommt nur her, wenn ihr euch traut!“
Pierre grinste schief, als er dies hörte. Anscheinend funktionierte sein Ablenkungsmanöver. Vorsichtig schob er sich an den Fichten entlang und wartete auf den nächsten Feind. Er hatte sein Gewehr inzwischen nachgeladen, sodass ihm wieder drei Schüsse zur Verfügung standen. Die Chancen standen nicht schlecht. Aus der sicheren Deckung nahm er den ersten Krieger, der witternd wie ein Wolf seiner Spur folgte, ins Visier. Er zögerte keine Sekunde, sondern schoss, sobald er freie Sicht hatte. Der Krieger griff sich erschrocken an die Brust und stürzte dann nach vorn. Die beiden anderen Krieger gingen sofort zum Angriff über. Wahrscheinlich dachten sie, dass der weiße Mann nun Zeit brauchte, um sein Gewehr zu laden. Weit gefehlt! Pierre riss das andere Gewehr hoch, zielte und schoss.
Die Kugel pfiff an dem Angreifer vorbei, der jedoch völlig verwirrt war und kurz inne hielt. Pierre fackelte nicht lange. Er ließ das Gewehr fallen, riss die Pistole hoch und gab einen zweiten Schuss auf den Mann ab. Dieses Mal traf er ihn in den Kopf. Das Gesicht platzte auf, und der Mann wurde durch den Schuss rückwärts zu Boden geworfen. Der dritte Mann hechtete zur Seite und entschloss sich zur Flucht. Ein Mann, der dreimal schießen konnte, war ihm wohl zu gefährlich. Pierre wechselte sofort seine Position und rannte geduckt zur nächsten Anhöhe. Wachsam sah er sich um, dann kniete er sich hin und lud seine Waffen nach. Der Schweiß lief ihm den Rücken hinunter und tropfte von seiner Stirn. Er nahm die Mütze ab, wischte sich die Stirn trocken und wechselte wieder die Position. Im Dauerlauf umrundete er einen kleinen Hügel und ging dann hinter zwei Birkenstämmen in Deckung. Wieder legte er seine Rifle an und wartete in Ruhe ab. Er war im Vorteil, denn er bestimmte, wo der Kampf ausgetragen wurde. Dann wurde es ruhig. Weder vom Fort noch aus der näheren Umgebung waren irgendwelche Geräusche zu hören. Am Himmel kreisten ein paar Krähen, ließen sich dann auf einigen kahlen Ästen nieder und stießen ihre krächzenden Rufe aus.
Pierre DuMont wartete gute zwanzig Minuten, dann wagte er sein Glück: Im Dauerlauf rannte er einen Pfad entlang in Richtung des Forts, rief schon von weitem, dass er ein Freund sei, und änderte dann seinen Lauf in einen Zickzackkurs. „Ami, Ami!“, rief er mit überschnappender Stimme. „Ouvrez la porte!“
Keuchend erreichte er das Tor, das sich einen Spalt breit öffnete, und quetschte sich hindurch. Sein zweites Gewehr blieb hängen, doch eine Hand griff danach und zerrte es ebenfalls hindurch, während zwei andere Hände ihn packten, nach innen zogen und ihn sofort aus dem Schussfeld in Sicherheit hinter dem Palisadenzaun schubsten.
„Êtes-vous complètement dans l‘erreur? “ – Bist du völlig irre? Pierre blickte in die wütenden Augen von Louis, einem der französischen Trapper im Fort. Dann fing er aus vollem Hals an zu lachen. „Aber nein …!“, keuchte er nach Atem schnappend. „Ich glaube, die Injuns sind weg! Habe bestimmt vier von denen erwischt. Die sind über alle Berge!“
„Vraiment?“ Louis drehte sich zu den anderen Männern um und winkte ihnen zu. „Les Indians sont partis!“
Aus mehreren Ecken des Forts schauten ein paar Gesichter hervor, doch eine scharfe Stimme hielt sie zurück. „Jeder bleibt auf seinem Posten! Kann auch eine Finte sein!“ Es war „Colonel“ Menard, ein erfahrener Trapper und gleichzeitig unangefochtener Anführer, solange der Boss nicht da war. Er sprach die Sprache der Apsalooke und war somit von unschätzbarem Wert. Er war als „Guide“, als Führer, angeheuert worden, da er die Gegend von früheren Expeditionen her kannte. Vom Aussehen unterschieden sich die Männer kaum. Gleichgültig, welchen Rang sie bekleideten, trugen alle indianische Leggins, gefütterte Mokassins oder Stiefel und die warmen Mäntel der Hudson‘s-Bay-Company. Ihre Köpfe waren entweder mit roten Wollmützen oder Biberfellmützen bedeckt, und alle hielten ihre Rifles schussbereit in den Händen. Die Männer waren meist zwischen zwanzig und dreißig Jahre alt, doch das Leben in der Wildnis hatte sich bereits in die Gesichtszüge eingebrannt. Einige trugen kurze Bärte, die anderen hatten kurze Stoppeln, was auf ein regelmäßiges Rasieren hindeutete. Das war auch besser so, denn gegen Nissen und Läuse gab es nur ein Mittel: Haare und Bärte abschneiden.
Pierre richtete sich auf und atmete tief durch. „Mann, das war knapp!“ Er sprach „Bungee“, ein Gemisch aus Französisch, Englisch und Spanisch, das hier alle verstanden. Wenn nichts mehr half, dann wechselte man in die Zeichensprache der Indianer. Mit Händen und Füßen konnte man irgendwie alles ausdrücken.
„Bist du sicher, dass die Injuns weg sind?“, vergewisserte sich Arnel, ein junger Trapper mit hellbraunen Augen, die in dem braungebrannten Gesicht deutlich hervorstachen. Er war ein Halbblut und so wurde er wegen seiner Kenntnisse als „Guide“ oder als einfacher Engagé, als angeheuerter Arbeiter, eingesetzt.
„Ich glaube schon. Ich habe zwei in den Hügeln erwischt und zwei weitere hinten am Yellowstone. Sie waren wohl auch auf dem Weg hierher.“ Pierre zuckte gelassen mit den Schultern. „Was ist denn in die gefahren? Wollen die Pekuni keinen Handel?“
Menard näherte sich und stemmte die Hände in die Hüften. „So ein Scheiß! Mit jedem Toten wird es schwieriger, die Factory zu halten!“
Pierre schnaufte empört. „Was soll ich denn machen, wenn ich angegriffen werde?“
Menard hob begütigend die Hände. „War kein Vorwurf! Hier haben diese miesen Blackfeet ja auch angegriffen! Einfach so …! Zum Glück hatten wir Wachen aufgestellt, sonst wären sie im Fort gewesen, ohne dass wir etwas gemerkt hätten. Augen auf und Kehle durch …!“
Pierre nickte betreten. Sie hatten Glück gehabt! Immer wieder hatten die Männer gemurrt, wenn Menard auf den Wachdienst bestanden hatte.
„Hier ist doch alles friedlich!“, hatte es geheißen. Doch Menard traute dem Frieden nicht. Er hatte schon öfter erlebt, dass Verbündete plötzlich die Seiten wechselten oder Freunde über Nacht zu Feinden wurden. „Injuns kann man nicht trauen!“
Menard grinste freundlich und schlug Pierre auf die Schulter. „Komm erst einmal ins Warme! Du musst ja halb erfroren sein!“
Pierre nickte ergeben. „Eher verschwitzt. Puh, das war knapp. Mon dieu!“
Er ließ sich zum großen Handelsraum führen, der wie immer beheizt war. Ein Mann stand am Feuer und bereitete das Essen zu. Er war der Einzige, der nicht an der Palisade gekämpft hatte – wohl auch, um ein mögliches Feuer zu melden, falls die Indianer Brandpfeile schossen.
Menard deutete auf die Haare von Pierre, die über dem Ohr etwas versengt waren. „Was ist denn hier passiert?“
Pierre fasste sich an die Schläfe und riss erstaunt die Augen auf. „Wagh, das war aber knapp! Da hätte mich die Rothaut fast erwischt!“ Dann schaute er an seinen blutbefleckten Mantel hinunter. „Merde, den muss ich wohl waschen!“
Der Koch schüttelte den Kopf. „Die Flecken kriegst du nicht mehr raus. Brauchst wohl einen neuen!“
„Mist!“ Pierre blickte enttäuscht an sich herunter. Er hätte doch die Mäntel der Pekuni mitnehmen sollen. Aber da waren ja auch Blutflecken dran. „Ich versuch’s trotzdem!“, meinte er entschlossen.
„Nimm kaltes Wasser“, schlug der Koch vor und grinste breit. Das braune Gesicht seiner wohl spanischen Herkunft wirkte wie ein lederner Ball, der zu lange in Wind und Wetter gelegen hatte. „Ist ohnehin egal … dein Mantel steht vor Dreck, und du sorgst dich um ein paar Blutflecken!“
Pierre lächelte freundlich. „Hast du jetzt endlich was zu essen für mich?“
„Klar!“ Der Koch schöpfte eine große Schüssel Eintopf aus dem Kessel und stellte sie Pierre vor die Nase. „Bon Appetit!“
„Merci!“, knurrte Pierre dankbar. Dann schlürfte er die heiße Suppe von einem Löffel, der auch gut als Schöpflöffel hätte durchgehen können. Mit etwas Warmem im Bauch sah die Welt schon wieder besser aus.
Nach dem Essen verließ Pierre das Fort und half den anderen beim Aufräumen. Sie suchten nach toten Indianern, doch die Indianer hatten ihre Toten geborgen und mitgenommen. Pierre fand seine Biberfellmütze und setzte sie mit einem Seufzen auf. Die Stelle, wo seine Haare versengt worden waren, juckte leicht, und er kratzte sich. Dann kehrte er ins Fort zurück und versuchte die Flecken zu entfernen. Er war da ein bisschen heikel … es war nicht sein eigenes Blut, und er ekelte sich davor. Bei Tieren machte es ihm nichts aus … aber bei Menschen. Geduldig weichte er die blutbefleckten Stellen seines Mantels in Wasser ein und rubbelte das Blut heraus. Es ging ganz gut. Bis auf ein paar leicht bräunliche Flecken war nichts mehr zu sehen. Pierre hängte den Mantel in der Nähe des Feuers auf und ging dann in den hinteren Raum, wo mehrere Betten standen. Auch hier stand ein kleiner Ofen, der den Raum notdürftig wärmte. Aber es war besser als nichts. An den Wänden glitzerten die Tautropfen, die zeigten, dass der Frost sogar die Innenwand erreicht hatte. Der Raum war dunkel und rauchig, und es roch nach feuchtem Leder und den Ausdünstungen der Männer. Wer hier lebte, hatte keine Ansprüche. Die anderen Hütten standen im Moment leer, weil es einfacher war, nur das Haupthaus zu beheizen. Manche Trapper blieben ohnehin in der Wildnis bei ihren kleinen Hütten oder Zelten, weil sie ihre Fallen nicht alleine lassen wollten. Manche waren so weit weg, dass es zu viel Zeit kostete, jeden Abend ins Fort zurückzukehren. Pierre warf sich auf eine Pritsche und dachte an die armen Teufel, die jetzt vielleicht allein in der Wildnis saßen und keine Ahnung hatten, dass kriegerische Pekuni unterwegs waren.
Neben ihm lag Arnel, der sich auf den Ellbogen stützte. „So ein Mist! Was machen wir, wenn noch mehr solche kriegerische Injuns hier auftauchen?“ Seine braunen Augen richteten sich sorgenvoll auf seinen Freund. Er hatte immer noch die schlaksige Figur eines Jugendlichen und wirkte naiv und unerfahren. Er strich sich eine Strähne seines schwarzen Haars, das bis auf seine Schultern fiel, nach hinten.
Pierre runzelte die Stirn. „Keine Ahnung! Als Lewis und Clark hier unterwegs waren, dachten sie eigentlich, dass man hier friedlich Handel treiben kann. Ich weiß auch nicht, warum diese Pekuni so aufgebracht sind. Jedenfalls möchte ich ihnen nicht lebend in die Hände fallen.“
„Oje!“ Arnel schluckte schwer. Er war ein Abenteurer, ein Tausendsassa, der schon mit vierzehn Jahren von seinem Zuhause ausgebüxt war. Hier bei den Trappern hatte er gefunden, was er schon immer gesucht hatte: eine freie Gemeinschaft, die keine Fragen stellte, welche Herkunft jemand hatte. Arnel war ein Halbblut, und in zivilisierteren Gegenden war das ein Makel. Seine Mutter war eine Dakota-Frau der Yankton gewesen. Sie war früh gestorben, und so war Arnel mit seinem Vater, einem trunksüchtigen Händler, unterwegs gewesen, der den Jungen hart arbeiten ließ. Irgendwann hatte Arnel die Beschimpfungen und Misshandlungen nicht mehr ausgehalten und war bei Nacht und Nebel verschwunden. Trotz seiner Jugend war er bereits ein geschickter Jäger, und so war er von den Pelzhändlern aufgenommen worden. Pierre hatte ihn unter seine Fittiche genommen, wobei die Beziehung auch für ihn Vorteile hatte: Durch Arnel sprach er inzwischen ein ganz passables Englisch.
Mato-wea
Dorf der Mandan am Knife-Fluss
Mato-wea, was Bärenfrau bedeutete, stand außerhalb der Palisaden ihres Dorfes und besuchte den heiligen Schädelkreis ihrer Vorfahren. Irgendwo hier lagen auch die Schädel ihrer Mutter und ihres Vaters, aber die waren schon vor einiger Zeit gestorben, sodass die Erinnerung an sie verblasste. Ihr Vater war vor zwei Wintern gestorben und so, wie es Sitte war, von den männlichen Angehörigen der Sippe aufgebahrt worden. Inzwischen war das Gerüst verfallen, der Körper verwest, und man hatte den Schädel in den Kreis der Ahnen gelegt. Der Schädelkreis war heilig, und sie wagte sich dort nicht hin. Aber es war schön, in der Nähe zu stehen und seine Gedanken an die „Große Alte“ zu schicken. Sie wickelte das Bisonfell fester um ihren schmalen Leib und trotzte dem eisigen Wind, der um die Palisaden pfiff. „Große Alte!“, murmelte sie liebevoll. „Ich muss dir etwas erzählen.“
So begann sie stets das Gespräch mit den Geistern. Hier konnte sie all ihre Sorgen und geheimen Gedanken hintragen. „Ich bin zur Frau gereift, und Onkel wird nun einen guten Mann für mich suchen.“ Sie seufzte tief, und nur der Wind konnte ahnen, ob aus Sorge oder Vorfreude. Mato-wea knabberte an ihren Lippen. War sie schon bereit für einen Mann? Zu gerne erinnerte sie sich an das Gelächter, wenn sie von den anderen Mädchen mit dem Bisonfell hochgeworfen wurde. Sie war gut darin! Zehnmal war es ihr gelungen, das Gleichgewicht zu halten. Sie kicherte bei dieser Erinnerung. Es hatte so viel Spaß gemacht, mit ihren Freundinnen das alte Spiel zu spielen: Die Mädchen nahmen ein großes Bisonfell, schoben stabile Äste durch die Löcher, die entstanden, wenn man das Fell zum Gerben spannte, und erhielten so einfache Griffe. Die Mädchen hielten das Fell an den Griffen, ein Mädchen kletterte hinauf und wurde von den anderen Mädchen hochgeworfen. Wenn sie mit den Füßen aufkam, wurde sie wieder hochgefedert. Wenn sie stürzte, wurde sie von dem weichen Fell und einen riesigen Haufen Gras, der darunter aufgeschüttet worden war, weich aufgefangen. Es gab immer viel Gelächter, wenn die Mädchen „Hochwerfen“ spielten. Mato-wea hatte damals schon die langen Zöpfe gehabt, und nicht mehr die kurze Frisur mit den beiden Büscheln über den Ohren, die kleine Kinder vor Gefahren schützen sollte.
„Große Alte, bin ich denn schon bereit? Onkel sagt, dass ich ein gutes Mädchen bin und ein Ehemann bestimmt Gefallen an mir finden wird.“ Sie senkte den Blick und bohrte mit dem Mokassin im weichen Pulverschnee, der sich über das Land gelegt hatte. „Onkel ist sehr gut zu mir“, fuhr sie fort. „Und Tante auch …! Aber sie wollen mich vielleicht einem dieser Trapper zur Frau geben. Onkel möchte eine dieser Donnerwaffen haben.“
Sie zögerte, denn sie wollte nicht ungehorsam sein. „Onkel sagt, dass die weißen Männer sehr großzügig zu ihren Frauen sind. Ich könnte froh sein, wenn ich so eine wichtige Aufgabe bekomme. Der Handel mit den Weißen ist wichtig.“
Sie warf einen Blick zum Dorf zurück und senkte dann ihre Stimme zu einem Flüstern. „Aber ich kenne doch die Weißen nicht. Was, wenn ich ihre Sprache nicht spreche? Oder wenn sie böse Geister mitbringen? Die Älteren reden noch von der Zeit, als so viele Menschen wegen einer geheimnisvollen Krankheit gehen mussten. Was, wenn diese Weißen wieder Tod und Verderben bringen? Darf ich diese Sorgen mit meinem Onkel teilen?“
Hoffnungsvoll blickte sie in den Himmel, doch sie konnte kein Zeichen erkennen. Langsam hob sie die Hände und streckte sie der „Alten Frau“ entgegen. „Wache über mich! Lass mich bereit und eine gute Ehefrau sein!“
Sie erhob sich und lief wieder zum Dorf zurück. Sie huschte durch das Tor und wandte sich dem Erdhaus zu, in dem ihre Sippe lebte. Vor dem Eingang hing ein schweres Fell, das sie beiseiteschob, um durch den engen Eingangstunnel ins Innere zu treten. Das Erdhaus war aus vier starken Stützpfosten errichtet, auf denen weitere Balken das Gerüst stellten. Gedeckt war die Hütte aus Ästen und Zweigen, auf denen Schichten von Grassoden und Erde verteilt wurden. Das schützte vor Regen und Kälte. In der Mitte brannte das Feuer, dessen Rauch durch eine Öffnung in der Decke abziehen konnte. Es war ziemlich dunkel im Inneren. Eine Frau saß am Feuer und schnitt Fleisch in einen Topf. Im hinteren Bereich war der erhöhte Bereich des Onkels. Er war verlassen. Wahrscheinlich traf sich der Onkel mit anderen Männern. An den Seiten der Hütte standen erhöhte Betten, die mit Fellen belegt waren. Die Hütte war so groß, dass leicht zehn bis zwölf Menschen Platz hatten. Mato-wea wunderte sich, wo die anderen Familienmitglieder waren. Die Tante hatte eine Tochter, die etwas jünger als Mato-wea war, und noch zwei kleinere Kinder. Außerdem lebten eine Großmutter und eine verwitwete Cousine mit ihrem Sohn bei ihnen. Mato-wea fragte nicht, sondern setzte sich zu ihrer Tante ans Feuer. Sie zog ihr Messer und half der Tante, das Fleisch zu schneiden. Die Tante lächelte freundlich und nickte in Richtung einiger Körbe. „Bringe mir noch etwas Kürbis und Zwiebeln. Dann schmeckt es besser.“
Mato-wea erhob sich und holte das Gemüse. Sie hatten viele Vorräte, und es schien, als würde das Volk gut über den Winter kommen. Die Ernte des letzten Jahres war gut gewesen. Trotzdem war das Leben schwerer geworden. Normalerweise bezogen die Menschen im Winter kleine Hütten, die leichter zu beheizen waren, doch anhaltende Angriffe der Cha-rúwak, wie die Tituwan Suane von ihnen genannt wurden, zwangen sie auch im Winter, in ihren befestigten Dörfern zu bleiben. Cha-rúwak bedeutete Gras-Leute, denn wenn die Tituwan angriffen und dann von den Mandan verfolgt wurden, verschwanden sie einfach im hohen Gras. Seit dem Großen Sterben vor gut 25 Wintern war ihr Volk dezimiert worden und machte es den Feinden leichter, über sie herzufallen. Sie nannten sich die Numahkahke – die Mandan. Ihr Dorf hieß Mitutanka und war erst vor einigen Wintern an der Mündung des Knife-Flusses in den Missouri auf einer Anhöhe errichtet worden. Hier gab es wenig Holz, sodass die Frauen weite Wege gehen mussten oder angeschwemmtes Holz sammelten. Ihr Häuptling Sheheke shote war vor drei Wintern mit den weißen Händlern aufgebrochen, um den Großen Vater der Weißen zu treffen. Noch immer war er nicht zurückgekehrt, und das führte zu Unruhen unter den anderen Häuptlingen. Die Mandan wollten ihre Position als Handelspartner stärken und suchten damit den friedlichen Kontakt zu den Weißen. So, wie sie es in der Vergangenheit nicht nur zu Weißen, sondern auch zu anderen Stämmen schon erfolgreich getan hatten.
„Holst du mir Holz?“, fragte die Tante. Sie hieß Hohes-Wasser und hatte ihre Blütezeit schon lange überschritten. Die drei Geburten und die harten Winter hatten sie schnell altern lassen. Der Onkel hieß Shut-haska, was Puma bedeutete, und auch er war schon älter. Der Name war eindrucksvoll und zeigte, dass er mal ein gewandter Krieger gewesen war. Doch diese Zeiten waren vorbei. Sie nannte die beiden Mutter und Vater – aus Respekt, aber auch, weil sie es nie anders gekannt hatte.
Mato-wea nickte gehorsam und erhob sich. Sie legte sich wieder die Robe um die Schultern und nahm ein Beil, um Äste und Stämme zu einem handlichen Bündel hacken zu können. Die Tante gab ihr noch ein geflochtenes Seil aus gedrehter Bisonwolle mit, mit dem sie das Bündel schultern konnte. „Nimm deine Schwester mit, wenn du sie siehst!“
Mato-wea lächelte verschmitzt. Tante nannte die Cousine immer „Schwester“ – so wie sie die Nichte mit „Tochter“ anredete. Seit dem Tod der Mutter hatte sie die Mutterrolle übernommen, und Mato-wea war dankbar dafür. Sisohe-wea, Falkenfrau, war etwas jünger als sie und spielte vermutlich in einer anderen Hütte mit ihren Freundinnen.
„Ich nehme sie mit!“, versprach sie. Auch Sisohe-wea ließ ihre Haare inzwischen wachsen und musste sich auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereiten. Doch sie entwischte nur allzu gerne ihren Pflichten und verließ sich darauf, dass die ältere Schwester die Arbeiten erledigte. Mehrfach hatte Mato-wea ihre Schwester im Herbst ermahnen müssen, die Arbeit auf den Maisfeldern nicht zu vernachlässigen. „Die Krähen fressen uns den ganzen Mais weg, wenn wir sie nicht verjagen!“, hatte sie geschimpft. Aber wenn Sisohe-wea sie mit großen braunen Augen anhimmelte, dann konnte sie nie wirklich böse sein.
Mato-wea sah sich in dem Dorf um, dessen Hütten um einen großen freien Platz gebaut waren. Die Dächer waren mit Schnee bedeckt, und aus den Rauchlöchern stiegen feine Säulen in den Himmel. Niemand hockte auf den Dächern, weil es einfach zu kalt war. Nur in der Richtung zum Fluss stand einsam eine Wache auf einem Dach und lehnte schläfrig gegen einen langen Ast gestützt. Besonders aufmerksam sah er nicht aus. Mato-wea schlüpfte in das Erdhaus einer benachbarten Familie und fand ihre Schwester bei einem Würfelspiel mit anderen Mädchen. „Wir brauchen Holz!“, bat sie auffordernd.
„Hohch!“, stöhnte das Mädchen und erntete einen überraschten Blick der Matrone dieses Hauses. Nichts war schlimmer als ein faules Mädchen! Sofort bemerkte Sisohe-wea ihr ungezogenes Betragen und legte die Spielsteine beiseite. „Spielen wir nachher weiter?“, hoffte sie.
Die anderen Mädchen kicherten und erhoben sich ebenfalls. „Wir gehen mit! Unsere Mütter brauchen sicherlich auch Holz!“
Sisohe-wea klatschte in die Hände vor Begeisterung. „Ja, das ist schön! Und dann wärmen wir uns wieder auf.“ Sie glühte vor Stolz, als sie den wohlwollenden Blick der Matrone sah. Sie hatte ihre unbedachte Gemütsäußerung wieder ausgemerzt.
Mato-wea lächelte ebenfalls. So würde es viel mehr Spaß machen! Sie wartete, bis sich alle Mädchen in ihre warmen Umhänge gewickelt hatten, und führte sie dann in Richtung des breiten Flusses. Dort gab es immer Schwemmholz, das man neben dem Feuer trocknen und dann verwenden konnte. Der Fluss war noch nicht ganz zugefroren, und so musste man auch an den Stellen, die mit Eis bedeckt waren, gut aufpassen, wenn man sie betrat. Zwei Kinder waren beim Spielen bereits eingebrochen und wären fast unter die Eisdecke geraten. Es war ein seltsamer und gefährlicher Winter.
Die Mädchen gingen am Ufer entlang und plauderten kichernd über die letzten Neuigkeiten. Mato-wea erfuhr, dass eine junge Frau wohl ihr erstes Baby erwartete und es Streit zwischen zwei Eheleuten gegeben hatte. „Stellt euch vor“, erzählte Waschbären-Frau, „Guter-Habicht“ wohnt jetzt bei einem Freund. Seine Frau hat ihn einfach vor die Tür gesetzt.“
„Warum?“, wollte Mao-wea wissen.
„Er hat eine jüngere Frau als zweite Frau zu sich genommen, und nun ist seine erste Ehefrau wohl eifersüchtig.“
Mato-wea schüttelte den Kopf. „Hat er sie denn nicht gefragt?“
Waschbären-Frau zuckte mit den Schultern. „Anscheinend nicht.“
Mato-wea sah sie unsicher an. „Aber es ist doch gut, wenn sie Unterstützung bekommt.“
Waschbären-Frau wechselte einen wissenden Blick mit den anderen Mädchen und musterte Mato-wea dann streng. „Aber doch nicht, wenn er nur noch Augen für die Jüngere hat!“
„Hmh!“ Mato-wea runzelte die Stirn. Da hatte sie natürlich recht. Die Mädchen fanden schließlich einen großen Haufen angetriebenes Holz und machten sich daran, die Äste und Stämme auseinanderzuziehen. Mit ihren Beilen hackten sie das Holz in armlange Stücke und banden es zu tragbaren Bündeln zusammen. Ein eisiger Wind wehte, der ihnen die Arbeit erschwerte. Sie hatten keine Handschuhe an und machten immer wieder Pause, um die Hände unter dem Umhang zu wärmen. „Huh, kalt!“, rief Mato-wea vor Kälte zitternd.
Auch die anderen sahen auf und schienen für heute genug zu haben. „Lasst uns zurückkehren! Die Sonne geht schon unter!“, schlug Sisohe-wea vor.
Mato-wea nickte nur, denn auch sie fror. Sie schulterte ihr Bündel und trat dann in die Spur, die sie auf dem Hinweg hinterlassen hatten. Es war einfacher, dem kleinen Trampelpfad zu folgen, den sie in den Schnee getreten hatten. Es ging den Hügel wieder hinauf, und es war rutschig. Als sie die Ebene erreicht hatten, konnten sie schemenhaft den Palisadenzaun sehen und darüber den Wächter, der immer noch seinen Blick über das Land schweifen ließ. Hier und da lugte ein Dach über die Palisaden empor, sonst war von dem Dorf dahinter nichts zu sehen. Stattdessen standen westlich davon einige Totengerüste, und an der Seite des Flusses – dort, wo im Sommer die Felder zu sehen waren – standen die kleinen Plattformen, auf denen die Kinder und Mädchen saßen, um die Vögel zu vertreiben. Mato-wea beugte sich gegen den Wind, der nun von Westen her blies. Ein Warnruf schreckte sie auf, und sie verharrte, um nach dem Grund zu sehen. Oben auf dem Dach winkte der Wächter mit dem Speer hin und her und stieß Warnrufe aus. „Wiradar!“- Feinde! Ganz deutlich war das Wort über die Entfernung zu hören. Mato-wea ließ vor Schreck das Holz fallen und sah sich um. Tatsächlich! Über die Ebene galoppierte eine Gruppe feindlicher Krieger genau auf sie zu. Sie erkannte bei einigen bemalte Gesichter, die auf keine freundlichen Absichten hindeuteten. „Lauft!“, schrie sie den Mädchen zu. „Lasst das Holz liegen und lauft!“
Die anderen Mädchen waren vor Schreck wie versteinert. Mit weit aufgerissenen Augen blickten sie auf das Unheil, das dort auf gescheckten Ponys auf sie zu galoppiert kam. Energisch schob Mato-wea die Mädchen vor sich her. „Nun lauft doch endlich!“, schrie sie aus Leibeskräften. Sie konnte erkennen, dass sich vom Dorf her bewaffnete Männer aufmachten, die ihnen helfen wollten.
„Schneller!“, herrschte sie die Mädchen an. Sie ließen die Bündel fallen, wickelten sich aus ihren Roben und rannten mit fliegenden Zöpfen in Richtung des Dorfes. Ihnen kam zugute, dass sie jung waren. Einige Pfeile zischten knapp an ihnen vorbei, sodass die Mädchen ins Stocken gerieten und vor Angst schrien. „Weiter!“, herrschte Mato-wea sie an. Verzweifelt rafften sie sich auf und rannten weiter. Einige Reiter versuchten ihnen bereits den Rückweg zum Dorf abzuschneiden.
Mato-wea lief als Letzte und erkannte, dass sie es nicht schaffen würde. Der erste Krieger hatte sie fast erreicht, und so sauste sie einen Abhang hinunter und wich auf die Felder aus. Ihre Lungen brannten bereits von der Kälte, und ihre Knie waren weich vor Furcht. Im letzten Moment rutschte sie unter eine Plattform, während der Krieger sein Pferd parieren musste, wenn er nicht in das Gerüst preschen wollte. Schnaubend stieg das Pferd in die Höhe, und Mato-wea konnte den Mann kurz erkennen: Schwarze Augen in einem bemalten Gesicht, schwarze Zöpfe, eine einfache Robe und mit roten Streifen verzierte Beinkleider. Er grinste übermütig, als er seine Beute unter dem Gerüst hocken sah. Mato-wea wusste, dass er sie gleich als Gefangene mitzerren würde und entschloss sich zu einem verzweifelten Schritt. Kurz konnte sie erkennen, dass die anderen Krieger abgedreht hatten, als die Mandan wie aufgeschreckte Hornissen aus dem Tor strömten. Die anderen Mädchen hatten das Dorf inzwischen sicher erreicht und schrien erschrocken, als sie sahen, in welcher Gefahr Matowea schwebte.
Mato-wea hechtete mit einem Schrei unter dem Gerüst hervor, packte den Mann am Arm und zog ihn mit einem Ruck herunter. Völlig überrumpelt stürzte der junge Mann in den Schnee, und ehe er sich hochrappeln konnte, rannte Mato-wea davon. Sie war schnell! Aber sie wusste, dass er sie vermutlich einholen würde, sobald er sich von dem Schreck erholte. Stolpernd und keuchend erklomm sie die Böschung, dann hatte sie die Ebene wieder erreicht und hastete weiter. Sie rechnete jeden Augenblick damit, dass sein Totschläger sie treffen würde. Ihre Sprünge waren weit vor Angst, als sie in Richtung des Dorfes hechtete. Aber nichts geschah. Als sie die Männer erreicht hatte und sich umdrehte, stand der Krieger immer noch neben seinem Pferd und starrte ihr mit seinen dunklen Augen hinterher. Dann grinste er, hob grüßend sein Kriegsbeil und sprang mit einem eleganten Satz auf sein Pferd. Herausfordernd ließ er das Pferd steigen und tänzeln und forderte damit die Mandan zum Kampf heraus. Sein Kriegsschrei hallte über die Ebene und ließ Mato-wea frösteln. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie von ihren Freundinnen umringt wurde, die sie in ihre Mitte nahmen und ins Dorf zurückzerrten. „Du bist so mutig!“, schwärmte Sisohe-wea. „Ohne dich hätten wir es nicht geschafft!“
Mato-wea klapperten so die Zähne aufeinander, dass sie keine Antwort geben konnte. Sie war nicht mutig gewesen! Sie hatte einfach keine andere Wahl gehabt. Willenlos ließ sie sich in ihre Hütte ziehen, während im Hintergrund das Geschrei der Männer leiser wurde. Anscheinend hatten die Tituwan ihren Angriff abgebrochen und zogen sich zurück. Mato-wea brach am Feuer fast zusammen, und die Tante legte ihr einen Umhang um den zitternden Körper. „Was ist denn geschehen?“, erkundigte sie sich besorgt.
„Feinde haben uns aufgelauert, und Mato-wea hat uns alle gerettet!“, erzählte Sisohe-wea aufgeregt.
„Wirklich?“ Die Tante blickte entsetzt auf ihre Töchter.
Sisohe-wea nickte heftig. „Sie hätten uns fast erwischt, aber Mato-wea hat einen von ihnen vom Pferd gezogen!“
Die Tante maß die Nichte mit anderen Augen. „Du hast was?“
„Wirklich!“, beteuerte Sisohe-wea. „Sie hat ihn einfach vom Pferd gezogen und ist dann weggerannt.“ Plötzlich musste sie laut kichern, als die Anspannung von ihr abfiel. „Der war so erschrocken, dass er ihr nicht einmal gefolgt ist!“
Das Fell vor dem Eingang wurde geöffnet, und der Onkel trat ein. Er war ein stattlicher Krieger mittleren Alters, der sich nun auf seinen Ehrenplatz setzte. Aufmerksam musterte er seine Nichte. „Du warst tapfer!“, sagte er bewundernd. „Du hast deine Schwester und die anderen Mädchen gerettet! Ohne dich hätten sie das Dorf wahrscheinlich nicht erreicht und wären entführt worden.“
Mato-wea machte eine verlegene Handbewegung. „Ich bin eigentlich nur weggerannt!“
Der Onkel lächelte. „Nein, es war eine Ablenkung. Der Krieger ist dir gefolgt und nicht den anderen. Ich dachte, dass er dich rauben würde, aber du hast ihn besiegt!“
Mato-wea senkte verlegen den Blick. Sie hatte sich gewehrt. Das war alles. Immer noch klopfte ihr Herz, und sie legte die Hand auf ihre Brust, um es zu beruhigen. „Ich habe meine Robe fallen lassen!“, merkte sie an.
Der Onkel brach in Gelächter aus. „Zum Glück! Sonst hätte dieser Krieger dich nämlich erwischt. Lasst uns gehen und die Umhänge und das Holz bergen! Aber dieses Mal begleiten wir euch.“ Die Tante wehrte dies energisch ab. „Lass das Kind am Feuer sitzen! Ich werde gehen und die Sachen holen. Ich sage den anderen Müttern Bescheid, ehe es zu dunkel wird, und es wäre wirklich gut, wenn uns ein paar Männer begleiten würden. Man kann ja nie wissen, ob diese Halsabschneider nicht noch mehr Beute wollen.“
Ohne Widerspruch erhob sich der Onkel, nahm seine Waffen und machte sich auf, auch die anderen zum Mitgehen zu bewegen. Kurze Zeit später kehrten er und die Tante mit den geborgenen Sachen zurück. Sorgsam hing die Tante den Umhang neben Mato-weas Bett und legte dann das Holz zum Trocknen neben das Feuer. Dann schenkte sie die warme Suppe in Schüsseln aus und reichte sie ihrem Mann und anschließend den beiden Mädchen. Hungrig schlürfte Mato-wea die leckere Suppe und seufzte genießerisch. „Danke!“ Sie hatte noch nie in ihrem Leben so einen Hunger gehabt!
Neugierig näherten sich die beiden kleineren Kinder und ließen sich die Geschichte erzählen, wie Mato-wea den feindlichen Krieger besiegt hatte. Sisohe-wea schmückte die Geschichte aus, sodass es Mato-wea bald peinlich war. „Ich habe ihn nur vom Pferd gezogen!“, meinte sie bescheiden.
„Ja, und er war so überrascht, dass er dir nicht gefolgt ist“, prahlte die Schwester.
„Wirklich?“ Die Augen der Kinder hingen an Mato-weas Lippen. Mato-wea senkte ratlos den Blick. „Er hätte mir leicht folgen können, aber er hat es nicht getan. Ich weiß nicht, warum!“
„Haha! Weil er Angst vor dir hatte!“ In Sisohe-weas Stimme klang Bewunderung.
„Sicher nicht!“ Mato-wea dachte an die funkelnden schwarzen Augen, die fast übermütig auf sie heruntergesehen hatten. Angst hatte dieser Krieger ganz bestimmt nicht gehabt!
In der Nacht wälzte sie sich ruhelos hin und her. Immer wieder sah sie das Gesicht des Mannes vor sich, der sie fast niedergeritten hatte. Dann fuhr sie schweißgebadet hoch, sah sich um und erkannte, dass sie nur geträumt hatte. Zweimal stand sie auf und legte Scheite ins Feuer, weil sie die Dunkelheit nicht aushielt. Die anderen Bewohner lagen in ihren Betten und schliefen tief und fest. Der Onkel schnarchte leise und hatte sich an seine Frau gekuschelt. Es sah friedlich aus. Ob auch sie einst so einen liebevollen Ehemann bekam? Mato-wea hoffte, dass ihr Onkel einen guten Ehemann für sie suchte. Ihre Wünsche hatten sich ein wenig verändert: Nach dem heutigen Tag wollte sie einen Ehemann, der sie auch beschützen konnte!
Wambli-luta
Dorf der Tituwan am Heart-Fluss
Als Wambli-luta, der Rote-Adler, nach zwei Tagen wieder das Winterdorf erreichte, war er froh, im warmen Tipi seiner Eltern verschwinden zu können. Ihr Einzug, angekündigt von einem Späher, war eindrucksvoll gewesen. Sie hatten sich geschmückt und mit ihren Farben bemalt und waren in einer Parade durch das Dorf geritten. Sie hatten keine Toten zu beklagen, sodass der Raubzug ein voller Erfolg gewesen war.
Ihr Dorf lag in diesem Winter weiter im Norden als üblich. Sie hatten einen klaren Fluss gefunden, den sie Canté Wakpa, Herz-Fluss, nannten, an dessen Lauf in der sonst eher öden Gegend viele Bäume und Büsche wuchsen. Im Sommer hatten sie auf der Ebene zusammen mit den Gruppen der Sihasapa und Itazipco Bisons gejagt, doch für die Wintermonate war es leichter, in kleineren Gruppen geeignete Lagerstellen zu suchen, damit die Gegend nicht überjagt wurde oder das Holz ausging. Ihre Gruppe nannte sich die „Tinazipe Sica“, die Schlechten Bögen, eine Untergruppe der Hunkpapa, und ihr Häuptling war Mato-ska-cikala, Kleiner-Weißer Bär. Wambli-luta gehörte zu seinem Tiyospaye, denn Mato-ska-cikala war als jüngster Bruder der Großmutter sein Großonkel. Tatsächlich nannte er ihn aber „Lekshi“ – Onkel.
Wambli-luta hängte den Bogen und den Schild an eine Tipistange, zog die Mokassins von den Füßen und ließ sich von seiner Mutter eine Schale Essen geben. Seufzend hockte er sich auf sein Backrest, eine Lehne aus Weidenzweigen, und streckte die nackten Füße in Richtung des Feuers, das in der Mitte des Zeltes brannte. Noch hatte er das mit Fransen besetzte Lederhemd an, das ihn gegen die Kälte schützte. Im Haar trug er noch die Federn, die ihn als Krieger und Späher auszeichneten. Kurz strich er sich fahrig einige Strähnen aus dem Gesicht, die sich aus seinen Zöpfen gelöst hatten. Er wirkte müde, und seine Gesichtszüge zeigten die Anstrengung der letzten Tage. Seine Lippen waren schmal und seine Augen leicht zusammengekniffen. Er seufzte tief, als er seine langen Beine ausstreckte und sich langsam entspannte. An ihm war kein Gramm Fett zu viel. Er war jung, und sein Körper zeigte die Spannkraft eines Menschen, der zu Fuß oder zu Pferd weite Strecken zurücklegte. Dann veränderte sich sein Gesichtsausdruck, als er seiner Schwester einen liebevollen Blick zuwarf. Die Augen zeigten ein lustiges Blitzen, und kleine Grübchen um die Augen verschönerten sein ernstes Gesicht. Er grinste seine Schwester an, die auf ihrem Lager saß und an etwas stickte, und futterte hungrig das Essen. Er wurde wieder ernst, als sein Vater sich ihm gegenüber setzte und höflich wartete, bis sein Sohn seinen Hunger gestillt hatte, ehe er ihn mit einer Handbewegung einlud, über seinen Raubzug zu sprechen. „Habt ihr viel Beute gemacht?“
Wambli-luta nickte erfreut. „Wir fanden ein Dorf der Miwatani und raubten ihnen ein paar Pferde.“ Er lachte vor Begeisterung. „Wir erschreckten ein paar Mädchen, während einige andere sich die Pferde holten. Es war ein guter Coup!“
„Und niemand wurde verletzt?“, erkundigte sich der Vater.
„Niemand!“, betonte der junge Mann. „Die Miwatani schwärmten aus ihrem Dorf heraus, um den Mädchen zu helfen, aber folgten uns nicht. Wir haben ein paar Pfeile verschossen und sie auch. Einige hatten sogar Gewehre, aber sie kamen nicht dazu, auf uns zu schießen; so schnell waren wir wieder weg.“
„Und die Mädchen?“, erkundigte sich die Mutter aus dem Hintergrund.
Wambli-luta machte eine verächtliche Handbewegung. „Ich habe nur ihre langen, dürren Beine gesehen, als sie weggerannt sind.“
Die Schwester kicherte hinter ihrer vorgehaltenen Hand, während die Mutter den Kopf schüttelte. „Dürre Beine! Die konntest du doch gar nicht sehen.“
„Doch! Ganz genau! Sie hatten die Kleider hochgezogen, um schneller zu rennen. Und ihre Roben haben sie auch fallen lassen. Ich hätte ganz einfach eins von ihnen rauben können.“
„Und warum hast du es nicht? Solange du bei Mädchen nur dürre Beine siehst, wirst du nie eine Ehefrau finden.“ Deutlich war der Vorwurf zu hören.
„Hohch. Ein Mädchen hätte ich fast erwischt. Sie versteckte sich unter einem seltsamen Gerüst. Es sah aus wie ein Gestell, das wir für unsere Toten bauen, aber es stand inmitten ihrer Felder.“
„Dort vertreiben sie die Vögel, wenn die Ernte naht“, erklärte der Vater. Dann blinzelte er belustigt. „Und was hat das Mädchen dort gemacht?“
„Nichts!“ Der junge Mann verschwieg, dass die Frau mutig genug gewesen war, um ihn anzugreifen und vom Pferd zu ziehen. Das war wohl die unrühmlichste Situation in seinem ganzen Leben gewesen! Er hoffte, dass niemand seiner Freunde es gesehen hatte.
„Nichts?“, wunderte sich der Vater.
Wambli-luta nickte. „Nichts. Ihre Leute kamen, und ich ließ sie laufen. Sie war sehr hübsch.“
„Ahhh, also doch nicht nur dürre Beine!“, meinte die Mutter triumphierend.
„Nein!“, gab Wambli-luta offenherzig zu. „Das nächste Mal hole ich sie mir!“ Seine Stimme klang entschlossen.
Die Eltern lachten über diesen Scherz, ahnten aber, dass ihr Sohn vielleicht erneut dorthin gehen würde. So ein hübsches Miwatani-Mädchen spukte ihm offensichtlich im Kopf herum.
„Wo sind die Pferde, die ihr erbeutet habt?“
Mit seinen Lippen, die er mit dem typischen „Entengesicht“ vorschob, deutete Wambli-luta auf den Eingang des Zeltes. „In der Mitte des Dorfes. Wir entscheiden später, wer sie erhält.“ Der junge Mann beugte sich vor und knetete seine Füße durch. Dann schlüpfte er in die warmen Mokassins. Gedankenverloren begann er damit, seine Haare zu entflechten. Es wurde Zeit, sich für den Abend herzurichten. Die Mutter nahm eine Bürste aus dem Schwanz des Stachelschweins und bürstete vorsichtig durch das lange Haar, dann legte sie es in drei Zöpfe. Zwei davon flocht sie seitlich am Kopf und umwickelte sie mit Otterfellstreifen. Den dritten, der über den Scheitel des Mannes gebunden wurde, fiel einfach hinten in den Nacken. Stolz musterte sie ihre Kinder. Wambli-luta zählte um die achtzehn Winter, während seine Schwester höchstens zwölf Winter zählte. Auch sie war hochgewachsen und schlank und ihre schwarzen Augen hatten einen weichen Schein. Ihr Bruder hatte ein markantes Kinn, das er gerne trotzig vorstreckte, und eine leicht gebogene Nase.
Seine Schwester hatte ein weicheres Gesicht, das eindeutig nach der Mutter geriet, nur dass bei dem jungen Mädchen die vielen Runzeln fehlten. Einst musste die Mutter eine wahre Schönheit gewesen sein, aber die vielen Hungerwinter hatten ihre Spuren hinterlassen. Die Mutter hieß Phazu-washté-win, Hübsche-Nase, und die Tochter Anpao-win, Morgendämmerung. Der Vater zählte bereits über fünfzig Winter und wurde Wahukheza-ksaheya, Gebrochene-Lanze, genannt. Er trug eine kleine Narbe unter dem rechten Auge, sodass sein Gesicht immer leicht zusammengekniffen wirkte. Viele Lachfalten deuteten aber auf ein freundliches Wesen hin. Gebrochene-Lanze lachte gern und viel. Die Zeit der Kriegszüge war für ihn vorbei, und so saß er gern mit den anderen Männern bei einem Wettspiel beisammen. Er war von den Häuptlingen als Wakincun gewählt worden, einer von vier Männern, denen die Verwaltung des Dorfes unterlag. Er hatte also eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Fast täglich saß er mit den anderen im Tipi, beriet über anstehende Maßnahmen und ließ die Entscheidungen über einen Herold verkünden.
Wambli-luta erhob sich und verließ das Tipi. Seine Eltern, die Großmutter und die Schwester folgten ihm. Sie hatten schöne Kleidung angelegt, um die siegreiche Rückkehr gebührend zu feiern. Eine gewisse Aufregung machte sich bei allen bemerkbar. In der Mitte des Dorfes hatten sich schon viele Menschen versammelt. Frauen standen in ihre Roben gehüllt in einem weiten Kreis, dazwischen huschten Kinder hin und her. Zwei Akicitas der Canté-tinza-Gesellschaft, die mit der Ordnungsfunktion über das Dorf betraut waren, hielten die Neugierigen zurück und ließen genügend Platz für die folgende Darbietung. Wambli-luta stellte sich zu den anderen Kriegern, die prächtig geschmückt darauf warteten, ihre Heldentaten zu erzählen. Sie hatten niemanden getötet, also verzichteten sie auf die schwarze Bemalung und den Waktegli, den Siegestanz. Stattdessen wurden die erbeuteten Pferde in den Kreis geführt. Thimahel-okile, Den-man-im-Zeltsucht, ein bewährter Krieger und Anführer des Kriegstrupps, machte eine große Geste mit der Hand. „Seht, was wir erbeutet haben! Die Miwatani haben sich in ihren Hütten verkrochen wie Feiglinge. Erst als wir ihre Pferde raubten, kamen sie aus ihren Löchern hervor. Sie schossen auf uns, doch unsere Medizin war stärker! Nun besitzen wir ihre Pferde!“ Stolz saß er auf seinem Pferd, ganz und gar der Anführer und Krieger. Er zählte dreimal zehn und fünf Winter, und sein Körper war sehnig und kraftvoll. Er hatte eine hohe Stirn mit tiefliegenden Augen, und sein Gesicht wurde dominiert von einer Nase, die wie der Schnabel des Adlers gebogen war. Er flößte schon durch sein Aussehen Respekt ein, doch jetzt – im vollem Kriegsschmuck und mit den Federn, die hinten im Haar hingen, wirkte er geradezu respekteinflößend.
Die Frauen antworteten mit einem hohen Trällern auf die kleine Schmährede, während die Männer und Jungen laut jubelten. „Ich habe entschieden, wer diese Pferde erhält!“, fuhr Thimahel-okile mit der natürlichen Autorität des Anführers fort. Er nahm zwei Pferde an ihren Stricken und führte sie zu einem einfach gekleideten Mann. „Diese sind für die Ohunkeshni – für unsere Alten und Schwachen, die nicht mehr für sich selbst sorgen können. Bestimme du, wer sie am nötigsten braucht.“ Zum ersten Mal lächelte er kurz, und sein Antlitz zeigte nun ein ausgeglichenes Gemüt und wahre Zuneigung zu den Menschen, die er beschützte.
Ein wohlwollendes Gemurmel folgte dieser Großzügigkeit. Der angesprochene Mann nickte bescheiden und nahm die beiden Pferde in seine Obhut. Er sah sich kurz um und trat dann zu einer Frau mittleren Alters, deren kurz geschnittene Haare darauf hindeuteten, dass sie erst vor kurzem ihren Mann verloren hatte. An ihrer Seite standen ein Junge von vielleicht zwölf Wintern und ein kleineres Mädchen. Ohne Worte drückte er der Frau den Strick in die Hand, die sich mit einem Nicken bedankte und dann mit dem Pferd verschwand. Das andere Pferd gab er einem älteren Krieger, der ein lahmes Bein hatte und mit einem Stock gehen musste. Wieder antwortete ein beifälliges Murmeln, dann wandte sich die Aufmerksamkeit wieder dem Geschehen zu. Thimahel-okile zerrte ein weiteres Pferd herbei, das nervös tänzelte. Es war eine hübsche, junge Stute.
„Dieses Pferd ähnelt einem mutigen Mädchen, auf das einer unserer Krieger stieß. Sie hätte ihn fast überrumpelt.“
Wambli-luta ahnte, was ihm blühte, und senkte machtlos den Blick. Wahrscheinlich würde das ganze Volk in Zukunft über ihn spotten. Er trug es mit Fassung und zuckte mit einem schiefen Grinsen mit den Schultern.
Thimahel-okile aber empfand Wohlwollen mit dem jungen Mann, denn er wandte sich mit erhobener Stimme an ihn. „Wambli-luta hat Mitleid gezeigt und das Mädchen laufen lassen. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie mitzunehmen, denn er würde sie ganz sicher besser beschützen als diese Erdlochbewohner! Also gebe ich ihm diese Stute, damit er in Zukunft ein hübsches Mädchen mitbringen kann!“
Wambli-luta warf dem Redner einen Blick tiefster Dankbarkeit zu. Erhobenen Hauptes, sodass niemand seine Erleichterung bemerkte, schritt er in den Kreis und nahm das Pferd in Empfang. Seine Ohren rauschten immer noch, als er sich an den Rand stellte, dem Pferd beruhigend den Hals klopfte und dann die Zeremonie verfolgte. Alle Krieger wurden erwähnt und ihre Taten mit blumigen Worten gepriesen. Auch Krummes-Bein, ein guter Freund von Wambli-luta und entfernter Cousin, wurde für seine Tapferkeit geehrt. Er zählte etwa so viele Winter wie Wambli-luta, war aber von gedrungenem Körperbau. Er hatte einen leichten Bauchansatz, was für junge Männer eher ungewöhnlich war. Sein Gesicht war rund wie der Vollmond, und er hatte geschwungene fleischige Lippen. Er hatte meist ein ausgeglichenes Wesen und liebte es, seine Freunde zu necken und darüber zu lachen. Seine Augen blitzten meist lustig. Diese Anerkennung freute Wambliluta besonders, denn eine Verletzung hatte dem jungen Mann schwer zu schaffen gemacht. Es war gut, dass Krummes-Bein seine Kraft wiedergefunden hatte! Ein Pferd nach dem anderen wurde verteilt, bis zum Schluss nur noch zwei Pferde übrig blieben, die Thimahel-okile für sich behielt. Das war ausgesprochen großzügig, und die Beliebtheit dieses Kriegers stieg. Als Sohn eines der Häuptlinge würde er wohl in dessen Fußstapfen treten, und alle vermuteten, dass er ebenfalls zum Häuptling ernannt werden würde.
Als es dunkel wurde, verschwanden die Menschen in ihren Zelten, wo bereits ein gutes Essen auf sie wartete. Geschichten wurden erzählt, und Wambli-luta musste mehrmals von seinem Abenteuer berichten. Er schmückte es etwas aus und verschwieg, dass dieses Mädchen ihn vom Pferd gezogen hatte. Aber irgendwo kam die Geschichte auf, dass er vom Pferd gesprungen war und sie mit seinem Beil fast getötet hätte. Anscheinend hatte man ihn doch beobachtet, aber nicht gesehen, dass er nicht ganz freiwillig vom Pferderücken abgestiegen war. Auch gut! Er hütete sich, etwas zu sagen, denn dass er nun als großzügig dastand, war ihm nur recht.
Die Zeit des Winters war hart, und so brach niemand mehr zu einem Raubzug auf. In den Zelten wurden Geschichten erzählt, die Waffen erneuert und neue Kleidung hergestellt. Die Männer, Frauen und Kinder erfreuten sich an Wettspielen, und so mancher Wetteinsatz wechselte den Besitzer. Auch Wambli-luta blieb im Zelt, obwohl er darauf brannte, seinen Mut zu beweisen. Manchmal zog er seine Schneeschuhe über und brach auf, um seinen Eltern ein wenig frisches Fleisch zu bringen. Die Tiere hatten ihr dichtes Winterfell, das gerne für Umhänge, Mützen und einfache Handschuhe verwendet wurde. Kinder bauten sich Schlitten aus Knochen und rutschten die vereisten Hänge am Flussufer hinunter oder balgten sich in Schneeballschlachten.
Wambli-luta war froh, als die ersten warmen Winde den Schnee schmelzen ließen und die Zugvögel in ihrer Formation nach Norden flogen. Gänse, Enten, selbst Kraniche und Kormorane kehrten zurück und bauten ihre Nester. Längst waren die gepunkteten Prärieläufer zu sehen, die in dem weiten Grasland ihre Nester im Gras versteckten, oder Blauhäher, die mit frechem Kreischen auf andere Vögel losgingen. Die Hunkpapa wollten südwärts bis zum Inyan-wakachapi-Wakpa, dem Cannonball-Fluss, ziehen. Ihre Abreise hatte sich verzögert, denn ein später Eissturm hatte sie überrascht. Anschließend mussten erst einige Tipis geflickt und neue Stangen geschlagen werden, weil einige durch den Sturm zu Bruch gegangen waren. Die Jahreszeiten konnten in diesem Land tückisch sein. Bald darauf brachen die Familien auf und zogen nach Süden, um sich mit den anderen Gruppen zu treffen. Das Dorf wurde größer, als immer mehr Gruppen eintrafen