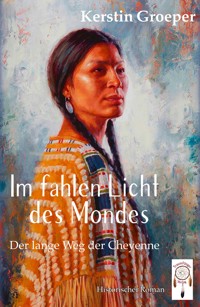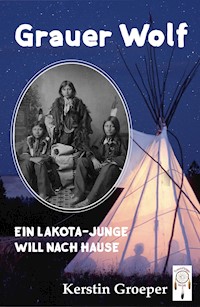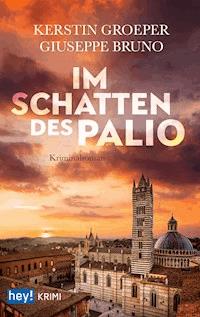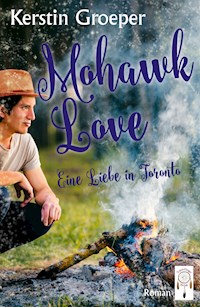
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Anfang der 80ger Jahre. Krissy hat nach dem Fachabitur nur einen Plan: möglichst weit weg von dem Drama zuhause und ihrem despotischen Vater. Kanada ist gerade weit genug weg – und so bewirbt sie sich als Nanny, um ein Jahr im Land ihrer Träume zu verbringen. Die Realität in Toronto ist jedoch nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt hat. Sie kommt mit der Familie nicht klar, und zu allem Unglück wird sie auch noch überfallen und vor ein vorbeifahrendes Auto gestoßen. Der Dieb entkommt, doch der Fahrer des Autos entpuppt sich als kanadischer Ureinwohner, der Krissy hilfsbereit nach Hause fährt. Eine zarte Beziehung bahnt sich zwischen ihr und Jordan an, doch Krissy schwankt zwischen der Liebe zu Jordan und den Wunsch ihres Vaters, in Deutschland ein Studium zu beginnen. Hat ihre Liebe eine Zukunft? Krissy muss erkennen, dass Kanada auch seine Schattenseiten hat, wenn es um seine Ureinwohner geht. Als die Schwester von Jordan verschwindet, wird ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt – und Krissy muss sich entscheiden: Ihre Liebe oder das Studium. Eine nostalgische Zeitreise ins Jahr 1981 – in ein Land der Träume, das allen offen stand – nur nicht den eigenen Ureinwohnern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Ann und Norman – meine Lebensretter
Mohawk Love
RomanvonKerstin Groeper
Impressum
Mohawk Love, Kerstin Groeper
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2020
1. Auflage eBook September 2021eBook ISBN 978-3-948878-02-3
Lektorat: Michael Krämer
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: Bookwire
Titelbild: Adobe Stock
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG,Hohenthann
Printed in Germany
Inhalt
Nur weg
Toronto
Jordan
Beschneidung
Die Islands
Pläne
Umzug
Cottages
Anrufe
Begegnungen
Jagdbeute
Quebec
Frühling
Ottawa
Summertime in Toronto
Algonquin-Park
Fische und Beeren
Islington
Jennifer
Herbst in Toronto
Epilog
Es gibt immer zwei Leben – eines, das man führt,und eines, das man auch hätte haben können.
Nur weg
Frühjahr 1981
„Du bist doch sowieso zu blöd fürs Abitur!“, entfuhr es dem Vater in seiner typischen aufbrausenden Ungeduld.
Bamm! Das saß! Krissy schaute ihren Vater sprachlos an. Er hatte diese Aura von Arroganz, Genervtheit und Größenwahn, bei der man sich besser wegduckte und schwieg. Ihre Stimme war heiser, als sie den Mut aufbrachte, gegen seine Meinung aufzubegehren. „Meine Noten sind gar nicht schlecht … und mit dem Fachabitur kann ich auch studieren.“ Ihre Stimme bröckelte leicht. Wie war dieser Disput überhaupt entstanden? Es ging um die Klassenlektüre, über die sie heute im Deutschunterricht gesprochen hatten. „Mutter Courage und ihre Kinder.“ Der Stoff hatte ihr zugesetzt, denn sie konnte nicht verstehen, wie eine Mutter um des Profits willens ihre Kindern opfern konnte.
„Wer hat dir überhaupt so einen Blödsinn erzählt“, fragte der Vater mit einem sarkastischen Unterton. „Antihelden! So ein Quatsch. Natürlich kann man sich in dem Buch mit den Charakteren identifizieren. Mutter Courage ist doch eine Heldin, die alles übersteht – sogar den Krieg.“
Krissy sammelte die Spucke in ihrem Mund. „Eben nicht. Sie sieht doch tatenlos zu, wie all ihre Kinder im Krieg draufgehen. Das ist doch nichts Heldenhaftes.“
Der Vater schnaubte gereizt. „So ein Quatsch“, wiederholte er abfällig.
Krissy verteidigte – vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben – ihren Standpunkt gegenüber ihm. „Das haben wir heute genau so im Deutschunterricht gelernt. Antihelden sind Figuren in einem Roman, mit denen man sich der Leser nicht identifizieren kann, weil sie unmoralisch, feige oder sonstwie negativ agieren. Doktor Schiwago ist auch so ein Beispiel … sagt Herr Dobner.“
Dem Vater stieg die Zornesröte ins Gesicht. „Doktor Schiwago“ war einer seiner Lieblingsfilme – mit einem überragenden Omar Sharif in der Hauptrolle. Außerdem fühlte er sich von seiner Tochter in seiner Autorität angezweifelt. Er – der große Schriftsteller der Familie. „Doktor Schiwago ist doch kein Antiheld! Was lernt ihr denn in dieser blöden Schule?“ Er stemmte die Hände in die Hüften und machte sich größer, indem er auf und ab wippte. Mit seiner Hand wischte er verächtlich über die Nase. Mit seiner stämmigen Figur und seinen wuscheligen Haaren, in denen bereits das erste Grau zu sehen war, wirkte er wie ein Kosak, der gleich zum Angriff übergehen würde. Seine Präsenz war einschüchternd.
Krissy wusste, wann sie besser einen Rückzieher machte. Sie war nur ein junges Mädchen – schlank und zierlich, mit langem, blondem Haar. Sie versuchte es mit weiblicher Taktik, kicherte vorsichtig und schlug unschuldig die Augen auf. „Ist Lehrplan fürs Abitur. Ich muss ja nicht damit einverstanden sein, aber gewundert hat es mich doch. Ich glaube, ich lese lieber über Helden.“
Der Vater ließ es gut sein. Stattdessen fiel ihm ein anderes Thema ein. „Was willst du nach dem FACH-Abitur eigentlich machen?“ Er betonte das FACH … denn es wurmte ihn immer noch, dass seine Tochter nach der zehnten Klasse das Gymnasium verlassen hatte, um lieber auf der Fachoberschule den sozialen Zweig zu besuchen. Er setzte nun seine Hoffnungen auf die jüngere Tochter, die brav das Gymnasium in Bad Aibling besuchte. Sie hatte gute Noten, und er war stolz auf sie. Krissy würde das Fachabitur wahrscheinlich nur mit Ach und Krach bestehen. In seinen Augen würde sie mal heiraten und Kinder kriegen – basta.
„Studieren!“, erklärte Krissy schnippisch. „Sozialpädagogik. Aber zuerst will ich ein Jahr ins Ausland.“
Der Vater lachte auf. „Ins Ausland? Wohin denn?“ Er klang tatsächlich überrascht.
„Kanada!“, antwortete Krissy kurzangebunden.
Sie hatte noch nicht wirklich darüber nachgedacht, aber jetzt erschien ihr Kanada gerade weit genug weg von all dem Drama hier: die Scheidung der Eltern, der Umzug auf den Bauernhof, den der Vater sich mit seiner neuen Freundin gekauft hatte; die Vernachlässigung durch die Mutter, die sauer war, weil der Vater die beiden Töchter zu sich genommen hatte – mit einem Hund und zwei Pferden bestochen; die viele Arbeit, weil es tatsächlich an Krissy hängen blieb, die zwei Pferde zu versorgen und jeden Tag zu bewegen; der weite Schulweg nach Rosenheim … und in diesem Bauernkaff keinen Anschluss zu finden. Es hatte ein kurzes Techtelmechtel mit einem der Söhne des Bürgermeisters gegeben, aber nachdem Krissys Hund, der regelmäßig zum Streunen ging, dessen reinrassige Colliehündin gedeckt hatte, war sie dort auch kein so gern gesehener Gast. „Ich ertränke diese Drecksviecher!“, hatte der Bürgermeister gedroht. Und Hubert hatte sie verstehen lassen, dass sie aus zwei zu unterschiedlichen Welten kämen. „Ich brauche jemanden, der mir in der Schreinerei hilft“, hatte er gemeint, als er mit ihr Schluss gemacht hatte. „Eine Hiesige.“
Alles klar. Sie war ihm einfach zu „hochdeutsch“ … und zu kindlich mit ihren neunzehn Jahren. Jedenfalls hatte sie sich mit dem Bürgermeister angelegt und gedroht, sich an die Presse zu wenden, wenn er den Welpen etwas antäte. Daraufhin ging das Gerücht um, dass man bessere Chancen für eine Baugenehmigung oder einen Antrag auf Grund hatte, wenn man sich bereiterklärte, einen der Welpen zu nehmen. Ganz so schlimm wurde es dann doch nicht, denn der Bürgermeister fand Gefallen an einem der süßen Welpen und hatte ihn sogar behalten.
Krissy seufzte kurz und wandte sich wieder den Abwasch zu. Ihr Vater hatte die Küche verlassen, um sich wieder dem Schreiben zu widmen. Dazu hatte er in dem alten Bauernhof, dessen Vorderseite sogar mit Lüftlmalerei verziert war, das Dachgeschoss zu einem Atelier ausgebaut. Ansonsten war der Hof noch im alten Stil: Über dem Eingang befand sich ein kleiner Balkon, an der Hauswand rankten riesige Kletterrosen hoch, und die Räume im Innern waren eher klein – mit quadratischen Fenstern und niedrigen Decken. Die Küche hatte einen winzigen Keller, in den man hinuntersteigen konnte, wenn man eine Luke öffnete.
Krissys Zimmer befand sich im ersten Stock des ausgebauten ehemaligen Stalls. Sie hatte dort ein großes Zimmer, zu dem auch ein Bad gehörte. Der Rest war ein riesiger Raum, den der vorherige Besitzer als Galerie für seine Gemälde benutzt hatte. Unter Krissys Zimmer befand sich der Stall für die zwei Pferde: eine Haflingerstute und ein Polnisches Halbblut. Der Vater war mit dem Vorbesitzer in Kontakt getreten, weil er sich getäuscht sah, denn die Stute war nicht geländegängig. Sie hatte solche Angst, dass ihr die Beine zitterten, wenn der Vater mit ihr ausreiten wollte. Die Haflingerstute war auch etwas wild – jedenfalls hatte sie die Schwester abgeworfen, die seitdem nicht mehr reiten wollte, weil sie sich den Arm gebrochen hatte. Bei Krissy war die Stute ganz brav, aber neuerdings hinkte sie nach einer Weile, sodass der Vater beide Tiere zurückgeben wollte. Es war ihm wohl zu viel Arbeit und Verantwortung.
Krissy stellte das Geschirr in den Schrank und wischte noch den Tisch sauber, dann verzog sie sich in ihr Zimmer, um zu lernen. Sie war unkonzentriert, denn ihre freche Antwort rumorte noch in ihrem Kopf herum. Kanada! Warum nicht? Sie hatte keine Ahnung, warum ihr das eingefallen war. Irgendwer hatte ihr mal erzählt, dass es ein Programm gäbe, bei dem man als „Nanny“ dort in einer Familie arbeiten könnte. Sie stellte es sich schön vor, mit Kindern zu arbeiten und dabei ein fremdes Land kennenzulernen. Erst mal weg von hier – von ihrem despotischen Vater, diesem Bauernkaff und dem ewigen Streit zwischen ihren Eltern. Am besten bis nach Australien oder Neuseeland – aber Kanada schien ihr auch ganz schön weit weg zu sein.
Sie schaltete den Fernseher ein – ein absoluter Luxus – und zappte sich durch die wenigen Programme, die sie empfangen konnte. Am besten war immer noch der österreichische Sender. Da liefen wenigstens mal Western. Bayern 3 war auch nicht schlecht. Am Nachmittag lief nichts Vernünftiges, und so schaltete sie wieder aus. Am Abend würde eine chinesische-Serie laufen, auf die sie sich freute: Die Rebellen vom Liang Shan Po. Sie kam ziemlich spät, war relativ blutrünstig – und am nächsten Tag würde sie im Unterricht vermutlich wieder einschlafen. Ihre Nachbarin nahm sie um 6:30 Uhr mit zum Zug – da gab es kein Entrinnen. Wenn sie verschlief, verpasste sie ihre Mitfahrgelegenheit, und ihr Vater würde sauer werden. Es war keine gute Idee, ihn zu wecken und zu gestehen, dass sie verschlafen hätte. Warum hatte er sie auch in so ein Kaff mitgenommen? Vorher hatten sie und ihre Eltern in Gröbenzell gewohnt, einem kleinen Ort westlich von München – da hatte sie viele Freunde gehabt, war im Judoverein und im Schachclub gewesen und hatte in der Schule in der Theatergruppe mitgespielt. Hier gab es nichts! Absolut nichts. Ihre Freunde waren nach dem ersten Sommer auch nicht mehr aufgetaucht. Die Entfernung war einfach zu groß gewesen – also versuchte sie, regelmäßig nach Gröbenzell zu fahren, um ihre Freunde zu sehen – was ihre Beziehung zur Mutter erschwerte, die inzwischen in Fürstenfeldbruck lebt. Entweder Gröbenzell oder Fürstenfeldbruck – sie schwankte zwischen der Loyalität zu ihren alten Freunden und der Liebe zu ihrer Mutter.
Diese hatte einen neuen Freund, den Krissy nicht so gern mochte: einen Jäger, der von Mutter verlangte, dass sie um vier Uhr morgens aufstand und ihn zur Jagd begleitete. Krissy kicherte jedes Mal bei diesem Gedanken: Dass ihre Mutter, eine verwöhnte Stadtpflanze mit lackierten Fingernägeln und Stöckelschuhen sich in Gummistiefeln in die Wildnis begab, war wirklich zu komisch.
Sie schaltete den Fernseher wieder aus und legte ihre Schallplatten auf. Die erste fiel vom Stapel auf die Drehscheibe und nach einem kurzen Rauschen erklang der schnelle Rhythmus von Santa Esmeraldas „Don’t Let Me Be Misunderstood“. Die nächste Platte wäre „Breakfast in America“ von Supertramp. Sie büffelte Biologie und sah sich die Vererbungslehre an. Es war kompliziert, und sie wusste, dass sie morgen Früh ihrer Freundin Tine „Nachhilfe“ geben müsste. Diese täglichen Übungen im Zug, die aus gegenseitigem Abfragen oder Erklären bestanden, hatten ihr den Notenschnitt gerettet. Diese halbe Stunde reichte gerade so, dass sie stets gut vorbereitet in die Schule kam und gute mündliche Noten hatte.
„Kristin!“, hallte es durch den ausgebauten Stall. Ihr Vater rief sie über eine Tür im Dachgeschoss, durch die der ehemalige Stall mit dem Haupthaus verbunden war.
„Ja!“, schrie Kristin in bester Offizier-zu-Soldatenstimme zurück. Sie konnte ziemlich laut brüllen. Schnell drehte sie den Verstärker leiser, weil sie keine Lust auf eine Standpauke von ihrem Vater hatte. „Ich dachte, du lernst!“, würde er sagen. Dabei drehte er seine klassische Musik auch immer auf volle Lautstärke, wenn er sich aufs Sofa legte, um darüber nachzudenken, wie sein Roman weiterging. Bei lauter Musik konnte man einfach besser arbeiten und lernen.
„Kannst du mal Nicole vom Bus abholen?“
Ah, ihre kleine Schwester hatte heute Nachmittagsunterricht. Warum kam sie nicht mit dem Fahrrad nach Hause? Normalerweise fuhr sie immer den Kilometer zur Bushaltestelle mit dem Fahrrad und stellte es dort ab.
„Klar!“, schrie sie zurück. „Warum fährt sie nicht mit dem Fahrrad?“ Sie trat aus der Tür und blickte die Treppe nach oben, wo ihr Vater stand.
„Ach, die hat heute Früh verschlafen, und ich musste sie kurz rüberfahren.“ Er winkte ungeduldig ab.
Oh, das war interessant. Bei der Schwester ließ er es also durchgehen, wenn sie mal zu spät aufstand. Okay, sie war ja auch sechs Jahre jünger.
„Und bring noch was zu essen mit“, ergänzte er.
„Was?“
„Leberkäs oder Würstchen“, erklärte er knapp. „Ich bin morgen wieder in der Redaktion und bringe was Vernünftiges mit.“
So war das eben … entweder gab es Delikatessen vom Käfer … oder den letzten Fraß. Die Redaktion der Zeitschrift, für die er arbeitete, lag am Prinzregententheater, genau gegenüber vom Käfer, einem Delikatessengeschäft in München. In seiner Freizeit arbeitete er gerade an einer Fernsehserie, die produziert werden sollte.
„Ich bring was mit. Hast du Geld?“
Der Vater zog den Geldbeutel aus der Gesäßtasche seiner verbeulten Jeans und zog einen Zwanzig-D-Schein hervor. „Hier!“
„Okay!“
Krissy startete den Motor des alten, schon mit Rostspuren übersäten VW Variant, mit dem sie alle zwei Wochen riesige Heuballen auf dem Dach von der Baywa in Irschenberg nach Kleinhöhenrain transportierten. Das reichte knapp, um die Pferde damit zu füttern. Inzwischen musste Krissy die Strecke fahren, weil es dem Vater auf die Nerven ging. Sie hatte kaum die Kraft, die schweren Heuballen so weit hochzuheben, aber einer der Mitarbeiter half ihr immer dabei. Hinter ihr wehte jedes Mal eine ganze Wolke Heu und sie hatte Angst, dass sie von der Polizei angehalten wurde. Wie viel durfte man eigentlich auf einem Autodach transportieren?
Sie fuhr zum nächsten Ort, trat in den kleinen Tante-Emma-Laden und begrüßte Gundi, die Tochter der Inhaberin. Gundi war professionell freundlich, ansonsten hatte Krissy mit ihr keinen Kontakt – obwohl sie ungefähr im gleichen Alter waren: neunzehn. In den Regalen stapelten sich Birkelnudeln, Sauerkraut, geschälte Tomaten und Kartoffelbrei. In der Auslage gab es verschiedene Wurstsorten, Würstchen, Wurstsalat und ein wenig Käse. Als Angebot gab es Putenfleisch von der benachbarten Putenfabrik. Auch keine schlechte Idee. Krissy dachte darüber nach, ob ihr Vater wohl von einem Putensteak begeistert wäre oder ob er seine Bestellung wörtlich gemeint hatte. Sie schnappte sich eine Dose Ananas und bestellte souverän vier Truthahnschnitzel. Außerdem nahm sie ein Päckchen Beutelreis mit. Heute würde es Putencurry mit Reis geben. So etwas konnte sie kochen – oder Suppengemüse mit Wiener-Würstchen. In der Tiefkühltruhe lagen auch immer Iglo-Steaks oder Rahmspinat.
„Geht’s euch gut?“, fragte Gundi.
„Klar!“, versicherte Krissy. Mehr sagte sie nicht, denn sie wusste, dass die Frage reine Höflichkeit war. Ganz sicher würde sie dieser Person keine Neuigkeiten auf die Nase binden. Sie war die Ratschkatl des Dorfes. Wenn man wollte, dass sich eine Nachricht möglichst schnell verbreitete, musste man es ihr nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählen.
Krissy sah, dass der Schulbus an dem Geschäft vorbeifuhr, und verabschiedete sich. „Pfiat di …!“, sagte sie weltmännisch auf Bairisch.
An der Bushaltestelle nahm sie ihre Schwester in Empfang. „Na, alles klar?“
„Ne, habe ‘ne Fünf in Englisch!“, antwortete Nicole. „Keine Ahnung, wie ich das Papa beichten soll.“
„Oje. Musst du es unterschreiben lassen?“
Die Schwester nickte nur, und ihre Augen wurden verdächtig feucht.
Krissy zuckte mit den Schultern. „Zeig es ihm einfach. So wie ich Papa kenne, fährt er hin und reißt dem Lehrer das Herz heraus.“
Nicole kicherte getröstet. „Wahrscheinlich.“
„Hattest du wenigstens gelernt?“
„Ich habe sogar mit Papa geübt. Irgendwie habe ich die Aufgabe nicht ganz verstanden.“
„Siehst du. Er wird sagen, dass der Kerl zu doof ist, seine Aufgaben so zu formulieren, dass die Schüler sie verstehen.“
Nicole seufzte erleichtert. „Du meinst, er wird mich nicht schimpfen?“
„Ach was …!“
„Und du?“ Die Schwester musterte sie von der Seite.
„Ich muss noch ausreiten. Die Pferde stehen schon wieder seit zwei Tagen.“ Krissy klang resigniert. „Und geputzt wurden sie auch noch nicht.“
„Lass sie halt auf die Koppel.“
„Zu nass!“, widersprach Krissy. „Die ist nur noch Acker.“ Krissy kniff die Lippen zusammen. Der hintere Teil des Gartens war zu einer Koppel umfunktioniert worden, die jedoch für die beiden Pferde eher zu klein war. Also ließen sie die Pferde nur bei trockenen Wetter hinaus. Das hieß aber wiederum, dass Krissy tatsächlich bei schlechtem Wetter ausreiten musste, damit die Tiere keinen Stallkoller bekamen. Nicole sagte nichts, denn sie hatte Angst, zum Mitkommen aufgefordert zu werden.
„Du könntest schnell ausmisten, wenn ich unterwegs bin“, bat Krissy.
„Okay“, erklang es reichlich lustlos.
Das Abendessen verlief entspannt, obwohl der Vater von der Fünf in Englisch nicht begeistert war. Wortlos unterschrieb er die Schulaufgabe und wandte sich dann einem anderen Thema zu. Ihn interessierte mehr die Idee, ins Ausland zu gehen, die Krissy in den Raum geworfen hatte.
„Vielleicht kein schlechter Gedanke“, brummte er. „Da kannst du erst einmal erwachsen werden. Sonst spielst du mit fünfundzwanzig immer noch mit Barbiepuppen.“
Krissy verdrehte die Augen. Wenn überhaupt, spielte sie höchstens mit der Schwester … und die war zwölf.
„Es gibt da so ein Programm, für das man sich bewerben kann: Für ein Jahr darf man in Kanada als Nanny in einer Familie arbeiten. Man bekommt ein Taschengeld und freie Logis, dafür hilft man im Haushalt und passt auf die Kinder auf.“
„So etwas gibt es doch bestimmt auch für England“, vermutete der Vater.
„Ich will aber nach Kanada.“ Der Trotz regte sich in ihr.
„Aha … und wo bewirbt man sich da?“
„Bei der kanadischen Botschaft in Bonn. In der Schule lagen Flyer rum – da bringe ich einen mit.“
Ingrid, die neue Freundin des Vaters, schaute interessiert hoch.
„Oh, nach Kanada! Ist das nicht ein bisschen weit?“
Krissy zuckte mit den Schultern. „Aber da kann ich so viel lernen … so eine Möglichkeit bietet sich nur einmal im Leben!“
„Und dein Studium?“
„Dazu muss sie erst einmal das Fachabitur schaffen. Außerdem gibt es fürs Studium einen Numerus Clausus. Keine Ahnung, wie sie den schaffen will.“ Die Stimme des Vaters vibrierte verächtlich.
„Ich schwanke bloß in Mathe!“, verteidigte sich Krissy. „In den anderen Fächern stehe ich auf zwei.“
Der Vater hob überrascht die Augenbrauen. „Echt?“
Krissy nickte und grinste schief. „Ja, echt! Ich habe alle Noten genau notiert. Im Moment stehe ich auf 2,3. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich im Abitur nicht verschlechtere.“
„Siehste, du hättest doch das normale Abitur bestanden“, murmelte der Vater nicht ganz unzufrieden.
„Ja, aber da hätte ich mich weiter mit Latein und Französisch herumgeärgert. Psychologie und Pädagogik liegen mir halt mehr. Und das Praktikum letztes Jahr hat mir auch viel mehr Spaß gemacht.“
„Na ja … wenigstens hast du jetzt ein wenig Erfahrung mit Kindern …“
„Genau! Das macht sich gut bei meiner Bewerbung: Erfahrung mit Kindern, Erste Hilfe und Säuglingspflege.“ Krissy war froh über die Praktika im Kindergarten und anschließend im Krankenhaus auf der Säuglingsstation.
Die nächsten Wochen büffelte Krissy jeden Nachmittag und am Wochenende auf die Abiturprüfungen. Sie hatte die Definitionen der psychologischen und pädagogischen Fachbegriffe auf Karteikarten geschrieben und lernte sie auswendig. In Mathe konzentrierte sie sich auf Stochastik. Mit ein bisschen Glück würde das für eine vier reichen. Für Deutsch konnte man nichts lernen … da kam es aufs Thema an – und in Englisch reichte ihr der dicke Vorsprung, den sie durch das Gymnasium hatte. Außerdem stöberte sie durch die Unterlagen, die sie von der kanadischen Regierung bekommen hatte. Sie hatte ein Bewerbungsschreiben aufgesetzt und bereits Rückmeldungen von kanadischen Familien bekommen.
Eine Familie hatte ihr aus Calgary geschrieben, die dort auf einer Ranch lebte. Ihr wurde ein bisschen mulmig, als sie an die weiteren Formalitäten dachte. Sie brauchte einen Reisepass und musste zu einem Vorstellungsgespräch in die kanadische Botschaft. Es wäre das erste Mal, dass sie alleine bis nach Bonn reisen würde. Eigentlich eine ganz gute Übung, ehe sie bis nach Kanada fliegen würde. Der Vater war nicht ganz so glücklich über das entfernte Reiseziel, denn er musste das Flugticket bezahlen. Er stritt mit der Mutter über die exorbitanten Kosten und einigte sich schließlich mit ihr darauf, dass beide je die Hälfte bezahlen würden. Immer dieser Streit ums Geld. Krissy war mehr als genervt, und es trübte die Freude auf die Reise.
„Du könntest ja mal ein bisschen was dazuverdienen!“, schimpfte der Vater.
„Nach dem Abitur … wenn dann noch Zeit ist“, giftete Krissy zurück.
Sie hatte schon mal in der Höhenrainer Truthahnfabrik als Packerin gejobbt, und danach beschlossen, dass es doch besser wäre, das Abitur zu bestehen und ein Studium aufzunehmen. Den ganzen Tag am Fließband zu stehen und glitschiges Putenfleisch abzuwiegen, war nicht so das Ihre. In Gröbenzell hatte sie ihr Taschengeld durch Babysitten aufgebessert, aber hier gab es diese Möglichkeit nicht.
Die Abiturprüfungen liefen ganz gut, und so machte sie einen Termin in der Botschaft aus. Sie musste am Tag davor anreisen und in einem Hotel übernachten, um pünktlich um zehn in der Botschaft zu erscheinen. Mit der S-Bahn fuhr sie nach Bad Godesberg, wo sich die kanadische Botschaft befand. Sie trug eine moderne Karottenjeans, auf die sie sehr stolz war, und eine weiße Bluse - darüber eine selbst gestrickte Bolerojacke. Sie hatte von Tine das Stricken gelernt und im Unterricht immer gestrickt. Irgendwie konnte sie sich da den Stoff besser merken, auch wenn die Lehrer genervt von den ganzen Mädchen waren, die eifrig vor sich hin strickten.
Das Gespräch in der Botschaft war kurz und verlief in angenehmer Atmosphäre. Die Angestellte stellte ein paar Fragen auf Englisch, die Krissy fließend beantworten konnte. Auf die Frage, wie lange sie in Kanada bleiben würde, sagte Krissy, dass sie nach dem einen Jahr zurück nach Deutschland wolle, um ein Studium zu beginnen. Mit einem Lächeln verabschiedete sich die freundliche Dame und erklärte, dass man ihr den Pass mit dem Visum und Work-Permit in den nächsten Tagen zuschicken würde. Gleich nach der Abschlussfeier könne sie fliegen.
Krissy war etwas perplex, so schnell wieder draußen zu sein, und schlenderte zurück zur S-Bahn. Viel zu früh war sie wieder am Hauptbahnhof in Bonn. Ihr Zug ging erst in drei Stunden, und sie überlegte, was sie so lange tun sollte. Mit ihrem kleinen Köfferchen ging sie durch die Bahnhofshalle und kaufte sich einen neuen Western im Kiosk: Ronco, der Geächtete. Schnell versank sie in der Welt des Wilden Westens und vergaß die Zeit um sich herum. Sie hatte das Heft ausgelesen, als sie in München ankam und mit der S-Bahn bis nach Aying fuhr, wo der Vater sie abholte. „Und?“, fragte er mit einem wohlwollenden Unterton. Er war sichtlich stolz, dass seine Tochter die Reise gemeistert hatte.
„Alles in Ordnung. Ich bekomme das Work-Permit und kann fliegen.“
„Puh, also dann … hoffentlich bekommst du kein Heimweh. Hast du dir das auch wirklich überlegt?“
„Ja! Ich sage jetzt der Familie, dass ich kommen kann. Gleich nach der Abschlussfeier werde ich fliegen.“
„So schnell? Da werde ich mich mal so langsam um einen Flug kümmern müssen.“
Die Zeit bis zum Abflug verging wie im Fluge. Krissy hatte noch wenige Tage Schule, in denen sie auch die Abschlussnoten erfuhr. In Englisch musste sie ins Mündliche, um ihre Note zu verbessern – was sie auch tat. In Mathe hätte sie sich auch verbessern können, aber die mündliche Prüfung war so spät angesetzt, dass sie nicht mehr nach Hause gekommen wäre. Also verzichtete sie darauf. Ihr Notenschnitt reichte für ein Studium der Sozialpädagogik und würde sich durch die Wartezeit noch verbessern. Sie hatte keine Lust, den ganzen Nachmittag in der Schule herumzuhängen und anschließend noch ihren Vater anzurufen, damit er sie aus Rosenheim abholen kam. Sie verabschiedete sich von den zwei Freundinnen, die sie in den kurzen zwei Jahren in der Fachoberschule gefunden hatte und die ganz gespannt darauf waren, was sie aus Kanada zu berichten haben würde.
Eine wollte anschließend die Fachakademie besuchen, um Erzieherin zu werden, während Tine lieber gleich mit dem Studium beginnen wollte. Sie hatte einen festen Freund namens Rudi – sonst hätte sie ein Jahr im Ausland vielleicht auch gereizt. Krissy fand Rudi irgendwie doof und langweilig. Er war älter als Tine und wahnsinnig konservativ.
Zur Zeugnisübergabe mit anschließender Feier kamen tatsächlich beide Elternteile mit, und Krissy war stolz, dass sie es geschafft hatte. Die Eltern stritten sich zur Abwechslung mal nicht, sondern unterhielten sich über die bevorstehende Reise. Krissy war schweigsam, denn sie verstand noch immer nicht, warum ihre Eltern sich getrennt hatten. Am Wochenende besuchte sie ihre Mutter in Fürstenfeldbruck, die ihr versprochen hatte, ein paar Kleidungsstücke für sie herauszusuchen. Es war lustig, im Schrank der Mutter zu wühlen und die Röcke anzuprobieren. Ihre Mutter liebte einen klassischen Schnitt, und so wurde Krissy kaum fündig. Aber sie staubte mehrere Röcke, Blusen und einen ponchoartigen Lodenmantel ab, der irgendwie pfiffig aussah.
Großzügigerweise bekam sie sogar einen Zuschuss von der Mutter, damit sie sich noch warme Winterstiefel kaufen konnte. „In Kanada liegt bestimmt viel Schnee!“, meinte sie.
Kurz darauf wurden all ihre Pläne über den Haufen geworfen, als die Familie in Calgary plötzlich absagte. Zum Glück hatte Vater das Flugticket noch nicht gekauft, sodass erst einmal nur Zeit verloren ging. Außerdem kamen schnell weitere Anfragen, auch von einer Familie aus Toronto, die kurzfristig eine Nanny suchte, weil ein Baby unterwegs war. Der Brief klang nett, und Krissy überlegte, ob sie der Familie zusagen sollte. Frau Goodman schrieb, dass ihr Ehemann schon drei erwachsene Kinder aus erster Ehe hätte und nun ganz aufgeregt auf den weiteren Nachwuchs wartete. Sie erzählte von ihrem schönen Haus und einem Cottage, in dem sie immer das Wochenende verbringen würden – und dass die Schule für den Englischkurs ganz in der Nähe liegen würde. Krissy hatte das Gefühl, dass diese „Lyndsay“ ganz nett sein würde, und entschied sich, es einfach mal zu versuchen. Sie hatte Angst, dass sich die Abreise sonst noch weiter verzögern würde. Außerdem hatte man ihr versichert, dass sie auch in Toronto noch die Familie wechseln könnte, wenn es nicht passen sollte.
Ihr Vater war ganz zufrieden, dass nun Toronto das Ziel war, denn der Flug dorthin kostete deutlich weniger, als wenn sie bis nach Calgary geflogen wäre.
Leider wurden ein paar Tage später die Pferde abgeholt – im Streit mit dem Vorbesitzer, der den Vater einen Gauner schimpfte. Krissy tat es einerseits leid, denn sie hatte die Tiere gerngehabt; andererseits war sie froh, dass die viele Arbeit ein Ende hatte. Der Vater wollte den Stall nun komplett als Wohnhaus herrichten und dann den vorderen Teil des Bauernhauses mit Gewinn verkaufen. Er war ganz begeistert von der Idee und fuhr durch die Gegend, um alte Bauerntüren zu kaufen. Er wollte den hinteren Teil ebenfalls möglichst stilecht in einen alten Bauernhof verwandeln.
Am schlimmsten war für Krissy der Abschied von ihrem Hund Coco. Sie hatte ihn erzogen und ihm Kunststücke beigebracht. Ihn in der Obhut der Schwester und des Vaters zurückzulassen, fiel ihr schwer. Sie wusste, dass der Vater nicht gut auf ihn aufpassen würde, und hatte Angst, dass ihn eines Tages der Jäger erwischen würde. Aber leider konnte sie ihn nicht mitnehmen. „Bitte, pass auf ihn auf!“, bat sie ihre Schwester.
„Der passt schon auf sich selber auf“, meinte die Schwester wenig mitfühlend. „Wir müssen nur verhindern, dass er noch mal die Colliehündin vom Bürgermeister deckt … der kommt sonst hier vorbei und schießt auf Papi.“
Krissy fand das wenig beruhigend. „Das meine ich ja eben … ich habe Angst, dass irgendein Jäger ihn erschießt.“
„Oh, du meinst, weil er ins Hirschgehege vom Thaler eingebrochen ist?“
„Ist er nicht!“, sagte Krissy bestimmt. „An diesem Tag hatte ich ihn mit zu Mami genommen. Nachweislich.“
„Stimmt!“, gab ihr die Schwester recht. „Aber der Thaler glaubt dir das trotzdem nicht.“
Anfang September 1981 ging Krissy mit ihrer Schwester noch ins Kino, um sich die Premiere von „Jäger des verlorenen Schatzes“ anzuschauen. Nach „Star Wars“ war es spannend, Harrison Ford in einer anderen Rolle zu sehen. Der Film war genau richtig, um von allen trüben Gedanken abzulenken: lustig, atemberaubend spannend und mit tollen Sprüchen. Krissy lachte sich kaputt und fand, dass Harrison Ford auch in dieser Rolle glänzte. Dem Vater fehlte ein wenig der intellektuelle Anspruch, und er wartete bereits auf die Premiere des Films „Das Boot“, der im Oktober herauskommen sollte.
Toronto
Der Tag der Abreise kam dann doch recht schnell: Sie hatte noch zwei Wochen in der Truthahnfabrik gearbeitet, was ihren Vater sehr versöhnt hatte, weil sie nun genug Taschengeld für die Anfangszeit in Kanada dabeihatte. Sie würde ihr Gehalt immer erst am Ende des Monats erhalten, und so hatte er schon befürchtet, ihr auch noch ein großzügiges Taschengeld mitgeben zu müssen. Krissy kaufte sich noch ein paar Kleinigkeiten: Seidenstrümpfe und eine weitere ordentliche Bluse. Der Haushalt der Goodmans war neureich, und sie wollte von Anfang an einen guten Eindruck machen. Den Rest des Geldes tauschte sie in kanadische Dollar.
Das Kofferpacken stellte sie vor ein Problem: Was nahm man mit, wenn man ein Jahr in der Fremde verbrachte? Außerdem gab es Gepäckbeschränkungen. Ihre Mutter meinte, dass sie erst einmal etwas für die kalte Jahreszeit mitnehmen sollte. „Sommersachen kannst du dir im Frühjahr von deinem Gehalt kaufen.“ Da hatte sie wohl recht.
Also stopfte Krissy Unterwäsche, Strümpfe, Röcke, Blusen, Hosen und einen warmen Winterpullover in den Koffer. Mit den Schuhen wurde es richtig eng: Sie entschied, die Winterstiefel und den Mantel anzuziehen, um Platz zu sparen. Anschließend packte sie ihre Halbschuhe, Hausschuhe und leichtere Sandalen in den Koffer. Sie konnte ihn nur schließen, indem sie sich draufsetzte und ihre Schwester den Reißverschluss zuzog. Nicole war still, denn sie fühlte sich von Krissy im Stich gelassen. „Was soll ich denn hier ganz alleine?“, fragte sie vorwurfsvoll.
Krissy tätschelte ihr die Wange. „Du hast doch immerhin ein paar Freunde …!“, versuchte sie Nicole zu trösten.
„Ja, aber nur in der Schule. Ansonsten bin ich hier allein.“
„Und das Nachbarmädel? Mit der spielst du doch ganz oft.“
„Ach, die muss doch immer auf dem Hof helfen. Und ich sitze hier und bin allein. Papi hat auch nie Zeit.“
„Warum fährst du nicht öfter zu Mami?“
„Wie … und dann soll ich um vier Uhr morgens aufstehen und zur Jagd mitgehen … nee … keinen Bock!“
Krissy verstummte. Sie war so froh, von hier wegzukommen, dass sie nicht daran gedacht hatte, ihre Schwester damit im Stich zu lassen. Sie hatte ein schlechtes Gewissen. „Ich schreibe dir ganz oft!“, versprach sie lahm.
„Okay!“ Nicole nickte gnädig. Sie wusste, dass sie Krissy nicht mehr von ihren Plänen abhalten konnte.
Als der Tag des Abflugs kam, fuhr der Vater sie zum Flughafen Riem. Er brachte sie zum Schalter und verabschiedete sich in seiner spröden Art recht kurzangebunden von ihr. „Du, ich muss weiter zur Redaktion. Wir haben eine Besprechung. Guten Flug – und melde dich, wenn du angekommen bist.“ Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn und verschwand mit großen Schritten durch den Ausgang.
Krissy seufzte und zog das Ticket aus ihrer Tasche. Das Gepäck wurde eingecheckt, und sie ging zum Gate, um auf den Abflug zu warten. Ein bisschen mulmig war ihr jetzt doch! Sie überspielte die Nervosität und orientierte sich an den anderen Reisenden. Es war ein Lufthansa-Flug, der nach London ging. Dort sollte sie umsteigen. Ihr Vater hatte ihr noch Tipps gegeben, damit sie in London nicht verlorenging. „Du musst den Airport wechseln! Also erkundige dich genau, wo du hinmusst, sonst verpasst du den Anschlussflug. Frag die anderen Passagiere, ob jemand vielleicht auch nach Toronto fliegt und dich mitnimmt.“
Krissy blickte sich um und überlegte, wen sie wohl fragen sollte. Jeder der Mitreisenden schien vollauf damit beschäftigt zu sein, irgendeine Zeitung zu lesen. Die meisten waren ohnehin Geschäftsreisende. Sie fragte die Stewardess, die ihr aufmunternd zulächelte. „Keine Sorge, gleich beim Ausgang ist eine Auskunft. Die sagt Ihnen genau, wo Sie hinmüssen. Das ist gar kein Problem.“
Puh! Wenn das so einfach wäre!
Der Flug verging schnell, und staunend blickte sie auf London hinunter, das sich unter ihr ausbreitete – eine Stadt, die sich bis zum Horizont erstreckte. Den Airport zu wechseln, war doch kein großes Problem, und bereits zwei Stunden später stieg sie mit klopfendem Herzen an Bord der Air Canada und ließ sich ihren Platz zeigen. Auf dem Sitz lag ein Headset, damit sie Musik hören und später fernsehen konnte. Sie probierte die Sender aus und blieb bei einem Kanal mit Rockmusik hängen. Das Flugzeug war groß und füllte sich mit den Passagieren. Jeder machte es sich bequem und richtete sich für den langen Flug ein. Der Kapitän machte eine Durchsage auf Englisch, die Krissy nur zur Hälfte verstand. Irgendetwas von Turbulenzen und schlechtem Wetter. Das konnte ja was werden!
Draußen ging langsam die Sonne unter, und die Stewardess gab über Funk bekannt, dass sie bereits Startfreigabe hätten. Anschließend würde das Abendessen serviert werden. Super! Krissy hatte langsam Hunger und freute sich auf das Essen. Im Flughafen hatte sie sich nichts gekauft, weil sie ihr Geld für Kanada sparen wollte. Außerdem erschien ihr alles überteuert – abgesehen davon, dass sie keine britischen Pfund dabeihatte.
Das Abendessen bestand aus einer warmen Mahlzeit: Hühnchen mit Curryreis, Salat und einem Pudding. Krissy hatte einen solchen Hunger, dass sie alles im Nu verspeiste. „Noch Hunger?“, wunderte sich die Stewardess, als sie das leergeputzte Tablett abräumte. Krissy nickte etwas enttäuscht. Sie hätte leicht die doppelte Menge verdrücken können. Die Stewardess lachte hellauf und brachte ihr noch eine Tüte Chips. „Zum Nachtisch!“, meinte sie fröhlich.
Krissy bedankte sich und schaute gespannt aus dem Fenster. Draußen war der Sonnenuntergang spektakulär. Am Horizont konnte man den riesigen Feuerball sehen, der über dem Meer verschwand. Der ganze Himmel war in ein tiefes Rot getaucht, das langsam in Lila, Dunkelblau und Schwarz überging. Dann tauchten immer mehr Wolken auf, die den Blick auf das Meer verbargen. Erste Turbulenzen erschütterten das Flugzeug.
Einige Sitzreihen weiter vorne öffnete sich ein Fach an der Decke der Kabine, und ein Bildschirm wurde heruntergefahren. Krissy setzte das Headset auf und freute sich auf den Film. Sie seufzte. Ausgerechnet ein alter Schinken wurde gezeigt: „Ein Amerikaner in Paris“ mit Gene Kelly und Leslie Caron. Sie schaute ihn sich aber doch an, um die Langeweile zu vertreiben. Müde versuchte sie, ein bisschen zu schlafen. Dadurch, dass sie mit der Sonne flog, würde es ein langer Abend werden.
Sie wachte auf, als das Flugzeug ein gutes Stück absackte und kräftig durchgeschüttelt wurde. Die Anschnallzeichen blinkten immer noch, und so war sie angeschnallt im Sitz eingeschlafen. Vor ihr rauchte jemand, und der Zigarettenqualm stieg ihr in die Nase. „Stellen Sie bitte das Rauchen ein!“, sagte die Stewardess, als sie im Gang vorbeikam.
Es folgte eine Ansage des Kapitäns, dass sie einen Zwischenstopp in Montreal einlegen würden, weil durch den starken Gegenwind der Treibstoff nicht reichte. Krissy seufzte über die unfreiwillige Verlängerung der Reise. Würde so spät noch jemand am Flughafen sein, um sie abzuholen?
Mit zwei Stunden Verspätung landeten sie schließlich in Toronto. Hier war es später Abend. Krissy kam ohne Schwierigkeiten durch die Passkontrolle und wartete auf ihr Gepäck. Ihre Aufregung stieg, als sie sich dem Ende ihrer Reise näherte. Ihr Herz klopfte, und ihr Kopf rötete sich, als sie sich dem Ausgang näherte. Ihr Blick wanderte hin und her, als sie darauf hoffte, dass noch jemand auf sie warten würde. Weiter hinten entdeckte sie endlich eine kleine Tafel, die von einer ihr unbekannten Frau hochgehalten wurde: ‚Krissy Konrad‘ stand dort in roten Buchstaben.
Krissy seufzte erleichtert und stellte sich der Frau vor. „Ich bin Krissy“, murmelte sie und streckte der Fremden die Hand hin. Es war nicht Frau Goodman, denn von ihrer Gastmutter hatte sie bereits ein Foto gesehen.
„Ich bin Ellis Kaufmann“, antwortete die Dame auf Deutsch. „Mrs. Goodman hat mich gebeten, dich abzuholen. Sie ist mit dem Baby beschäftigt. Ich bin eine Freundin.“
„Danke!“, meinte Krissy artig. „Tut mir leid, dass ich so spät bin, aber wir mussten in Montreal zwischenlanden.“
„Kein Problem. Die Verspätung wurde ja angezeigt. Nur der Fahrer musste ein bisschen umdisponieren. Er hatte anschließend noch einen anderen Auftrag, den er an jemand anderen delegieren musste.“
„Welcher Fahrer?“
„Mrs. Goodman hat einen Chauffeur geschickt.“ Ellis lächelte und zeigte auf einen jungen Mann neben sich, den Krissy bisher nicht beachtet hatte. Der Chauffeur lächelte freundlich und reichte ihr die Hand. „Ma’am, darf ich Ihr Gepäck nehmen?“
Krissy wusste nicht, was sie davon halten sollte. Ein Chauffeur – mit Schrecken dachte sie an die Kleidung, die sie eingepackt hatte. Wäre es genug für so einen noblen Haushalt?
Fast ein wenig eingeschüchtert folgte sie den beiden bis zum Parkhaus des Flughafens und stieg in die schwarze Limousine.
Unkonzentriert folgte sie dem Gespräch, das Ellis mit ihr führte, und beantwortete einsilbig die Fragen. Die Dame erzählte, dass auch sie ursprünglich aus Deutschland stamme, aber hier mit einem Kanadier verheiratet sei. „Meine Tochter ist in deinem Alter und spricht ein bisschen Deutsch. Mrs. Goodman meinte, dass ihr euch vielleicht mal kennenlernen solltet. Wir haben eine Cottage an der Georgian Bay und könnten dich mal mitnehmen. Was meinst du?“
„Georgian Bay?“
„Ja, das ist so ein bis zwei Stunden nördlich von hier. Ein wunderschöner See mit Sandstrand. Viele Leute fahren da am Wochenende hin.“
„Gerne! Ich meine – wenn es Mrs. Goodman recht ist.“ Für Krissy kam diese Einladung etwas verfrüht. Erst einmal wollte sie doch ihre Gastfamilie kennenlernen.
Die Fahrt dauerte vielleicht eine gute Stunde, doch dann rollte die Limousine eine Einfahrt hoch. Krissy kam sich vor wie bei „Dallas“ – einer Serie, die in Deutschland gerade erst gestartet war und von einem Ölmagnaten in Texas handelte. Die Familie lebte in einem Luxus, den man sich bis dato nicht vorstellen konnte. Aber so ungefähr musste sich das anfühlen: ein gepflegter Rasen, eine richtige Einfahrt und ein Bürgerhaus, das wie aus dem 19. Jahrhundert wirkte – natürlich auf das Teuerste restauriert. Das war also ihr neues Zuhause!
Krissy stieg aus dem Wagen und verabschiedete sich von dem Chauffeur, der ihren schweren Koffer aus dem Kofferraum wuchtete. Ellis ging bereits zur Tür und klingelte. Es war Mrs. Goodman, die öffnete. Sie gab Ellis ein Küsschen auf die Wange und strahlte anschließend Krissy an. „Welcome! I am Lyndsay!“
„Hello, Mrs. Goodman!“, begrüßte Krissy ihre Gastmutter.
„But no, please call me Lyndsay!”, wurde sie sogleich verbessert.
Krissy nickte nur höflich und ließ sich von den beiden Frauen ins Haus ziehen. Kurz erhaschte sie einen Blick auf die Küche, die sich links befand, und eine kleine Bibliothek, die gegenüber dem großzügigen Eingang lag.
Mrs. Goodman geleitete Krissy in den Keller, wo ein Gästezimmer und ein Fotostudio untergebracht waren. Außerdem gab es ein Fitnessstudio und weitere Räume, die wohl eher zur Lagerung benutzt wurden. Das Gästezimmer war geschmackvoll eingerichtete und hatte sogar ein Fenster mit Tageslicht.
„So, das ist dein Zimmer“, erklärte Ellis. „Morgen wird Lyndsay dir deine Aufgaben erklären. Aber heute gibt es erst einmal Abendessen.“
Krissy stellte den Koffer neben einen kleinen Schrank und folgte den beiden ins geräumige Esszimmer. Daneben gab eine Tür den Blick auf ein riesiges Wohnzimmer frei. Der Tisch im Esszimmer war gedeckt, und Krissy setzte sich auf den ihr zugewiesenen Stuhl. Mrs. Goodman holte aus der Küche einen dampfenden Topf und verteilte mit einem Schöpflöffel einen Eintopf, den sie selbst zubereitet hatte. Krissy hatte Hunger und schaufelte das Essen in sich hinein. Es schmeckte lecker!
Beim Abräumen half sie bereitwillig mit und inspizierte dabei gleich die Küche. Sie war modern eingerichtet und hatte sogar aus alten Tagen noch einen Dienstboteneingang. Krissy fand das schräg, aber auch sehr praktisch. Überall standen Blumen mit Grußkarten herum – offensichtlich noch Glückwünsche zur Geburt des Sohnes.
Endlich führte Mrs. Goodman sie zum eigentlichen Grund ihres Kommens: ins Kinderzimmer zu Joshua, dem neugeborenen Sohn von Lyndsay.
Krissy schmolz dahin, als sie das Baby sah. Es lag in einer Wiege, die mit weißem Stoff ausgekleidet war. Das ganze Zimmer war in Weiß gehalten, was Krissy als ein bisschen trist empfand: ein weißer Schrank, eine weiße Wickelkommode, weiße Tapeten und ein riesiger Spiegel. Na ja, sie musste ja hier nicht leben! Sie durfte Joshua kurz auf den Arm nehmen, dann legte ihn Lyndsay zurück in die Wiege.
Krissy war müde und wollte sich schließlich in ihr Zimmer zurückziehen. Sie verabschiedete sich von den beiden und verschwand im Keller, um ihren Koffer auszupacken. Sie hatte keine Ahnung, was am nächsten Tag von ihr erwartet wurde.
Früh am Morgen stand Krissy auf und ging in die Küche. Mr. Goodman, den sie bisher noch nicht kennengelernt hatte, saß an einem kleinen Tisch und las die Zeitung. Er blickte kurz auf, nickte freundlich und vertiefte sich wieder in die Lektüre. Krissy fand ihn jetzt schon seltsam. Mit einem stillen Seufzen öffnete sie die Kühlschranktür und holte sich eine Milch heraus. Lyndsay hatte ihr gesagt, dass sie sich jederzeit bedienen durfte. Im Schrank suchte sie nach einem Müsli und wurde fündig: „Quaker‘s Harvest Brunch“. Sie füllte sich ein Schälchen und setzte sich zu Mr. Goodman an den Tisch. Er sah auf und warf ihr einen verwunderten Blick zu. Sie runzelte verunsichert die Stirn. Betrachtete er sie mehr als Personal – und nicht als neue Haustochter? Aber wo sollte sie sich zum Essen hinsetzen? Sie blieb also und aß das Müsli, aber sie hatte vor, Lyndsay darauf anzusprechen.
Kurz darauf wurde es lebhaft im Haus, als die Hebamme eintraf. Sie hieß Alice und war ebenfalls deutschstämmig. Sie verdiente sich ihren Lebensunterhalt, indem sie in sogenannten „reichen Haushalten“ die ersten Wochen nach der Entbindung als Hebamme aushalf. Krissy fand das ganz schön abgehoben. Andererseits war sie froh, dass ihr jemand zur Seite stand.
Der Vormittag verging mit Babybaden und Wickeln, wobei sie von Alice gute Tipps erhielt. Joshua streckte sich wohlig in dem warmen Bad und schien es zu genießen, im Wasser herumzustrampeln. Krissy durfte ihn baden, da sie erwähnte, dass sie dies schon oft auf der Säuglingsstation des Krankenhauses getan hätte. Alice war mit ihren Kenntnissen sehr zufrieden und teilte Lyndsay mit, dass Krissy sich bestimmt gut um das Baby kümmern würde.
Am Nachmittag erhielt Krissy von Mrs. Goodman eine Unterweisung über ihre Aufgaben. Es war eine ganze Litanei: Neben Staubsaugen, Putzen, täglichen Wechseln der Handtücher und wöchentlichem Wechseln der Bettwäsche sollte sie noch kochen, sich um das Baby kümmern und abends selbstverständlich babysitten. Lyndsay erklärte ihr die Funktionsweise von Waschmaschine und Trockner und zeigte ihr einen Wäscheschacht, über den sie die Wäsche einfach in den Keller fallen lassen konnte. Den fand Krissy richtig praktisch. In der Waschküche gab es auch ein Bügelbrett, wobei Lyndsay erlaubte, dass sie die Wäsche auch in der kleinen Bibliothek bügeln durfte – da sei ein Fernseher. Ah, bügeln soll ich also auch, machte sich Krissy eine Notiz in ihrem Kopf. Wann habe ich eigentlich Freizeit?
In der Bibliothek fand sie auch ein kleines Heftchen mit dem Fernsehprogramm. Sie konnte es kaum glauben, wie viele Sender es in Kanada gab! Es gab sogar einen Sender, auf dem hauptsächlich alte Western liefen. Cool!
Aufgeregt registrierte sie, dass am Nachmittag ihr Lieblingsfilm laufen würde: „Flaming Star“ mit Elvis Presley. Sie musste jedes Mal weinen, wenn Elvis als das Halbblut Pacer schwer verletzt zur Stadt ritt, um nachzusehen, ob sein Bruder es geschafft hat. Sie hatte sofort einen Kloß im Hals, als sie an den berühmten Satz „Ich habe den flammenden Stern des Todes gesehen“ dachte – und wie Pacer zum Sterben in die Ferne reitet. Zu Hause hatte sie immer geträumt, dass der Film noch weitergeht und ihr Held doch irgendwie überlebt – vielleicht von den Indianern gefunden und gesundgepflegt wurde. In ihrem Zimmer hing ein mannsgroßes Poster von Elvis in dieser Rolle an der Wand. Ob sie sich den Film anschauen durfte?
In einem anderen Programm lief „Star Trek“ in Dauerschleife, und abends liefen neue Folgen von „Dallas“. Ihr Vater liebte den schnoddrigen und kaltschnäuzigen Charakter von J.R. Ewing, gespielt von Larry Hagman. Krissy fand es toll, dass in Texas die Männer tatsächlich immer noch mit einem Stetson auf dem Kopf herumliefen. Die Serie lieferte ein Bild von den USA, das schräg, gefährlich und völlig anders war als das beschauliche Leben, das man in Deutschland führte. Sie fand, dass ihr neues Leben irgendwie mehr Ähnlichkeit mit der Serie hatte – nur dass sie jetzt zum Dienstpersonal gehörte.
Als Alice gegangen war, setzte sich Krissy in die Bibliothek und schaute sich „Flaming Star“ an. Lyndsay hatte sich zu einem Mittagsschlaf zurückgezogen, und Joshua schlief ebenfalls. Krissy sah den Film zum ersten Mal in englischer Sprache und war überrascht, wie Elvis‘ Stimme im Original klang. Einmal schaute Mr. Goodman ins Zimmer und runzelte die Stirn, als er die Nanny beim Nichtstun erwischte. Hätte sie sich vielleicht besser gleich die Bügelwäsche holen sollen? Sie erhob sich höflich und fragte, ob er etwas von ihr bräuchte. Mr. Goodman schüttelte den Kopf und fragte, wo seine Frau wäre. „Sie hat sich hingelegt!“, antwortete Krissy mit heiserer Stimme. Warum flößte ihr dieser Mensch eigentlich so viel Respekt ein? „Später soll ich noch babysitten, weil Ihre Frau ausgehen möchte.“
Ah! Die Stimmung von Mr. Goodman besserte sich deutlich. „Was schaust du dir denn an?“, fragte er verwundert, als im Film ein paar Schüsse zu hören waren.
„‚Flaming Star‘ mit Elvis Presley.“
„Eigentlich wollen wir nicht, dass du am Nachmittag fernsiehst.“ Uh! Krissy runzelte verwirrt die Stirn und hatte das Gefühl, dass sie sich verteidigen musste. „Mrs. Goodman hat mir erlaubt, dass ich fernsehe, wenn ich bügle. Sie will es mir später zeigen. Ich hatte gerade nichts zu tun … und Joshua schläft auch …“
„Das letzte Mädchen, das wir hatten, hat sich immer irgendwie Arbeit gesucht!“, wurde sie getadelt.
Krissy schaltete den Fernseher aus und drückte sich an dem Hausherrn vorbei. „Ich kann ja schon mal die Wäsche holen!“, versicherte sie.
Am späten Nachmittag durfte sie endlich den ersehnten Anruf nach Hause tätigen. Lyndsay bläute ihr ein, dass es immens teuer wäre, „a long distance call“ über den Atlantik zu tätigen, und riet ihr, sich besser kurz zu fassen. Auf der Telefonrechnung würde der Betrag genau vermerkt sein, und man würde ihn ihr vom Lohn abziehen. Krissy schluckte schwer, denn besonders großzügig klang das nicht.
Krissy wählte die Nummer und rechnete schnell nach, wie spät es in Deutschland wohl wäre. Es war Samstag, und da würde er sich die Sportschau ansehen. Kurz vor Mitternacht! Ob ihr Vater wohl noch auf wäre? Sie wählte die Nummer und wartete ab, bis sich die Verbindung aufbaute. Dann hörte sie es endlich klingeln. „Hallo!“, erklang die fröhliche und leicht lallende Stimme ihres Vaters. Er hatte also bestimmt schon wieder seine obligatorischen zwei Bier getrunken.
„Hallo, Papi!“ Es rauschte und knarzte in der Leitung.
„Was! Bist du das? Du klingst so weit weg.“
Krissy kicherte. „Ich bin ja auch weit weg!“
„Und – ist alles gut gelaufen?“
„Ja, ich bin sicher angekommen … allerdings mit zwei Stunden Verspätung. Wir mussten in Montreal zwischenlanden.“
„Ach je … und wurdest du abgeholt?“
„Ja, die Familie hatte einen Chauffeur geschickt.“
„Und, wie ist es so?“
„Toll!“, log Krissy. Ganz bestimmt wollte sie ihrem Vater nicht beichten, dass sie sich gerade sehr verloren vorkam. Gut, dass die Verbindung so schlecht war; da merkte er hoffentlich nicht, wie ihre Stimme verräterisch schwankte. Sie riss sich zusammen und erzählte ihm ein paar Belanglosigkeiten. Dann erklärte sie ihm, dass sie wohl nicht oft anrufen würde, weil es zu teuer wäre. „Schreibst du mir mal?“, hoffte sie.
„Was soll ich denn schreiben?“, fragte er leicht verblüfft.
„Na, wie es meinem Hund geht – oder so was.“ Jetzt zitterte ihre Stimme doch.
„Na schön!“, erklang es wenig begeistert. „Der Köter war heute wieder unterwegs!“, erzählte der Vater mit einem Lachen. „Aber wir haben ihn erwischt. Jetzt liegt er hier neben mir und träumt von seinen Schandtaten.“
Krissy zuckte zusammen. „Oje!“, meinte sie zerknirscht. Wie kann man einem Hund bloß das Streunen abgewöhnen? Der Vater gab den Hörer an die Schwester weiter. „Wir haben gerade Dallas angesehen!“, rief die Schwester aufgeregt. „Toll!“
„Hier läuft es auch … aber die sind viel weiter“, meinte Krissy.
„Cool, erzählst du mir, was passiert?“, hoffte Nicole.
„Klar, ich schreibe es dir“, versprach Krissy. „Telefonieren ist zu teuer – das ziehen die mir vom Lohn ab.“
„Und wie ist es so?“, wollte die Schwester wissen.
„Schön … die Goodmans sind total reich. Am Wochenende fahren sie immer in ein Cottage aufs Land – da soll ich mit und mich um das Baby kümmern. Eventuell fliegen sie auch mal nach Florida. Das wäre natürlich super!“, schwärmte Krissy.
Sie erzählte nicht, dass sie sich eigentlich gerade nur wie eine billige Putzfrau fühlte. Aber das wurde hoffentlich besser, wenn Mrs. Goodman wieder mehr arbeitete. Sie hatte ja das Fotostudio im Keller.
Krissy blickte auf die Uhr und runzelte die Stirn. Was würden wohl zehn Minuten kosten? „Ich muss Schluss machen. Mrs. Goodman braucht das Büro. Tschüss!“ Sie wollte erst einmal testen, wie viel so ein Gespräch kostete.
Am nächsten Tag war Lyndsay wieder richtig nett. Sie ließ das Baby bei Alice und kutschierte Krissy einmal durch Toronto. Staunend schaute Krissy auf die Wolkenkratzer in der Bloor Street, sah das riesige Einkaufszentrum in der Yonge Street und ließ sich das öffentliche Transportwesen erklären. Die U-Bahn kostete nur einen „Token“ von 70 Cent – egal, wohin mal fuhr. Von der Station Eglinton gab es den „Spadina Bus“, der tatsächlich die Spadina Road hinunterfuhr … und fast vor ihrem Haus hielt. Die U-Bahn namens „Yonge Line“ war übrigens die gleiche, die auch zum Eaton Centre führte. Es hatte gleich zwei Haltestellen: Dundas und Queen. „You have to go shopping there!“, sagte Lyndsay enthusiastisch. „Und dort gibt es auch viele Kinos!“
Ansonsten war die Stadt wie auf einem Reißbrett angelegt: breite Straßen, wie mit dem Lineal gezogen und parallel verlaufend mit ebenso parallel laufenden Querstraßen. Nur manchmal folgte die Straßenführung den natürlichen Landschaftserhebungen. Lyndsay fuhr weiter zur „Harbourfront“, dem Yachthafen von Toronto, wo es auch ein großes Veranstaltungsgelände gab, in dem Konzerte stattfanden. Der Stadt vorgelagert gab es einige Inseln, die den Stadtmenschen als Ausflugsziele dienten. Eine kurze Überfahrt mit der Fähre – und schon war man im Grünen. Krissy dachte ohnehin, dass Toronto sehr grün war: Überall gab es Alleen mit riesigen Bäumen und großzügige Parks. Die meisten Bäume hatten inzwischen ihr Herbstkleid angelegt: Alles leuchtete in Gold-Gelb und flammendem Rot. Krissy hatte noch nie so leuchtend rote Blätter gesehen. Es wirkte farbenfroh und richtig einladend. Als wollte die Natur den Menschen vor dem langen Winter noch einmal versöhnen. In der Nähe der Harbourfront stand auch der höchste Turm der Welt: der CN Tower. Lyndsay war sichtlich stolz darauf; er stand erst seit acht Jahren. „Oben ist ein Restaurant – da hat man eine umwerfende Aussicht.“
Krissy notierte sich das in Gedanken – da wollte sie auf jeden Fall mal hinauf!
Am Montag fuhr Lyndsay sie zum Forest Hill College, wo Krissy sich zu einem Englischkurs für Ausländer anmelden konnte. Da Kanada ein Einwanderungsland war, kostete er nichts. Sie musste einen Einstufungstest ablegen, den sie mit Bravour löste, und wurde in eine Gruppe mit zwölf anderen Studierenden eingeteilt. Die Kurse fanden jeweils montags und mittwochs um 19:00 Uhr statt. Lyndsay erklärte ihr, mit welchem Bus sie fahren musste, um wieder heimzukommen, und ließ Krissy dann allein. Die Lehrerin stellte Krissy der Gruppe vor und forderte die anderen Teilnehmer auf, sich ebenfalls kurz vorzustellen. Krissy freute sich, denn allein fünf der Teilnehmer waren ebenso Au-Pair-Mädchen wie sie! Nach dem Unterricht wurde sie von ihnen eingeladen, noch zum Essen mitzukommen. „Wir gehen anschließend immer noch ins Toby’s Good Eats – so eine Studentenkneipe. Komm doch mit!“
Krissy war begeistert und schloss sich den Mädchen an. Die Wortführerin war Anette, ein Mädchen aus Deutschland, das schon seit ein paar Monaten in Kanada war und sich richtig gut auskannte. Gudrun kam aus der Schweiz und Didi ebenfalls aus Deutschland. Dann gab es noch Ramona – und Brigitte, die einen farbigen Freund hatte, der in einem Vorort von Toronto wohnte, der als „Slums“ verschrien war – obwohl es dort zwar schäbige Häuser gab, aber trotzdem alles sauber und ordentlich war. Krissys Familie wohnte in Forest Hill, einem sehr noblen Stadtteil mitten in Downtown Toronto.
Das Toby’s war eine stylisch eingerichtete Kneipe mit viel Holz und alten Bildern an den Wänden. Auf der Karte standen Burger, Sandwiches, Salate und die „Bennys“ – raffinierte Eiergerichte. Die Mädchen fanden einen Tisch und rückten zusammen, als noch Oreste und sein Sohn Marco aus dem Kurs auftauchten. Sie kamen aus Griechenland, und Anette flüsterte Krissy zu, dass die beiden die schlimmsten Schürzenjäger von ganz Toronto wären. „Die kommen nur in den Kurs, um Frauen aufzureißen – aber ansonsten sind sie ganz nett!“
Aha! Krissy grinste frech und futterte weiter ihren Salat mit Caesar’s Dressing. Sie lauschte den Erzählungen der anderen, die freimütig über ihre Arbeit und die nervigen Angewohnheiten ihrer Arbeitgeber herzogen. Gut gelaunt und geradezu aufgekratzt verabredeten sie sich für das kommende Wochenende, um gemeinsam zum Pier 4, einem Fischlokal am Hafen von Toronto, zu gehen. Alle Mädchen waren im Abenteuermodus und wollten nach dem eher langweiligen Job noch etwas Spannendes erleben. „Dort gibt es Fisch satt!“, schwärmte Anette. Selbstredend, dass auch Oreste und Marco sich selbst dazu einluden.
Krissy freute sich schon auf Mittwochabend, an dem sie die Mädchen wieder treffen würde. Sie erhielt einen ziemlichen Dämpfer, weil sie an diesem Abend babysitten musste. Auch ihr Ausflug am Wochenende würde nicht klappen, denn die Goodmans hatten vor, ins Cottage zu fahren. Ihr wurde eröffnet, dass ihr freier Tag der Montag wäre, was Krissy nicht gut fand, weil dann keiner ihrer Freunde Zeit haben würde. Irgendwie hatte die Stellung bei den Goodmans nur Haken.
Anette und die anderen meinten, dass sie die Familie wechseln sollte, wenn es so weiterging. Krissy hatte dazu noch nicht den Mut und wollte erst einmal abwarten, ob sich das Leben nicht einpendeln würde. „Vielleicht ist es im Cottage ja ganz schön“, hoffte sie. „Am Wochenende kommt auch der ältere Sohn von Herrn Goodman aus Paris angeflogen. Vielleicht ist der ja nett.“
Niemand sagte etwas, weil es ja wirklich noch zu früh war, eine endgültige Entscheidung zu fällen.
Das Wochenende rückte näher, und Krissy freute sich auf den Ausflug. Lyndsay schien den ganzen Hausstand mitnehmen zu wollen, denn sie packte das Auto so voll, dass kaum noch Platz für Krissys Sachen blieb. Sie quetschte sich neben die Babyschale von Joshua und nahm ihre Tasche auf den Schoß. Unterwegs hielten sie noch bei einem Supermarkt und kauften für das Wochenende ein. Krissy hatte keine Ahnung, wo Lyndsay die Lebensmittel verstauen wollte, aber sie sagte nichts. Irgendwie stopfte Lyndsay die Tragetaschen noch zwischen ihre Beine und gab Krissy eine kleinere Tüte, die sie neben ihrem Köfferchen auf den Knien balancierte. Nach zwei Stunden Fahrt erreichten sie schließlich das Landhaus der Familie. Es lag direkt an einem See, inmitten eines riesigen Parks mit Bach und kleinem Wasserfall. Etwas entfernt von dem großzügigen Anwesen stand eine alte Blockhütte, die komplett renoviert worden war. In ihr lebte die Hausmeisterin, die sich um das Anwesen kümmerte, wenn die Goodmans nicht da waren. Ihr Ehemann hatte erst vor kurzem einen tödlichen Unfall gehabt, und nun hoffte sie, dass sie das Blockhaus nicht verlassen musste. Sie hatte zwei kleine Kinder, um die sie sich kümmern musste. Krissy verfolgte das Gespräch zwischen Lyndsay und ihrem Mann, die ganz offen darüber redeten, dass sie die Frau versuchsweise behalten würden. „Wenn sie mit der Technik nicht klarkommt, müssen wir uns allerdings jemand anderen suchen.“
Krissy hatte Mitleid, als sie die junge Frau sah, die ihnen bei der Ankunft die Haustür öffnete. Sie hatte das jüngere Kind auf dem Arm und hielt den anderen an der Hand. Sie grüßte höflich, stellte die Kinder ab und half der Familie beim Ausladen. Mit gurrender Stimme lobte sie den kleinen Joshua und gratulierte Lyndsay zu ihrem Sohn. Es war das erste Mal nach der Geburt, dass die Goodmans wieder zu ihrem Landhaus fuhren. Krissy merkte, dass die junge Frau keine Ahnung hatte, dass man bereits über ihre Zukunft nachdachte. Zumindest schien alles zur Zufriedenheit von Mr. Goodman vorbereitet worden sein. Der Rasen war ein letztes Mal in diesem Jahr gemäht und der Außenpool bereits abgedeckt worden. „Arbeitet die Pumpe richtig?“, fragte er nach dem Pool im Untergeschoss des Hauses.
„Ja, sie wurde repariert“, antwortete die Frau geflissentlich. „Getränke sind auch geliefert worden.“
„Fein!“ Mr. Goodman nickte beeindruckt. Mit einem flüchtigen Nicken deutete er auf Krissy. „Das ist unsere Nanny aus Deutschland. Zeigst du ihr bitte das Zimmer über der Garage?“
Die Frau nickte und nahm wieder die Kinder an der Hand. Freundlich blickte sie auf Krissy. „Na, kommst du mit?“
Krissy schluckte schwer. Sie sollte ganz alleine über der Garage wohnen? Hier – im Nirgendwo? Wieder fühlte sie sich nicht als Haustochter, sondern wie eine Sklavin. Ihr wurde sofort klar, dass der Pool im Haus ganz sicher nicht für sie wäre. Den durfte sie höchstens putzen!
„Und zeig ihr gleich noch, wo die Waschmaschine steht!“, rief Mr. Goodman hinterher.
Alles klar! Krissy dachte an Anette, die ihr geraten hatte, die Familie zu wechseln. Das sei ganz leicht, hatte sie gesagt. Einfach bei der Agentur melden, und sie stellen dich anderen Familien vor. Soeben kam sie genau an diesen Punkt. Weglaufen – ganz weit weglaufen. Kurz blitzte der Gedanke in ihrem Kopf auf, ob sie nicht einfach wieder nach Hause fliegen sollte. Aber was sollte sie dort tun? Das Wintersemester hatte bereits begonnen. Sie hatte keine Lust, vielleicht ein ganzes Jahr lang Putenfleisch zu verpacken, bis sie mit dem Studium anfangen konnte. Seufzend folgte sie der Frau, die sich als Kelly vorstellte, in die Garage und das darüber liegende Gästezimmer. Es war ganz schön, wenn man davon absah, dass sie hier nachts allein wäre. Kelly drehte die Heizung an und wandte sich entschuldigend an Krissy. „Sorry, ich wusste nicht, dass das Zimmer gebraucht wird, sonst hätte ich vorher schon eingeheizt. Aber es wird ja schnell warm.“
„Ist schon okay“, meinte Krissy mit einem Seufzer. „Ich werde ja erst noch drüben gebraucht.“
Sie verließ die Garage und kehrte zum Haus zurück, um Lyndsay beim Auspacken zu helfen. Schnell fand sie sich in der Küche zurecht und stellte die Lebensmittel in die Regale oder den Kühlschrank. Lyndsay war mit Joshua verschwunden, um ihn zu stillen und zu wickeln. Nach einer Weile kam sie in die Küche, um das Abendessen vorzubereiten. Sie kochte ein leckeres Essen, zu dem auch der ältere Sohn stieß. Er war jung und sah gut aus, aber er ignorierte Krissy vollständig, die sich nicht an den Tisch setzen durfte, sondern die Familie bedienen sollte.
Als Krissy abends im Bett lag, konnte sie die Tränen nicht mehr halten. Sie war so enttäuscht, dass sie am liebsten sofort wieder heimgeflogen wäre – selbst wenn sie sich da irgendeinen Job suchen müsste. Hinzu kamen Heimweh und Einsamkeit. Wenn sie aus dem Fenster schaute, war dort tiefschwarze Nacht – ohne Lichter oder andere Hinweise auf Zivilisation. Es war nicht romantisch, sondern beängstigend. Wenn ihr Fenster wenigstens zur Seite hinausgehen würde, wo das Haus stand, käme sie sich nicht ganz so verloren vor.
Das Wochenende verging mit Küchenarbeit, Wäschewaschen, Servieren und einsamen Spaziergängen. Kein einziges Mal durfte sie sich um Joshua kümmern. So hatte sie sich das nicht vorgestellt!
Einmal wanderte sie aus reiner Verzweiflung bis zu dem kleinen Blockhaus. Kelly war zwar überrascht, ließ sie aber eintreten. Die Hütte stammte aus dem Jahr 1853 und war aufwendig restauriert worden. Krissy bestaunte die roh gezimmerten Bohlen und die Schlaf-Empore, zu der eine Leiter mit Handlauf führte. Unten bestand die Hütte nur aus einem Wohn-Essbereich und einem weiteren kleinen Zimmer, das als Kinderzimmer fungierte. Die Küche war modern ausgestattet und hatte auch einen Anschluss für die Waschmaschine.
Kelly erzählte, dass die Hütte ursprünglich von einem Pelzjäger gebaut worden war, der hier mit seiner Familie gelebt hatte. Die Wälder seien auch jetzt noch voller Wild – auch Bären. Krissy wunderte sich ein wenig, denn bis auf Vögel und Eichhörnchen war ihr bisher noch kein Wild aufgefallen. „Doch!“, versicherte Kelly. „Hier gibt es viele Waschbären, inzwischen auch wieder Biber, Luchse, Schwarzbären, Elche, Hirsche und Füchse.“
Aha. Da musste Krissy beim nächsten Spaziergang mal ein wenig Ausschau halten.
„Und – gefällt es dir bei den Goodmans?“, wollte Kelly wissen.
„Na ja, es geht so – ich putze eigentlich nur, dabei sollte ich mich eigentlich um Joshua kümmern. Aber Mrs. Goodman ist ja immer zu Hause.“
Kelly kicherte. „Such dir das nächste Mal lieber eine Familie, wo die Mutter arbeitet!“
Ein guter Rat, dachte Krissy.
„Und was wirst du machen?“, fragte Krissy neugierig.
„Du weißt, dass mein Mann einen Unfall hatte?“, wollte Kelly wissen.
Krissy nickte. „Ja, Mr. Goodman hat es kurz erwähnt.“
Kelly schluckte schwer und hatte sich schnell wieder im Griff. „Es ist nett, dass er mich noch hier sein lässt, aber ich bin schon auf der Suche nach etwas anderem. Längerfristig bin ich den Aufgaben hier nicht gewachsen. Da muss ein Mann her …“ Sie schätzte ihre Situation ganz realistisch ein. „Ich kann den Winter hier noch verbringen, aber im Frühjahr wird Mr. Goodman sich ganz sicher jemand anderen suchen.“
Puh! „Und was machst du dann?“
„Ich geh zurück nach Hamilton. Da ist es billiger, und ich könnte als Kellnerin jobben. Außerdem habe ich dort Familie, die mich unterstützen kann.“