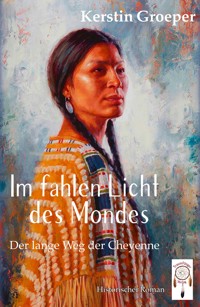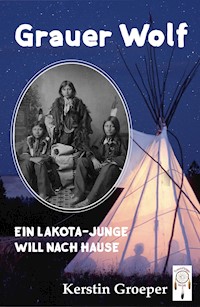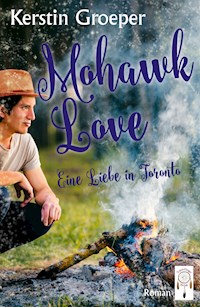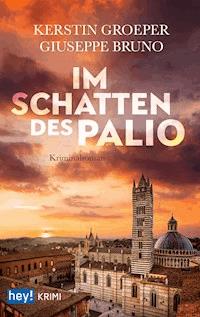Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das harte Leben zweier Menschen, die sich unter normalen Umständen gar nicht hätten kennenlernen dürfen: Gredel ist glücklich, als sie in den 20er Jahren eine Ausbildung als Röntgenassistentin beginnen darf und damit ihrem strengen Elternhaus in Ostfriesland entfliehen kann. Nach ihrer Ausbildung arbeitet sie in einem Krankenhaus in Lübeck. Dort verliebt sie sich in Walther, einen gutaussehenden Arzt, der seine Karrierechance bei der SS sieht. Als dieser nach Jüterbog versetzt wird, folgt sie ihm dorthin. Längst sind Verlobung und Hochzeit geplant, doch Walther bittet um einen Aufschub von drei Monaten, weil er noch zu einem Einsatz in Afrika abkommandiert wird. Als Gredel merkt, dass sie ein Kind von ihm erwartet, ist sie überglücklich … doch Walther löst die Verlobung und stürzt Gredel damit in tiefe Verzweiflung. Zur gleichen Zeit schlägt sich Hellmuth, der ursprünglich aus Ostpreußen stammt, mehr schlecht als recht in Berlin durch. Er kümmert sich aufopferungsvoll um seine verwitwete Mutter sowie um seine Schwester und deren uneheliche Tochter. Um dem Kind die Schande zu ersparen, geben sie es als Tochter der Großeltern aus – auch, um ihre jüdische Herkunft zu verschleiern, was in der Folge zunehmend zu einem Problem wird. Hellmuth wünscht sich endlich eine eigene Familie, doch die desolate finanzielle Situation kommt seinen Plänen immer wieder in die Quere. Als die Schulden überhandnehmen, drängt ihn seine Mutter, auf eine Heiratsanzeige zu antworten, in der eine hohe "Mitgift" versprochen wird. So lernt er Gredel kennen, die verzweifelt versucht, ihre uneheliche Tochter Rosemarie durch eine Heirat behalten zu können. Die Leben der zwei Familien geraten aus den Fugen, als der Zweite Weltkrieg ausbricht …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 846
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kerstin Groeper
Brennnesseln schmecken nur im Frühling
Brennnesseln schmecken nur im Frühling
Biografischer Roman
vonKerstin Groeper
Impressum
Brennnesseln schmecken nur im Frühling, Kerstin Groeper
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2022
1. Auflage eBook Dezember 2022
eBook ISBN 978-3-948878-35-1
Lektorat: Michael Krämer
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: Bookwire
Titelbild: Gredel und Hellmuth Müller, Adobe Stock
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG, Hohenthann
Inhalt
Prolog
Ostfriesisches Wetter
Pferdemarkt
Die große weite Welt
Das Ende einer Ära
Lübeck, die Schicksalsstadt
Karriereknick
Verliebt, verlobt – und weiter?
Olympia
Rosemarie
Musterung
Amalies Hochzeit
Heiratsannonce
Verträge
Der „Polenfeldzug“
Hochzeit für Arme
Von Deblin nach Berlin
Hildegard
Ein bisschen Glück
Fliegerangriffe
Das widerstandsfähige Kinderbett
Abschied von Neukirchen
Volkssturm
„Knadier“
Berlin in Trümmern
In russischer Gefangenschaft
Aufräumarbeiten im Olympiastadion
Die grüne Grenze
„Früchteverwertung“
Luftbrücke
Arbeitslos
Wirtschaftswunder
Epilog
Nachwort
Prolog
Tiktok, tiktok, tiktok – neben mir erklingt im gleichmäßigen Rhythmus das Ticken der Kaminsims-Uhr aus dunklem Holz mit dem großen Zifferblatt hinter Glas. Sie stammt von meinem Urgroßvater mütterlicherseits. Ich erinnere mich daran, wie sie jahrzehntelang bei meinem Großeltern im Flur stand – schweigend – mit dem zersprungenen Uhrglas. Dann stand sie eine Weile bei meiner Mutter im Wohnzimmer, aber immer noch schweigend. Nach dem Tod meiner Mutter landeten nun einige Erbstücke – Erinnerungen an eine glückliche Kindheit – in meinem Wohnzimmer: Die alte Vase aus Meißner Porzellan, auf der der Flötenkönig abgebildet ist, ein besticktes Kissen meiner Urgroßmutter, genannt Fuschka, und diese alte Uhr mit einem Glockenschlag wie Big Ben. Seit ich mich erinnern kann, war sie defekt – ein geheimnisvolles Überbleibsel aus einer Zeit, die längst vergangen ist. Unten prangt ein schmales Messingschild mit der Aufschrift:
Ihrem Hochverehrten Herrn Bürgermeister zur Silberhochzeit vom 6. Februar 1925, gewidmet von den Beamten und Angestellten der Stadtverwaltung Wehlau.
Dong, dong, dong, dong. Die Uhr schlägt vier, präzise wie einst, denn ich habe sie beim Uhrmacher richten lassen. Nun ziehe ich sie alle zehn Tage mit einem Schlüssel auf. Mein Mann lacht im Hintergrund. „Ah, Big Ben!“ Ich weiß nicht, ob die Uhr ihn stört oder nervt – oder ob er sie lustig findet. Mich hat sie schon immer fasziniert – und auch die Geschichten, die damit verbunden waren. „Mein Vater hieß Otto, und er war der Bürgermeister von Wehlau bei Königsberg“, hat mein Großvater immer erzählt. Dann wurde seine Stimme immer leise. „Das ist ja jetzt alles Russland – aber damals hieß es noch Ostpreußen.“
Als Kind hat mich das nicht sonderlich interessiert, aber inzwischen habe ich mit der Ahnenforschung begonnen und bin dabei auf lang gehütete Geheimnisse in unserer Familie gestoßen. Inzwischen habe ich selbst eine Familie, habe drei Kinder und drei Enkelkinder und kann viel besser abschätzen, welche Widrigkeiten meine Großeltern und Eltern bewältigen mussten.
Meine Großeltern kenne ich nur als „alte“ Menschen. Aus alten Fotoalben aber blicken mir junge, forsche, vergnügte Personen in die Augen. Doch die Zeiten änderten sich und so mancher Traum musste aufgegeben werden. Mehrfach schlug das Schicksal zu – mit dramatischen Wendungen.
Ich habe meine Großeltern oft in ihrer Wohnung in Berlin besucht. Sie waren die liebsten Menschen, die ich mir nur vorstellen konnte. Mein Opa brachte mir viele Kartenspiele bei, und Oma kaufte mir freitags immer die neuesten „Silberpfeil“-Hefte. Denkwürdig sind natürlich auch die Sissi-Filme, die ich mir mit meiner Oma immer anschauen durfte. Danach stibitzte ich all ihre Plastiktischdecken und verkleidete mich als Prinzessin. Nie wurde ich deswegen geschimpft. Ich erlebte nur, wie sehr meine Oma und Opa sich liebten und im Alter sich gegenseitig schätzten und unterstützten. Als Kind habe ich immer gekichert, wenn meine Oma meinem Opa die Schnürsenkel band – das konnte doch jedes Kind. Aber mein Opa konnte sich nicht so tief hinunterbücken – Übergewicht und eine alte Kriegsverletzung. Noch so eine Wahrheit, die ich als Kind gern verdrängte: Wie konnte es sein, dass mein lieber Opa je im Krieg gekämpft hatte? Eine Vorstellung, die nicht in diese heile Kinderwelt passte. Heute liegt sein „Wehrpaß“ vor mir, der klar aufzeigt, dass mein Opa am Polenfeldzug teilgenommen hatte.
Bei meinen Forschungen bin ich auf viele interessante Unterlagen gestoßen, und ich dachte mir: Das ist genug Stoff, um eine richtige Familiensaga zu schreiben. Warum immer Königshäuser und Grafen? Die Geschichte meiner Familie ist mindestens genauso spannend. Allein, wie meine Großmutter Gredel und mein Großvater Hellmuth zusammengekommen sind, ist ein ganzes Buch wert, denn eigentlich begann alles mit zwei Katastrophen:
Meine Oma stammt ursprünglich aus Leer in Ostfriesland – und mein Großvater wurde in Sensburg, Ostpreußen, geboren. Normalerweise hätten beide nie aufeinandertreffen dürfen, doch die Zeiten haben nicht nur diese beiden Familien durcheinandergewirbelt. Das ist so spannend, dass ich erzählen möchte, wie durch viele Umwege die Pfade beider Familien sich schließlich in Berlin kreuzten. Aber zuerst fing alles ganz anders an: In Ostfriesland und Ostpreußen. Hier ist die Geschichte von beiden.
Für Oma und Opa – damit ihre Geschichte nie vergessen wird.
Ostfriesisches Wetter
Nermoor 1924
Gredel saß bei Familie Houtrouws am Tisch und ließ ihren Blick über die Kinder schweifen. Sie saßen da wie die Orgelpfeifen: die Jungen angezogen mit ihren Matrosenanzügen und die beiden Mädchen Elisabeth und Foelke in ihren weißen Kleidchen. Gredel verkniff sich ein Kichern, als Otto unter dem Tisch nach seinem jüngeren Bruder trat, um die nächste Katastrophe zu verhindern. Gleich würde der jüngere den älteren Bruder verpetzen, und dann war Schietwetter angesagt. Schietwetter bedeutete strömender Regen, aber auch eine lange Standpauke des gestrengen Vaters, dessen schlechte Laune meist ziemlich lange andauerte, wenn einer seiner Sprösslinge über die Stränge schlug. Bei sechs Kindern im Alter von vier bis siebzehn Jahren, davon fünf Jungen, war es auch nötig, auf Disziplin zu achten. Otto hatte wieder mit dem Nachbarmädchen geflirtet und war dabei von dem kleinen Hermann beobachtet worden. „Otto hat es heute wieder getan!“, petzte der Junge unbeeindruckt.
„Sei still!“, zischte Otto böse. „Sonst fängst du eine!“ Seine Stimme war leise, aber drohend. Auch der etwas jüngere Rudolf schaute den kleinen Bruder durchdringend an.
Der Vater horchte auf. „Was hat er wieder getan?“
Hermann zappelte auf seinem Stuhl hin und her. „Äh, er hat …“
Ehe er den Satz beenden konnte, kam Gredel ihrem Cousin zu Hilfe. „Nichts, er hat mir beim Holzhereintragen geholfen.“
Sofort wandte sich das Interesse des Vaters wieder der Zeitung zu, die er jeden Tag las. Hausarbeiten gehörten in das Metier seiner Frau, um das er sich nicht zu kümmern pflegte. „Macht so etwas nicht Gusti?“, brummte er ungeduldig. Gusti war das Hausmädchen der Familie. Hermann wollte noch etwas sagen, bekam aber dieses Mal einen Tritt von Gredel. „Untersteh dich!“, warnte sie böse. „Sonst spiele ich nie wieder mit dir!“ Gredel legte ihre ganze Autorität in die Stimme, um ihren Cousin zur Einsicht zu bringen.
Hermann zog den Kopf ein und blickte sie ganz erschrocken an. „Ich wollte doch gar nichts sagen!“, versicherte er hastig.
Gredel tauschte einen belustigten Blick mit Otto und Rudolf und rollte mit den Augen. Geschwister – auch wenn es nicht die eigenen waren – konnten manchmal eine Plage sein. Dabei fühlte sie sich in dieser Familie so wohl. Viel besser als in dem strengen Lehrerhaushalt ihres Vaters in Leer, der dort mit seiner zweiten Frau und der kleinen Tochter Amalie wohnte. Gredel hatte noch während sie die Handelsschule besuchte die Flucht ergriffen und war wieder zu der Familie Houtrouw gezogen, um von dort aus in die Schule zu gehen und ansonsten als Hausmädchen mitzuhelfen.
Für Gredel waren die Houtrouws wie eine richtige Familie: Eigentlich waren sie Tante und Onkel, doch nach dem Tod von Gredels Mutter – kurz nach Gredels Geburt – hatte der Vater die kleine Gredel zu der Tante gegeben, wo sie zusammen mit dem kaum einen Monat älteren Otto von ihrer Pflegemutter gestillt worden war. Als der Vater wieder geheiratet hatte, war Gredel zu ihrem Vater zurückgekehrt, hatte aber immer eine enge Beziehung zu ihrer Tante beibehalten. Für sie waren all diese Kinder hier wie ihre leiblichen Geschwister, die sie abgöttisch liebte – mehr als ihre Halbschwester Amalie, die zudem noch von dem Vater und der Stiefmutter bevorzugt wurde. Gredel hatte die Schikanen einfach satt gehabt. Während die kleine Amalie stets im Mittelpunkt stand, erfuhr Gredel oft nichts als Tadel und scharfe Worte. Nie schienen ihre Leistungen gut genug zu sein – und der Vater hielt sie für faul. Bei den Houtrouws dagegen waren ihre Mitarbeit und Hilfe willkommen. Mutter Rudolfa genoss es, wenn Gredel den kleineren Kindern bei den Hausaufgaben half, sich um die Wäsche und das Kochen kümmerte oder ihr beim Sticken Gesellschaft leistete. Gredel stickte natürlich nicht, sondern lernte, wie man Socken stopfte oder den Saum von Kleidern ausließ. Allein das Bügeln der Wäsche, die bei so vielen Personen anfiel, dauerte Stunden. Gredel machte es gerne, denn das Lob von Mutter Rudolfa tat ihr gut. Ihr Vater schien dagegen nie zufrieden zu sein. Dabei waren ihre Leistungen in der Schule gar nicht schlecht gewesen, aber von der Tochter eines Lehrers hatte der Vater sich mehr erhofft. „Gutes Betragen allein reicht nicht“, hatte er stets geschimpft, wenn sie wieder mal ein „Befriedigend“ im Zeugnis stehen hatte. Überhaupt schien er nur die schlechteren Noten zu sehen – und nicht die guten Leistungen. „Wie soll ich dich nur unter die Haube bringen?“, hatte er gemurmelt, und die Enttäuschung war ihm jedes Mal anzusehen.
Gemeint war damit auch, dass er Gredel nicht für besonders hübsch hielt: Sie hatte einen Wuschelkopf aus dunklen Locken, eine römische Nase und ein leicht strenges Gesicht mit hohen Wangenknochen. Dass er es überhaupt erlaubt hatte, dass sie die höhere Wirtschaftsschule besuchen durfte, war für ihn schon ein außergewöhnliches Zugeständnis gewesen. Doch nach dem Weltkrieg hatte sich viel verändert, und es war inzwischen nicht mehr so ungewöhnlich, dass auch Mädchen aus gutem Hause einen Beruf ergriffen. Selbstverständlich kam ein Studium nicht in Frage, aber warum nicht Gouvernante oder Krankenschwester?
Gredel dagegen hatte andere Pläne. Ihr Lieblingsonkel Enno lebte in Berlin und hatte ihr ganz andere Gedanken in den Kopf gesetzt. Er war wesentlich weltoffener, denn er ermutigte Gredel, zu ihm nach Berlin zu kommen und dort eine Ausbildung anzufangen. „Mädel, du musst mal diesen Mief hinter dir lassen! Hier in Leer versauerst du nur. Komm doch zu mir nach Berlin und lerne etwas!“
Gredel hatte immer noch die Stimme ihres Onkels im Ohr, als sie nach dem Abendessen bei ihrer Ziehmutter im „Salon“ saß. „Wissen Sie, Frau Houtrouw …“, begann sie höflich.
„Ja, mein Kind?“ Rudolfa schaute interessiert auf. Es störte sie nicht, dass Gredel sie siezte, denn das erwartete sie von ihren älteren Kindern auch. Nur die beiden kleinsten durften noch „Mama“ zu ihr sagen. Sie sah sehr gepflegt aus in ihrem steifen weißen Kleid, das bis zum Boden reichte, den weißen Schuhen und der aufwendigen Flechtfrisur. Sie saß in einem schweren Ohrenbackensessel und hatte die Füße auf einem Hocker abgelegt. Dahinter stand eine Anrichte aus dunklem Mahagoniholz, in der das „gute“ Geschirr und die Kristallgläser aufbewahrt wurden. Neben Rudolfa flackerte der warme Schein des Feuers im Kamin. Sie trug eine Nickelbrille, um die Stickarbeit besser sehen zu können. Es war früh dunkel geworden, und das Hausmädchen hatte die schweren Vorhänge aus Gobelin bereits zugezogen. Der Raum lag im Dunkeln, mit Möbeln aus Holz und dicken Stoffen mit Blütenmustern oder bestickten Tischdecken. Nur in der Nähe des Feuers und der einzigen Lampe, die auf dem Tisch stand, wurde das Zimmer beleuchtet.
Gredel lächelte geschmeichelt. Es war schön, wenn Rudolfa „Kind“ zu ihr sagte. Ganz, als wäre sie ebenfalls eine Tochter des Hauses. „Mein Onkel Enno“, fuhr sie fort, „ … meinte, dass ich zu ihm nach Berlin kommen sollte, um eine Ausbildung zu beginnen.“
Rudolfa hob etwas erstaunt die Augenbrauen. „Ja, möchtest du dich denn nicht bald verloben? Ich meine … nach diesem Jahr bei uns.“
Gredel senkte den Blick. „Ach, ich habe noch gar keinen Sinn, mich binden zu wollen. Warum sollte ich nicht zuerst eine Ausbildung machen und etwas lernen?“
„Was für ein Unsinn. Du wirst einen guten Mann heiraten, der dann für dich sorgt. Viele Männer sehen es gar nicht gerne, wenn ihre Frau arbeiten möchte. Es ist doch genug, wenn du dich um Haushalt und Kinder kümmerst. Sieh mich an …!“
„Schon!“, stimmte Gredel zu.
Sie konzentrierte sich wieder auf ihre Näharbeit und dachte darüber nach. Wollte sie solch ein Leben? Einen Mann heiraten, Kinder bekommen, den Haushalt führen und vielleicht ein Beet anlegen? Daran lag bestimmt nichts Falsches. Insgeheim beneidete sie Rudolfa sogar für dieses Leben. Rudolfa hatte einen guten Mann, bezaubernde Kinder, Personal und ein gesichertes Einkommen. Wobei Gredel noch nicht ganz verstanden hatte, womit ihr Onkel sein Geld verdiente. Irgendwas mit Handel – außerdem war Land vorhanden, das bewirtschaftet werden musste.
Gredel seufzte tief. „Ach, bisher habe ich noch niemanden kennengelernt.“ In wen sollte sie sich also verlieben?
„Du gehst ja auch nie zum Tanzen aus“, meinte Rudolfa mit einem Kopfschütteln.
„Tanzen?“ Wo hätte sie das lernen sollen? Ihr Vater nannte es einen unnützen Zeitvertreib, der eines jungen, anständigen Mädchens nicht würdig sei. Sie musste kichern, als sie sich das Gesicht ihres Vaters vorstellte, wenn sie ihn fragen würde, ob sie zum Tanzen gehen dürfte. „So ein Unsinn!“, hätte er geschimpft.
Rudolfa räusperte sich. „Na ja … heutzutage werden ja nicht mehr alle Ehen von den Eltern arrangiert. Also könntest du ja mal ausgehen und jemanden kennenlernen. Oder ich veranstalte einen Tee …“
„Danke, lieber nicht!“, wehrte Gredel impulsiv ab. Sie würde wie ein Mauerblümchen in der Ecke sitzen und den ganzen Abend kein Wort herausbringen. So unkompliziert sie sich bei den „Geschwistern“ verhielt, umso schüchterner benahm sie sich gegenüber Fremden. Sie brachte keinen Ton heraus, und sie hasste es, wenn sich ihre Wangen vor Verlegenheit röteten. Sie konnte es geradezu spüren, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. Es war ihr peinlich!
Die Tante lächelte mit einem Kopfschütteln. „Du bist ja ohnehin noch zu jung! Was sollen also diese Gedanken?“
Gredel nickte nur. Sie war achtzehn – und damit noch lange nicht volljährig.
„Was sagt denn dein Vater dazu?“
„Zu was?“
„Nach Berlin zu gehen, um eine Ausbildung zu machen?“
„Ach so!“ Gredel seufzte unglücklich. „Natürlich nichts. Er hält es für ein Hirngespinst. Der Abschluss der Handelsschule reicht völlig, um gut vorbereitet einen Haushalt zu führen. Ich kann lesen, schreiben und rechnen – ein bisschen Buchhaltung. Das sei völlig ausreichend.“
„Und du?“
„Ich fände es schon interessant, nach Berlin zu gehen. Ich kenne ja noch gar nichts von der Welt. Dort soll es Theater, Konzerte und sogar Filmpaläste geben. Ich könnte eine Ausbildung zur Krankenschwester machen und erst einmal ein bisschen Geld verdienen.“ Gredels Blick wurde sehnsüchtig. Alles war besser, als bei diesem strengen Vater und der gehässigen Stiefmutter zu bleiben. Wie oft hatte sie versucht, ihr alles recht zu machen? Sie nannte die Stiefmutter stets „Mutter“, aber so wirklich Liebe wollte von keiner Seite aufkommen. Es war ein Wunschdenken, das Heischen nach Liebe und Anerkennung, das immer wieder enttäuscht wurde.
Rudolfa wurde still und schien über Gredels Wunsch nachzudenken. Dann wurde sie abgelenkt, als ihr jüngster Sohn Gustav schlaftrunken ins Wohnzimmer tapste. Er hieß genauso wie der Vater und wurde als Nachzügler besonders nachsichtig behandelt. „Mama“, quengelte das Kind weinerlich. „Ich kann nicht schlafen.“
„Möchtest du noch ein Glas warme Milch?“
Unaufgefordert stand Gredel auf und nahm das Kind an der Hand. „Komm, Gustav, ich mache dir eine Tasse warm.“ Sie führte den Jungen in die Küche und lächelte, als auch noch die kleine Elisabeth in ihrem Nachthemdchen auftauchte. „Na, hast du auch Durst?“
Das Kind nickte. „Erzählst du uns noch eine Geschichte?“, fragte es bittend.
„Au ja!“, stimmte der Bruder zu. „Die Geschichte von dem Piraten!“
Gredel lachte fröhlich. „Na schön! Aber nun schnell wieder ins Bett, damit ihr keine kalten Füße bekommt.“
Sie brachte die beiden ins Schlafzimmer der Kinder, sah zu, wie sie in die Betten sprangen und sich zudeckten. Das Zimmer war kalt, denn es wurde nicht geheizt. Die Betten standen nebeneinander, und die Wände waren mit einer Tapete verkleidet. Ansonsten deutete nichts darauf hin, dass hier Kinder lebten „Soll ich euch noch einen Bettwärmer bringen?“ Sie fühlte nach der Bettpfanne, in der kochendes Wasser das Bettzeug wärmen sollte. Sie war noch warm.
„Nein, erzähl lieber die Geschichte!“, bat Gustav aufgeregt.
„Na schön!“ Gredel setzte sich in den Schaukelstuhl, der neben den Betten stand, und wickelte eine Decke um sich. Mit geheimnisvoll gesenkter Stimme erzählte sie die Geschichte von Störtebeker, der zur Hinrichtung geführt wurde und nachdem er geköpft worden war, ohne Kopf an seinen Leuten vorbeilief, um sie zu retten.
„Das ist doch bestimmt ein Märchen“, stellte Elisabeth fest. „Niemand kann ohne Kopf laufen.“
Gredel legte spitzbübisch den Kopf schräg. „Aber Hühner können auch noch rennen, wenn sie geköpft wurden. Habt ihr das schon mal gesehen?“
„Stimmt“, gab Gustav ihr recht. „Obwohl das sehr gruselig aussieht. Aber ein Mensch …?“
„Die Legende ist sehr alt! Warum sollte diese Geschichte jahrhundertelang weitererzählt werden, wenn sie gar nicht wahr ist?“
Die Kinder blickten sie mit großen Augen an. „Ganz schön unheimlich!“
„Leider hat es nicht viel geholfen, denn Störtebekers Männer wurden trotzdem alle hingerichtet.“
„Das ist aber gemein“, sagte Gustav empört. „Wenn ich groß bin, werde ich mal Piratenkapitän. Aber mich werden sie nie erwischen, das kannst du mir glauben.“
„So, jetzt ist aber Schluss. Schlaft jetzt! Ich muss noch eure Socken stopfen …“
„Och!“ Beiden war anzusehen, dass sie noch gerne mehr solche Geschichten gehört hätten. „Morgen erzähle ich euch wieder eine Geschichte“, versicherte Gredel.
„Von Störtebeker?“
„Nein, morgen erzähle ich euch etwas über Siegfried.“
„Au fein!“, freute sich Gustav.
„Kommt da auch eine Prinzessin vor?“, wollte Elisabeth wissen.
„Bestimmt! Bei Heldensagen kommt immer eine Prinzessin vor.“ Gredel verließ das Zimmer und zog die Tür hinter sich zu. Dann setzte sie sich wieder zu Rudolfa und nahm den Socken in die Hand. Sie steckte den Socken auf die Holzkugel, umfasste das Loch mit feinen Stichen und wob dann über dem Loch ein Netz aus Garn, bis das Loch gestopft war. „Sehr schön!“, wurde sie gelobt. „Ich mag es nicht, wenn die Löcher einfach zusammengezogen werden, weil sie dann umso schneller wieder kaputtgehen.“
Gredel seufzte innerlich. Bei den Jungs waren andauernd irgendwelche Löcher in den Strümpfen, obwohl sie aus festerer Wolle gestrickt waren als die des Mädchens.
Sie konzentrierte sich auf die Arbeit und schaute nur kurz auf, als Gustav Houtrouw, der Herr des Hauses, ins Zimmer trat und sich in den anderen Ohrenbackensessel setzte. Er war nicht besonders groß und hatte bereits einen kleinen Bauch angesetzt. Er strich sich über den imposanten Schnurrbart und ließ seinen Blick durch das Zimmer schweiften. „Wo sind denn die Jungs?“, erkundigte er sich, als er die beiden Ältesten vermisste.
„Sie treffen sich mit Freunden. Foelke ist auch noch mit einer Freundin unterwegs.“
„Aha!“ Kurz musterte der gestrenge Herr seine junge Verwandte und wandte sich erneut an seine Frau. „Und warum ist Gredel nicht mitgegangen? Da wäre mir wohler!“
„Ach, Gustav! Wir können Foelke doch nicht wegsperren. Sie ist doch schon fünfzehn. Sie macht noch einen kleinen Spaziergang mit ihrer Freundin. Sie ist bestimmt gleich wieder da! Gredel hat noch zu tun und wollte lieber hierbleiben.“
„Fleißig, fleißig!“ Der Onkel lächelte Gredel wohlwollend zu und vertiefte sich in die Zeitung. Kurz blickte er auf und wandte sich an das junge Mädchen. „Schenk mir doch bitte einen Sherry ein.“
Gehorsam legte Gredel die Näharbeit auf die Seite, holte ein Glas aus dem Schrank und suchte nach dem Sherry. Mit einem Knicks überreichte sie dem Hausherrn das Glas.
Onkel Gustav nahm einen Schluck und tippte mit dem Zeigefinger auf eine Schlagzeile. „Diese Reparationszahlungen, die Deutschland leisten soll, werden uns alle in den Ruin treiben!“, brummte er verärgert. „Wie lange soll das gehen? Bis unsere Enkelkinder gestorben sind?“
„Ach, Gustav“, mahnte Rudolfa. „Steht denn nichts Schönes in der Zeitung?“
„In der Zeitung steht nie etwas Schönes, mein Schatz!“ Er schlug die nächste Seite auf und lachte auf. „Stell dir vor, in Berlin gibt es jetzt eine Stadtbahn!“
„Oh?“
„Ja, sie führt vom Stettiner Nordbahnhof nach Bernau bei Berlin. Die Strecke soll groß ausgebaut werden und bald ganz Berlin miteinander verbinden.“
Rudolfa wechselte einen vergnügten Blick mit Gredel. „Dann kannst du dort bald überall hin. Vielleicht solltest du die Ausbildung doch in Betracht ziehen?“
Gredel nickte kichernd. „Das klingt alles sehr aufregend!“ Die Socken waren gestopft, und sie verabschiedete sich mit einem Knicks. „Gute Nacht“, wünschte sie höflich.
„Gute Nacht, mein Kind!“ Es klang wohlwollend und so freundlich, dass Gredels Herz vor Glück ein bisschen hüpfte. Sie nickte Gusti zu, die mit Schürze und Häubchen ein letztes Mal Holz für den Kamin brachte. Sie beobachtete, wie Gusti höflich knickste, das Holz nachlegte und gänzlich unbeachtet von den Houtrouws das Zimmer wieder verließ. „Brauchen Sie mich heute noch?“, wagte die Hausangestellte zu flüstern.
Rudolfa hob den Kopf. „Aber nein! Sie dürfen nun zu Bett!“
„Danke!“, hauchte Gusti. Rückwärts verließ das Dienstmädchen das Wohnzimmer und machte auch vor Gredel einen Knicks. Dann verschwand sie im Dunkeln.
Gredel wusste nicht einmal, wo das Mädchen schlief. Hatte es ein eigenes Zimmer, oder schlief es in der Küche, so wie Aschenputtel? Es gab ihr das Gefühl, privilegiert zu sein – wirklich zu dieser Familie zu gehören. Sie war die hochgeschätzte Nichte! Sie kehrte mit einer Bettpfanne in ihr kleines Zimmerchen zurück, das ihr zur Verfügung stand. Es war nicht ganz so kalt, weil der Kaminschacht an einer Wand durch das Zimmer führte. Die Einrichtung bestand nur aus einem Bett, einem kleinen Spind und einen Tisch mit Stuhl. Auf dem Tisch standen eine Waschschüssel und ein Krug mit frischem Wasser. Es war etwas altmodisch, denn im Erdgeschoss befand sich neben der großen Küche auch ein großes Badezimmer mit Badewanne samt Badeofen, Toilette und Waschbecken. Aber Gredel genoss es, hier in der Abgeschiedenheit ihrer Kammer eine kurze Katzenwäsche abzuhalten, ehe sie ins Bett schlüpfte. Unten gab es immer Gedränge, wer zuerst ins Bad durfte. Daher waren die Wasch- und Badezeiten planmäßig geregelt: zuerst die Mädchen und sie, dann die Jungen – gestaffelt nach Alter. Gredel schlüpfte bibbernd unter die Bettdecke und kuschelte sich in die weichen Daunendecken. Unten hörte sie die Haustür schlagen, als die anderen nach Hause kamen. Foelke bekam eine kleine Standpauke zu hören, weil sie länger ausgeblieben war, als den Eltern recht gewesen war. „Mutter!“, hörte sie die weinerliche Stimme ihrer Ziehschwester. „Ich habe doch nur Sabine nach Hause begleitet!“
„Ja, eben! Und anschließend bist du ganz allein nach Hause gekommen. Es ist schon längst dunkel. Da halten sich wohlerzogene Mädchen nicht im Freien auf.“
Der Rest der Worte wurde verschluckt, weil die Tante mit Elisabeth in die Küche ging, um dort weiter mit ihr zu schimpfen. Gredel lächelte in sich hinein, denn sie fand es schön, dass Rudolfa und Gustav sich so sehr um ihre Tochter sorgten. Müde schlief Gredel ein und träumte von der großen, weiten Stadt.
Am Sonntag besuchte Gredel ihre Eltern. Nachdem sie ihre Mutter nie gekannt hatte, war die Stiefmutter natürlich ihre „Mutter“. Anfangs war die Beziehung zu ihr gut gewesen, aber nachdem Amalie geboren worden war, hatte sich das Verhältnis verändert. Trotzdem hatte sich Gredel bemüht, ihr eine gute Tochter zu sein, aber ohne großen Erfolg. Die Mutter blieb abweisend und gefühlskalt. Seit sie bei den Houtrouws lebte, hatte sich die Beziehung zu der Stiefmutter zum Glück etwas entspannt. Aber das lag vielleicht einfach daran, dass nun alle Aufmerksamkeit Amalie galt.
Der Vater musterte sie mit einem prüfenden Blick und erkundigte sich nach der Pflegefamilie. „Bist du auch fleißig? Ich will keine Beschwerden hören!“
Gredel setzte sich etwas verzagt an den Tisch, auf dem bereits der Sonntagskuchen stand. Die elfjährige Amalie kam herbeigehüpft und begrüßte ihre ältere Schwester mit einer übermütigen Umarmung. „Na, min Deern, hast du mich vermisst?“, fragte Gredel mit einem herzlichen Lächeln. Sie liebte ihre kleine Schwester. Dass Amalie bevorzugt wurde, belastete nicht das Verhältnis zwischen ihr und dem Kind. Schließlich konnte es nichts dafür.
„Sehr!“, betonte die kleine Amalie. „Wann wohnst du denn wieder bei uns?“ Ihre Augen leuchteten hoffnungsvoll.
„Nun, meine Lütte, ich arbeite doch jetzt bei den Houtrouws. Da kann ich nicht einfach wegbleiben.“
„Aber ohne dich ist es so langweilig!“ Amalie schob schmollend die Lippen vor.
Gredel nippte an dem Tee, den die Mutter ihr eingeschenkt hatte. Er war mit Kluntje gesüßt und schmeckte bitter-süß. Gedankenverloren schaute Gredel durch das Fenster in den verschneiten Garten. Eine weiße Decke hatte sich auf die sorgfältig angelegten Beete gelegt, in denen der Vater das meiste Obst und Gemüse für den Eigenbedarf züchtete. Die Zweige der Obstbäume waren bereits zurückgeschnitten worden, und die kahlen Äste ragten in den Himmel. Gredel dachte an das eingemachte Obst und die Marmelade, die in großen Regalen im Keller standen. Meist reichte es den ganzen Winter und weit darüber hinaus. Eine Taube flatterte auf das Dach des großen Taubenhauses, das der Vater selbst gezimmert hatte – ebenso wie den großen Hühnerstall. Auch das kleine Häuschen war viel in Eigenbau und mit Hilfe der Familie errichtet worden. Es war der ganze Stolz des Vaters, der stets darauf achtete, dass alles gut erhalten blieb. Das Haus war in zwei Wohnungen aufgeteilt: Unten wohnte der Vater mit seiner Familie, und oben hatte er die Wohnung vermietet. Das Einkommen eines Lehrers war nicht so hoch, aber mit den Mieteinnahmen und der reichen Ernte des Gartens kam er gut über die Runden. Er war sparsam und verlangte dies auch von seiner Familie. So kam es, dass Gredel und Amalie sich ein Zimmer hatten teilen müssen – das Amalie nun für sich allein hatte. Das Leben spielte sich eh in der Küche ab – im Sommer auch auf der Terrasse, während die „gute Stube“ den Eltern oder Gästen vorbehalten blieb. Dort stand auch ein Schreibtisch, an dem der Vater die Hefte seiner Schüler korrigierte. Johannes Hinrichs war ein strenger, aber auch gerechter Lehrer.
Nur zögernd begann Gredel, mit ihrem Vater über ihre Pläne zu sprechen. „Ich habe über das Angebot von Onkel Enno nachgedacht …“
Ungeduldig unterbrach der Vater seine Tochter. „Nicht schon wieder! Ganz sicher lasse ich dich nicht allein nach Berlin! Das kommt überhaupt nicht in Frage.“
Gredel spürte, wie ein dicker Kloß im Hals ihre Stimme zu einem Flüstern werden ließ. „Ich wäre ja nicht allein … ich könnte doch bei Onkel Enno wohnen.“
„Wozu würde der einen unnützen Esser aufnehmen wollen?“ Sein forscher Blick musterte die Tochter fast ein bisschen höhnisch. „Die haben genug Arbeit mit den beiden Kleinen …!“
Gredel fühlte sich wie immer klein und unbedeutend in der dominanten Gegenwart ihres Vaters. Widerworte waren hier nicht erwünscht. Außerdem hatte er recht: Ihre Cousins Enno-Hans und Heinrich waren wirklich noch klein. Wäre sie dort tatsächlich eine Belastung? Die Mutter hob warnend ihren Finger und bedeutete ihr, dass es jetzt besser wäre, zu schweigen. Sie zeigte damit deutlich an, dass sie solche Gespräche am Sonntagnachmittag nicht mochte. Gredel schluckte schwer und versuchte es ein letztes Mal. „Ich bekomme eine Ausbildungsvergütung, die ich an Enno abtreten könnte, oder ich suche mir ein Zimmer zur Untermiete. Vielleicht finde ich ja ein Zimmer in der Nähe des Instituts.“
„Ausbildungsvergütung?“ Der Vater horchte auf.
„Ja, Onkel Enno sagt, dass ich im orthopädischen Institut ein kleines Lehrgehalt bekommen würde.“
„Aha, so weit sind deine Pläne also schon gediehen? Wo ist denn dieses Institut? Und als was würden sie dich dort ausbilden?“
„In der Lützowstraße – ganz in der Nähe von der Kurfürstenstraße. Ich würde dort zur orthopädischen Fachkraft und Röntgenassistentin ausgebildet werden. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe …“
Der Vater hob etwas erstaunt die Augenbrauen. „Krankenschwester reicht wohl nicht?“
Gredel senkte den Blick. Immer dieses Herumnörgeln an ihr zu ertragen, war eine harte Probe.
„Ich würde gern Ärztin werden, aber …“
„Ärztin?“ Die Stimme des Vaters wurde unangenehm hoch. „Wer hat dir denn diese Flausen in den Kopf gesetzt?“
Gredel bemühte sich um einen versöhnlichen Tonfall. „Das meine ich ja auch … aber als Röntgenassistentin könnte ich doch auch gute Dienste tun. Nach dem Krieg bilden sie inzwischen mehr Frauen darin aus … das wäre doch eine Möglichkeit für mich.“
„Wozu? Sollten wir nicht endlich einen Mann für dich suchen?“ Der Vater musterte sie streng von oben bis unten. „Eine Frau muss wissen, wo ihr Platz ist.“
„Ja, Vater!“ Gredel nickte unglücklich. Sie kämpfte mit den Tränen, als all ihre Träume zu platzen schienen: Berlin, die Ausbildung, Onkel Enno, ein bisschen Freiheit … wie schön wäre es, über den Kudamm zu schlendern! Sie hatte schon so viel darüber gehört. Sie wollte unbedingt die Luft einer Großstadt schnuppern, ehe sie in das Ehekorsett gezwungen wurde.
Es wurde still, und Gredel knetete nervös ihre Finger. Wie sollte sie ihren Vater von ihren Herzenswunsch überzeugen? Sie wechselte einen Blick mit ihrer Stiefmutter, wusste aber instinktiv, dass von dort keine Hilfe zu erwarten wäre. „Enno würde doch auf mich aufpassen“, versuchte sie es wieder. „Es wäre ja nur für eine Weile …
Der Vater wiegte nachdenklich den Kopf. „Andererseits muss man auch bedenken …“, lenkte der Vater unverhofft ein. „Als Röntgenassistentin wärst du deinem Vaterland vielleicht wirklich von Nutzen. Der Beruf bedeutet ja nicht, dass du dann keinen anständigen Mann mehr finden könntest. Ich werde mit Enno darüber sprechen. Allerdings werde ich ihn in die Pflicht nehmen, dass er auf dich aufpasst. Schließlich möchte ich nicht, dass du in Berlin unter die Räder gerätst.“
Sophie wechselte einen fassungslosen Blick mit ihrem Ehemann. „Du willst doch nicht wirklich …“
Johannes Hinrichs hob ungeduldig die Hand. „Lass mal, das ist meine Entscheidung. Es schadet bestimmt nicht, wenn Gredel etwas Pflichtbewusstsein und Fleiß erlernt. Alles Tugenden, die später mal für eine Ehe wichtig sind.“
Gredel sagte nichts, obwohl es an ihr nagte, dass der Vater ihr so wenig zutraute. Pflichtbewusstsein? Sie wusste genau, was von ihr erwartet wurde, und erledigte stets all ihre Aufgaben gewissenhaft. Mutter Houtrouw hatte sich jedenfalls noch nie über sie beschwert. Lag es an der Stiefmutter, die abends ihrem Mann mit Nörgeleien über sie in den Ohren lag? Das würde bald ein Ende haben, wenn sie tatsächlich in die große Stadt ging. Ihre Augen leuchteten hoffnungsvoll, als sie ihrem Vater wieder in die Augen schaute. „Nicht wahr!“, flüsterte sie aufgeregt. „Ich würde so viel lernen und erst einmal ein bisschen Geld verdienen. Davon könnte ich ja etwas nach Hause schicken …“
„Das erwarte ich auch!“, betonte der Vater. „Ich möchte nicht, dass du unvernünftig wirst und alles für irgendwelchen Tand ausgibst. Es ist besser, etwas Geld für Notzeiten zur Seite zu legen.“
„Natürlich, Vater!“, versicherte Gredel schnell. Sie war zu allen Zugeständnissen bereit, wenn sie nur gehen durfte.
Vater Hinrichs Blick ruhte auf einmal wohlwollend auf seiner Tochter, und er schien dieses Abenteuer tatsächlich in Betracht ziehen zu wollen. „Aber nur, wenn Enno auf dich achtet! Und wie viel verdienst du überhaupt …?“
Gredel konnte nur stottern, denn so viele Informationen hatte ihr Enno nun doch nicht geben können. Ihr ging es ja nur darum, diesem Kleinstadtmief zu entkommen.
Als Gredel am Abend wieder zu den Houtrouws zurückkehrte, klopfte ihr Herz vor Aufregung. Sie würde vielleicht nach Berlin gehen! Sie war immer noch überrascht, wie sie es geschafft hatte, den Vater umzustimmen. Sie musste die freudige Nachricht ihrer Ziehmutter erzählen! Hier würde die frohe Kunde nicht auf taube Ohren stoßen. „Mutter! Stellen Sie sich vor! Mein Vater ist damit einverstanden, dass ich eine Ausbildung zur Röntgenassistentin absolviere. Ist das nicht wunderbar?“
Die Tante schlug aufgeregt die Hand vor den Mund. „Wirklich? Das sind ja wunderbare Nachrichten! Wann beginnt denn die Ausbildung?“
„Vermutlich im Frühjahr!“, antwortete Gredel mit einem Vibrieren in ihrer Stimme. „Hach, ich werde Berlin sehen … und den Kurfürstendamm … und vielleicht in einen Filmpalast gehen … und mit der U-Bahn fahren.“ Sie lachte glücklich.
Rudolfa klatschte entzückt in die Hände. „Und vielleicht triffst du dort auch den Mann deiner Träume!“
Errötend senkte Gredel den Kopf. „Ach, an so etwas habe ich gar nicht gedacht!“ Sie kicherte etwas verlegen. „Erst einmal werde ich mich auf die Arbeit konzentrieren.“
„Das ist auch richtig so, min Deern!“, stimmte Rudolfa zu. „Aber wird dir der Abschied nicht schwerfallen?“
Gredel nickte. „Doch! Ich werde Ihre Familie sehr vermissen … Otto und Hermann und Elisabeth … aber zuhause hält mich nicht viel. Auch meine beiden Großmütter sind ja leider schon gestorben … was soll ich hier noch? Vater nörgelt immer an mir herum, und meiner Stiefmutter kann ich sowieso nichts recht machen.“
„Und Amalie?“
Gredel zuckte etwas zusammen, als das Schuldgefühl sie überkam. Ja, die kleine Amalie! Sie würde ihre Schwester tatsächlich vermissen … und umgekehrt. „Ach, Weihnachten komme ich ja nach Hause, und dann bringe ich ihr ein schönes Geschenk aus der Stadt mit.“
Rudolfa lachte auf. „Das wird sie bestimmt freuen. Und ihr könnt euch ja schreiben.“
„Ihnen schreibe ich auch!“, versicherte Gredel schnell. Der Abschied von ihrer Ziehmutter würde ihr schwer fallen, viel schwerer als von ihrem Vater.
Rudolfa berührte Gredel sachte an der Wange. „Mach das, mein Kind. Lass uns wissen, ob es dir gutgeht.“
„Noch ist ja ein bisschen Zeit“, meinte Gredel zuversichtlich.
„Weißt du was? So lange richten wir ein bisschen deine Aussteuer her …“, schlug Rudolfa fröhlich vor.
„Wirklich?“
„Aber ja, ich habe bestimmt ein paar Kleider, die man umändern kann! Wenn man sie ein bisschen kürzt, dann sind sie richtig modern.“
Gredel nickte überglücklich. Ihre Tante hatte wirklich schöne Kleider aus teuren Stoffen. Hier ein bisschen zu stöbern, würde Spaß machen! „So viele Kleider brauche ich ja nicht“, meinte sie bescheiden. „Im Institut werde ich wohl Schwesterntracht tragen.“
Gemeinsam durchstöberten sie den großen Schrank von der Tante, die einige Kleider, die ihr zu eng waren, an die spindeldürre Gredel abgab. Sie waren noch bodenlang, obwohl die Mode inzwischen nur noch bis zu den Waden ging. „Das machen wir schon“, meinte Rudolfa enthusiastisch. „Wir schneiden ein bisschen den Saum ab und fassen ihn wieder ein. Außerdem habe ich noch einige Röcke und Blusen, die ich dir geben kann.“ Gredel besah sich all die Sachen mit leuchtenden Augen und packte im Geiste schon ihren Koffer. Auf nach Berlin! Das Herz schlug ihr vor Aufregung bis zum Hals, als sie sich vorstellte, wie sie ganz allein in der großen Stadt über den Kurfürstendamm schlendern würde. Was es dort wohl zu entdecken gab? In der Nacht träumte sie von unterirdischen Zügen, beleuchteten Auslagen der Geschäfte und von mehrstöckigen Kaufhäusern, in denen sie sich zu verlaufen schien.
Pferdemarkt
Wehlau in Ostpreußen im Sommer 1924
Hellmuth schlenderte über die „Schanze“, das offene Gelände, das zu Füßen der Stadt Wehlau lag, auf dem buntes Treiben herrschte: Überall standen Pferde und daneben die Fuhrwerke und Autos der Händler. Manche Pferde standen in kleinen Verschlägen, manche waren einfach nur an einer Stange oder dem Fuhrwerk angebunden. Darüber flirrte die Hitze, und unzählige Fliegen umschwirrten ihre Opfer, die mit hängenden Köpfen und leicht schwingenden Schwänzen an dem bisschen Heu knabberten, das man ihnen vor die Hufe geworfen hatte. Es war Anfang Juli, und der Markt mit dem Pferdehandel war das wichtigste Ereignis der ganzen Umgebung. Von überallher waren Bauern, Händler und Besitzer von Gestüten angereist, um ihre Pferde anzubieten oder welche zu kaufen. Menschen drängten sich durch das Gewimmel, und Gesprächsfetzen in verschiedenen Sprachen hingen in der Luft. Hellmuth liebte dieses Ereignis und war extra aus Königsberg angereist, um sich hier mit Freunden zu treffen. Auch seine Familie freute sich, wenn er hin und wieder seine Studentenbude in Königsberg verließ und bei ihnen vorbeischaute. „Hach, da kommt ja der verlorene Sohn“, sagte seine Mutter immer, wenn er seinen Kopf zur Tür hereinstreckte.
„So selten lasse ich mich ja nicht gerade blicken“, murmelte er dann und ließ die Küsschen seiner Mutter über sich ergehen. Das Interesse war immer nur kurz, denn als stadtbekannte Persönlichkeit war sie stets mit irgendwelchen wichtigen Veranstaltungen beschäftigt. „Ich habe ja noch so viel zu tun!“, hatte die Mutter sich entschuldigt. „Wir erwarten Besuch! Kommst du pünktlich zum Tee?“
„Selbstverständlich!“, hatte Hellmuth versprochen, obwohl solch ein Besuch meist schrecklich langweilig war. Also hatte Hellmuth sich schnellstens verabschiedet, um sich hier unter die Leute zu mischen und ein bisschen den Geruch von Dreck, Pferden, Schmalzgebäck und geräuchertem Fisch einzuatmen. Im Hintergrund erhob sich das eindrucksvolle Rathaus mit dem gotischen Schauturm, in dem sein Vater als Bürgermeister die Stadtverwaltung leitete. Sein Vater hatte es weit gebracht: Aufgewachsen in dem kleinen Sensburg, hatte Otto Müller sich vom kleinen Verwaltungsbeamten hochgearbeitet und war zunächst Bürgermeister in Friedland, dann in Barten und schließlich in der Kreisstadt Wehlau geworden. Es war ein Versprechen gewesen: Als junger Mann hatte sich Otto Müller in die hübsche und sehr temperamentvolle Anna Schast verliebt, die ihm jedoch eine Abfuhr erteilt hatte, weil sie auf keinen Fall „Müller“ heißen wollte. Daraufhin hatte Otto ihr versprochen, dass er Karriere machen und Bürgermeister werden würde, damit jeder sie nur noch mit „Frau Bürgermeister“ anreden durfte. Er hatte Wort gehalten! Anna gefiel sich in der Rolle der Bürgermeistergattin und leitete Wohlfahrtskomitees und Frauennachmittage. Wehlau war in ihren Augen endlich standesgemäß!
Hellmuth musste schmunzeln, denn er wusste nur allzu gut, wie sehr sein Vater immer in Richtung der Kreisstadt gehofft hatte. „Seht ihr den Fluss?“, hatte er seine Kinder immer wieder gefragt. „Das ist die Alle … und die fließt nach Wehlau … und eines Tages werden wir dorthin ziehen.“ Seine Kinder waren gedrillt worden, die Erwartungen, die man an die gesellschaftliche Stellung einer Bürgermeisterfamilie hatte, zu erfüllen. Gerade sitzen – mit Büchern unter den Achseln – still sein, nur reden, wenn man gefragt wurde, all diese Dinge gehörten zu den Disziplinierungsmaßnahmen des strengen Vaters. Hellmuth und seine Schwester waren ohnehin meist von Dienstboten erzogen worden, da die Mutter natürlich ebenfalls ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nachgehen musste. Nur bei den Großeltern hatte Hellmuth mehr Freiheiten genossen und herumtoben oder auf Bäume klettern dürfen – bis die Mutter ihm eine Strafpredigt gehalten hatte, weil er seine Hose ruiniert hatte.
Inzwischen war Hellmuth vierundzwanzig, sah gut aus – mit den dunklen Locken seines Vaters, ausdrucksstarken Augen und einer guten Figur, stand aber immer noch unter der Fuchtel seiner Eltern, die von ihm verlangt hatten, ein Jurastudium aufzunehmen. Es grämte ihn nicht, da er ohnehin nicht wusste, was er sonst hätte lernen sollen. Er schwärmte fürs Militär, liebte Reiten und Schießen oder sportliche Aktivitäten. Das Studium betrieb er mit genügend Ernsthaftigkeit, um die Prüfungen mit Bravour zu bestehen. Sein Vater war stolz, weil er den Abschluss zum Referendar geschafft hatte, und behandelte ihn nun eher wie einen Erwachsenen und nicht wie einen Primaner, der noch erzogen werden musste. Das war es, was er wollte: von dem gestrengen Vater anerkannt werden.
Hellmuth drängte sich durch den Trubel und achtete kaum auf die lauten Feilschereien, die um ihn herum stattfanden. Er wollte weiter zum Flussufer, wo die Kirmes aufgebaut war. Dort gab es Schaukeln und Karusselle, aber auch Fischbuden und Stände mit Leckereien. Er hatte sich mit einem Freund verabredet, den er schon lange nicht mehr gesehen hatte, seitdem er in Königsberg mit dem Studium begonnen hatte. Es war ein trockener Stoff, mit dem er sich da herumschlug: Paragraphen, Gesetzestexte, Beispielfälle und jede Menge Akten. Mit Sehnsucht dachte er an die Zeit zurück, als er noch zum Feld-Artillerie-Regiment 52 in Königsberg eingezogen worden war. Noch im Juni 1918 hatte er sein Notabitur bestanden und war dann zum Kriegsdienst einberufen worden. In seinem Musterungsausweis stand: „Der Landsturmpflichtige Oberprimaner Helmut Müller geboren am 16.11.1900 in Sensburg hat bei der heutigen Musterung die Entscheidung k.v.Inf.I Garde (Feltartl.) erhalten.“ Hier hatte Kameradschaft geherrscht – und der Tag war ausgefüllt gewesen mit spannenden Übungen, die der Vorbereitung zum Kriegseinsatz hatten dienen sollen, obwohl Russland zu diesem Zeitpunkt schon kapituliert hatte.
Zum Glück hatte die Ausbildung an der Waffe länger gedauert als der restliche Krieg, obwohl er als wahrer Patriot unbedingt an die Front wollte. Für sein Vaterland zu kämpfen, war sein größter Wunsch gewesen. Die Ausbildung war nicht zimperlich gewesen, denn sie hatten mit scharfer Munition geschossen und lernen müssen, Kanonenfeuer standzuhalten. Trotzdem war es natürlich kein echter Einsatz gewesen. Fast neidisch hatte er den Erzählungen eines älteren Freundes gelauscht, der noch an der Westfront gekämpft hatte. Hellmuth wusste trotzdem, wie wahrer Krieg sich anfühlte: Er hatte noch als Jugendlicher erlebt, wie die Russen in Ostpreußen vorgerückt waren und seine Eltern aus Barten hatten fliehen müssen. Nach dem Krieg hatten sie in dem Haus nichts mehr vorgefunden – außer ein paar alten Fotoalben, die von den Plünderern zurückgelassen worden waren. Auch Wehlau war kurzzeitig von den Russen bedrängt worden. Einige Splitter und Einschusslöcher an den Hauswänden zeugten noch von dem kurzen Kampf, der hier stattgefunden hatte. Jetzt war der Vater damit beschäftigt, als Bürgermeister die Kriegsschäden zu beseitigen.
Hellmuth kam inzwischen nur noch in den Semesterferien zu Besuch hierher. Seine Eltern hatten gerade ein schönes Haus etwas außerhalb bezogen, das auf der anderen Seite des Pregel lag. So musste der Vater am Abend nach den Sitzungen im Rathaus nur über die lange Brücke wandern, die über den Fluss führte, wenn er nach Hause wollte. Die Mutter verbrachte den Tag damit, ihre Bediensteten herumzuscheuchen, die Gartenarbeiten zu überwachen und schöne Kissen zu sticken. Auch ihre Kochkünste waren berühmt, obwohl sie selbstverständlich nicht selbst kochte, sondern nur die Rezepte weitergab.
„Hallo, du Halunke! Wo hast du denn gesteckt?“, hörte er die sonore Stimme seines Freundes. Ein junger Mann mit blonden Haaren, einem Seitenscheitel und einem frechen Grinsen stand vor ihm. Er stellte das Idealbild eines germanischen Helden dar: groß, stattlich und durchtrainiert. Ludwig stammte aus Wehlau und leitete die Jugendabteilung des Rudervereins. Er war etwas älter als Hellmuth und hatte tatsächlich noch im Krieg gekämpft. Hellmuth hörte gern seine Geschichten, die von Pflichterfüllung und Vaterlandsliebe handelten. Ludwig hatte eine Verwundung am Arm davongetragen, die ihn nun in seinen ehrgeizigen Plänen, an der Olympiade in Paris 1924 teilzunehmen, ausgebremst hatte. Er nahm es mit ritterlicher Würde und widmete sich stattdessen dem Nachwuchs des Rudervereins.
Hellmuth klopfte seinem Freund freundlich auf die Schulter und grinste breit. „Studium!“ Er zuckte ergeben mit den Achseln.
„Und?“, wollte Ludwig wissen. Sein blonder Wuschelkopf wackelte neugierig hin und her.
„Staatsprüfung bestanden. Ich bin jetzt Gerichtsreferendar im Oberlandesgericht Königsberg.“ Hellmuth wippte stolz auf und ab.
„Das ist ja großartig! Was sagt dein gestrenger Vater dazu?“
„Dass ich endlich eines Bürgermeisters würdig bin!“ Hellmuth lächelte schief.
„Das klingt doch formidabel. Und was macht deine Schwester?“
„Huh!“ Hellmuth konnte sich diesen kleinen Ausrutscher in der Stimme nicht ganz verkneifen. Nachdenklich dachte er daran, dass er zwar gerade das Wohlwollen des Vaters gewonnen hatte, aber jemand anderer in seiner Familie quasi in die Verbannung geschickt worden war: seine Schwester Magdalena. Sie hatte sich entgegen dem Wunsch der Eltern in einen jüdischen Tanzlehrer verliebt und war von ihm schwanger geworden. Ein Skandal! Nicht nur, dass Magdalena minderjährig war – nein, der Tanzlehrer war auch noch um einiges älter! Der Vater war sprachlos über diese Unverfrorenheit gewesen, mit der sich dieser Mann an seine Tochter herangemacht hatte, und hatte seinen Unmut in endlosen Tiraden Luft gemacht. Er hielt ihn für einen Sittenstrolch und für einen Menschen ohne jeden Anstand. Gleichgültig, was Magdalena ihm auch erzählte – er blieb hart und lehnte jedes Gespräch mit diesem „Lumpen“ ab. „Ganz gut!“, erwiderte er ausweichend. „Sie ist in Leipzig verheiratet.“
„Ach, wirklich?“ Ludwigs Stimme klang enttäuscht.
„Ja“, erwiderte Hellmuth kurz angebunden. Was sollte er auch sonst sagen? Die ganze Situation war mehr als heikel.
„Stimmt was nicht?“, fragte Ludwig etwas verwundert, als er Hellmuths gedankliche Abwesenheit bemerkte.
Hellmuth lächelte entschuldigend. „Aber nein! Ich dachte nur daran, dass ich bald nach Königsberg zurück muss“, lenkte er vom Thema ab.
„Und? Ist es dort nicht schön?“
„Doch, doch!“, versicherte Hellmuth schnell. „Aber ich vermisse meine Freunde schon ein bisschen.“
„Das will ich hoffen!“ Ludwig grinste frech. „Wollen wir was trinken gehen?“
„Klar!“ Hellmuth dachte an das wenige Geld, das in seiner Hosentasche steckte, aber für ein Bier würde es wohl reichen. Die beiden verließen die Kirmes und wanderten in Richtung des Marktplatzes. Überall hingen noch Reste der üppigen Dekoration, die für den Besuch des Generalfeldmarschalls von Hindenburg vor einer Woche angebracht worden war. Verdorrte Blumen, Girlanden aus Tannenzweigen, bunte Fähnchen – es war, als wollte die Stadt die Erinnerung an den hohen Besuch möglichst lange bewahren. Hindenburg war hier beliebt, denn man rechnete es ihm hoch an, dass er die Russen in die Flucht geschlagen hatte. Der Anlass für Hindenburgs Besuch war eher unspektakulär gewesen: die Festlichkeiten zu Ehren des Kriegerdenkmals. Aber Wehlau hatte sich als wichtiger Standort für Geschäfte gemausert, sodass die Politik dem Städtchen mehr Aufmerksamkeit widmete.
Hellmuth führte seinen Freund in eine Wirtschaft direkt am Rathaus, die einen urigen Keller hatte. Hier war es schattig und in der sommerlichen Hitze schön kühl. Auch hier war es voll, denn die vielen Geschäftsleute und Händler, aber auch Wahrsager und fahrendes Volk, die das Stadtbild bevölkerten, mussten irgendwo essen. Die beiden fanden einen Tisch, an dem noch zwei Plätze frei waren, und setzten sich dazu. Die Anwesenden nickten freundlich und rückten zusammen, um Platz zu machen. Nur nebenbei hörte Hellmuth das Gespräch, das gerade im Gange war. Ein älterer Mann mit einer großen Pfeife im Mund wetterte gerade gegen die Standgebühren, die von der Stadtverwaltung erhoben worden waren. „Die verdienen sich eine goldene Nase, während wir hier das ganze Risiko haben. Wer will denn wissen, ob ich meine Gäule auch verkaufen kann?“
Hellmuth konnte nicht anders, als sich einzumischen. Mit einem Lachen meinte er: „Wenn Sie Ihre Pferde als Gäule bezeichnen, werden Sie wohl kaum gute Geschäfte machen! Die Stadt hat ja mit dem Pferdemarkt auch viel Arbeit: Überlegen Sie mal, wie viel Dreck hier liegen bleibt, wenn alle wieder weg sind.“
Der Mann zuckte ein wenig zusammen und musterte ihn dann streng. „Junkerchen, Sie müssen erst einmal trocken hinter den Ohren werden, ehe Sie hier Reden schwingen. Haben Sie denn schon mal versucht, ein Pferd zu verkaufen?“
„Nein!“, gab Hellmuth zu. „Aber ein bisschen was weiß ich schon über diesen Pferdemarkt. Mein Vater ist nämlich der Bürgermeister. Aber ich werde ihm erzählen, dass Sie die Gebühren als zu hoch erachten. Wie war Ihr Name?“
Die anderen am Tisch begannen zu lachen und schlugen dem älteren Mann tröstend auf die Schulter. „Da hast du dir aber den Falschen zum Diskutieren ausgesucht. Sei besser still, ehe du dich unbeliebt machst.“
„Schon gut! Schon gut!“, ruderte der Mann zurück. Brüsk stand er auf, um sich zu verabschieden. „Ich muss eh los und nach meinen Kunden schauen.“
„Gute Geschäfte!“, wünschte Hellmuth freundlich. Er sah ihn mit einem Lächeln hinterher, als dieser mit großen Schritten den Raum verließ.
Ludwig meckerte wie ein Ziegenbock. „Dem hast du es aber gegeben!“, meinte er bewundernd. „Wo hast du diese scharfe Zunge her?“
„Alles Übung aus dem Studium!“, sagte Hellmuth leichthin. „Da geht es die ganze Zeit nur um irgendwelche knifflige, spitze Redewendungen, Paragraphen und detaillierte Fußnoten.“
„O weh, das klingt aber gar nicht spannend.“ Ludwig schüttelte den Kopf.
„Ach, so schlimm ist es nicht. Mir macht es jedenfalls Spaß.“
„Und? Was gibt es sonst Neues? Was macht die Liebe?“ Ludwigs Augen bekamen einen schelmischen Ausdruck.
Hellmuth zog den Kopf ein. Was sollte er darauf antworten? Er war schüchtern, wusste nie, was er sagen sollte – ganz besonders bei Mädchen – und er war tatsächlich mit seinem Studium beschäftigt gewesen. Einzig eine junge Opernsängerin hatte es ihm angetan. Er hatte sie in Königsberg getroffen und himmelte sie seitdem platonisch an: Charlotte Bonsa-Piratzky. Sie sang in Richard Wagners „Die Walküre“ – und er war von ihr geradezu betört. Allerdings wusste er, dass seine Schwärmerei wohl nicht erhört werden würde. „Ach!“ Er winkte ab. „Für so etwas habe ich keine Zeit.“
Ludwig beließ es dabei. „Und deine Schwester ist in Leipzig verheiratet?“, bohrte er nach.
Glatteisgefahr! Hellmuth legte sich die Worte zurecht. „Genau“, bestätigte er die Lüge, die sich die Familie zurechtgelegt hatte. Sein Vater wollte das irgendwie klären, aber Hellmuth hatte keine Ahnung, wie. Seine Schwester war viel zu schnell verschwunden, um eine echte Vermählung vorzutäuschen. Hellmuth wusste nur, dass seine Schwester inzwischen ein kleines Mädchen hatte, das Anne-Marie hieß. Anna natürlich, weil die Mutter Anna hieß, obwohl Hellmuth nicht daran glaubte, dass der Name etwas an der verfahrenen Situation ändern würde. Eine Tochter mit einem unehelichen Kind war nichts, auf das man stolz sein konnte. Aber Otto Müller war hart geblieben: lieber ein uneheliches Enkelkind als eine Heirat mit einem jüdischen Tanzlehrer. Wie es seiner Schwester jetzt wohl ging? Er hatte versucht zu vermitteln, war aber bei seinem Vater auf genauso taube Ohren gestoßen. „Nimmst du sie etwa in Schutz?“, hatte sein Vater zornbebend gerufen. Manchmal war es besser, dann einfach zu schweigen. Er konzentrierte sich wieder auf seinen Freund, der etwas traurig in die Welt guckte.
„Ach!“ Es klang enttäuscht. „Ich dachte, sie hätte sich in diesen Tanzlehrer verliebt? In diesen Julius?“
„Nur kurz – aber dann kam eben dieser Offiziersanwärter daher …“ Hellmuth hoffte, dass sein Freund diese Lüge schluckte.
„Und mit dem ist sie nach Leipzig? Welches Regiment ist denn in Leipzig stationiert?“
Hellmuth hüstelte etwas. „Keine Ahnung. Ich wundere mich ja auch, dass mein Vater der Ehe so schnell zugestimmt hat.“ Lügen haben kurze Beine, dachte er sorgenvoll. Wenn schon Ludwig seiner Geschichte nicht glaubte, wer dann?
„Na ja … Offizieranwärter, das ist schon was! Da habe ich als Invalide natürlich keine Chance.“
Hellmuth senkte den Blick. Wenn es doch sein Freund gewesen wäre, der Magdalena den Hof gemacht hätte! Ein deutscher Junker – das wäre dem Vater bestimmt recht gewesen. „Sie hat eine kleine Tochter!“, erzählte er weiter, um Ludwig die Aussichtslosigkeit seiner geheimen Wünsche deutlich zu machen. Andererseits fühlte er Mitleid, denn sein Freund wäre bestimmt keine schlechte Partie gewesen.
„Ach!“
Beide schwiegen eine Weile, doch dann raffte Ludwig sich erneut auf. „Und deine Cousinen?“
Hellmuth lachte gutmütig. „Keine Ahnung. Ich habe sie länger nicht gesehen. Gibt es in Wehlau keine anderen Frauen, um die du werben könntest?“
Ludwig zuckte mit den Schultern. „Doch“, meinte er zögernd. „Aber wer will schon einen Kriegsveteranen …“ Er seufzte tief.
Hellmuth schüttelte den Kopf. „Du bist ein Mann in den besten Jahren. Diese kleine Schramme ist doch kein Hinderungsgrund … sei nicht so schüchtern.“
„Schüchtern? Das musst gerade du sagen! Außer einer platonischen Liebe zu einer Opernsängerin hast du doch nichts vorzuweisen.“
Autsch! Sein Freund wusste also Bescheid! Wer hatte ihn verpetzt? Hellmuth rollte genervt die Augen und versuchte, nicht als Versager dazustehen. „Noch kann ich ja einer Frau nichts bieten. Erst einmal muss ich die Referendarzeit überstehen, dann sehe ich weiter.“
„Da hast du auch wieder recht“, gab sein Freund nach.
Sie tranken das kühle Bier und genossen es, beisammen zu sein. Ludwig erzählte von den anderen Freunden, von dem Ruderclub und einer Schwester, die in Bälde heiraten wollte. Dann hatte er plötzlich eine Idee. „Hast du Lust? Wir machen morgen eine Ruderregatta, und ich brauche noch einen Mann. Mir ist kurzfristig einer ausgefallen. Ich könnte natürlich Martin fragen … aber du bist besser.“
„Gegen wen?“ Hellmuth war nicht sonderlich interessiert.
„Gegen die Mannschaft aus Taipau“, antwortete Ludwig mit einem frechen Grinsen. Taipau war die kleine Stadt neben Wehlau, die stets darunter litt, dass Wehlau ihr den Rang abgelaufen hatte. Die sportlichen Wettbewerbe zwischen den beiden Städten wurden immer besonders hart und rücksichtslos ausgetragen. „Autsch!“, meinte Hellmuth, plötzlich hellhörig geworden. „Das wird doch bloß wieder eine Wasserschlacht.“ Er erinnerte sich an den letzten Wettkampf, der darin ausgeartet war, dass beide Mannschaften versucht hatten, sich gegenseitig zu ertränken.
„Eben, deswegen brauchen wir ja Verstärkung.“
Hellmuth lachte aufgekratzt. Sollte er einfach noch mal jung sein? Sollte er einfach noch mal so richtig unvernünftig sein? Es juckte ihn in den Fingern, und er gab seiner Sehnsucht nach. „Na gut! Wann und wo?“
„Um zehn am Ufer der Alle bei den Bootshäusern.“
„Abgemacht!“ Hellmuth grinste in sich hinein und überlegte, wie er sich zuhause davonstehlen konnte. Ganz bestimmt würde er seinem Vater nichts von diesem Wettbewerb erzählen. Er musste quasi sofort nach dem Gang zur Kirche verschwinden – und das würde schwierig werden. Außerdem führte der Weg von der Kirche nach Hause direkt an der Anlegestrecke der Boote vorbei. So war es nur wahrscheinlich, dass die Familie von der Brücke aus dem Spektakel zusehen würde. Hellmuth seufzte. Ihm blieb wohl nichts anderes übrig, als seinen Eltern von seinen unziemlichen Plänen zu erzählen. Und was sollte er anziehen? Hingen denn noch seine Sportsachen in seinem ehemaligen Jugendzimmer? Er verabschiedete sich und wanderte über den Markt hinunter zum Pregel, über den die steinerne Brücke zum anderen Ufer führte. Die Brücke war voller Fuhrwerke und Kutschen, manchmal sogar Automobilen, die entweder zum Markt drängten oder ihn gerade verließen, sodass für Fußgänger nicht viel Platz blieb. Zweimal musste Hellmuth zur Seite springen, damit ein Fuhrwerk nicht über seinen Fuß rollte. Für Kinder war es manchmal lebensgefährlich, sich hier durchzuquetschen.
Zuhause saßen seine Eltern im schattigen Garten, tranken ihren Tee und aßen frischgebackene Plätzchen. Hellmuth wunderte sich, dass sein Vater als Bürgermeister nicht beim Pferdemarkt war, aber vielleicht legte er auch gerade nur eine Pause ein. Dann hielt er erstaunt inne, denn am Tisch saß eine weitere Person, die einen Säugling im Schoß hielt: Magdalena! Das war also der angekündigte Besuch! Warum hatte seine Mutter ihm nichts gesagt? Und wie, in Gottes Namen, war es Magdalena gelungen, die Eltern zu erweichen? Würde sie nun bleiben dürfen? Und was war mit diesem Julius? Seine Mutter winkte ihn fröhlich herbei. „Sieh nur, wer wieder bei uns ist!“
Hellmuth versuchte, seine Überraschung zu verbergen, und näherte sich seiner Schwester, um ihr ein Küsschen auf die Wange zu geben. „Schwesterherz, wie geht es dir denn?“, fragte er mit einem Lächeln. Dann bestaunte er das winzige Etwas. „Ah, und das ist meine kleine Nichte?“
Der Vater winkte etwas unwillig ab. „Nun mal langsam mit den jungen Pferden … wir beraten noch, wie wir die Situation darstellen wollen … Im Moment ist deine Schwester verheiratet, lebt mit ihrem Mann in Leipzig und ist nur kurz zu Besuch hier.“
„Aha!“ Hellmuth hütete sich, weitere Fragen zu stellen. Das war allein die Angelegenheit seines Vaters. Wichtig war nur, dass alle immer wieder die gleiche Geschichte erzählten. Sein Blick heftete sich liebevoll auf die Schwester, die sich ein klein wenig verändert hatte. Sie war reifer geworden – fraulicher. Das Kind stand ihr gut. Wenn es nur einen anderen Vater hätte!
„Aber Papa, kannst du es dir nicht noch mal überlegen? Julius ist doch ein lieber Mensch …“, ergriff Magdalena das Wort
„Schweig!“, polterte Otto ungeduldig. „Hast du diesen Nichtsnutz etwa wiedergesehen?“
„Aber nein … aber er möchte doch vielleicht für sein Kind aufkommen und … „
„Untersteh dich! Von diesem Lumpen wollen wir rein gar nichts. Ich verbiete dir den Umgang mit diesem Menschen.“
„Aber Papa, er ist doch ein anständiger …“
„Anständig?“ Die Stimme von Otto wurde unangenehm hoch. „Hat er mich etwa um Erlaubnis gefragt, ob er mit dir ausgehen darf? Ein uneheliches Kind hat er dir gemacht!“
„Aber nur, weil du mir verboten hast, ihn zu heiraten“, erklärte Magdalena ungewohnt kämpferisch.
„Zum Glück! Sei froh, dass ich dich vor einer Dummheit bewahrt habe.“
Die Stimmung war gekippt. Hellmuth warf seiner Schwester einen warnenden Blick zu, der sagen sollte, dass es besser wäre, jetzt einzulenken.
Magdalena schob trotzig die Lippen vor und schaukelte eine Weile ihre Tochter. Dann besann sie sich und mäßigte ihre Stimme. „Und wie soll es nun weitergehen? Ich kann ja nicht ewig in Leipzig bleiben.“ Sie sah die Eltern traurig an. „Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm es dort ist.“
„Wirst du denn da nicht gut behandelt?“, forschte die Mutter alarmiert.
„Doch, doch“, versicherte Magdalena. „Aber es ist so langweilig. Ich wäre viel lieber wieder bei euch.“ Ihre Stimme gurrte mitleidheischend.
Otto wurde wieder freundlich und schäkerte liebevoll mit dem Kind. „Aber natürlich, wir wollen ja auch unseren kleinen Schatz um uns haben – nicht wahr, Anna?“
Die Mutter nickte heftig und ließ sich das Enkelkind geben, um mit ihm zu schmusen. „Aber ja! So ein kleiner Sonnenschein!“, stimmte sie ihm bei. „Kind, du isst ja gar nichts! Nimm dir doch ein paar Plätzchen. Ursel hat sie ganz frisch gebacken.“ Sie schob der Tochter auffordernd den Teller hin.
Gehorsam griff Magdalena nach einem Plätzchen und steckte es sich in den Mund. Verstohlen musterte sie dabei ihren Vater. Hellmuth setzte sich auf einen freien Stuhl und beobachtete die Szene wortlos. Wie seine Schwester und sein Vater sich gegenübersaßen und sich kämpferisch anstarrten, belustigte ihn. Seine Schwester war dem Vater so ähnlich: nicht nur im Aussehen, sondern auch an Sturheit.
Natürlich wirkte der Bürgermeister beeindruckend mit seiner Statur und seinem großen Schnauzbart, aber Magdalena stand ihm in nichts nach: Die gleichen ausdrucksstarken Augen und der herausfordernde Blick, mit dem sie den Vater immer wieder reizte. Hellmuth griff nach einem Plätzchen und ließ sich von der Mutter einen Tee eingießen, während er auf den Ausgang dieses Disputs wartete.
Der Vater ließ sich nicht beirren. „Du gehst nach Leipzig zurück. Basta. Wir warten eine Weile ab, und wenn Gras über die Sache gewachsen ist, kehrst du als geschiedene Frau heim. Das ist immer noch besser, als diese Schande.“
Magdalena blinzelte leicht, als sie diese Nachricht erst einmal verdauen musste. „Geschieden?“, fragte sie verwirrt.
„Allerdings. Du bekommst Papiere, die dich als geschiedene Müller-Siast ausweisen. Das ist nicht schwer. Den Namen von Großmutter haben wir damals ja auch schon von Schast in Siast umgeändert. Das klingt einfach nicht so polnisch. Und dann suchen wir einen vernünftigen Mann für dich.“
„Ich werde nie jemand anderen lieben!“, rief Magdalena empört. „Ich habe mich doch mit Julius nicht eingelassen, weil ich ihn furchtbar finde. Was denkst du eigentlich?“
„Dass er deine Jugend und Unerfahrenheit ausgenutzt hat“, sagte der Vater streng.
„Trotzdem, ich werde nie jemand anderen lieben.“
„Auch gut!“, sagte der Vater ruhig. „Dann sei froh, dass wir das nun für dich regeln.“
„Und wie lange soll ich noch in Leipzig bleiben?“ Magdalenas Stimme kratzte, als sie merkte, dass ihre geheimen Wünsche auf taube Ohren stießen. Vielleicht hatte sie gedacht, dass das Kind die Eltern umstimmen würde, aber diese Hoffnung wurde nun enttäuscht.
„Wir dachten, dass du Weihnachten wiederkommst. Bis dahin habe ich die Papiere fertig, und es ist auch glaubhaft, dass du dich von einem untreuen Ehemann getrennt hast.“
„Untreu?“ Magdalena hob angewidert die Augenbrauen.
„Irgendeine Geschichte musst du ja wohl erzählen.“
„Und wenn ich mit ihm durchbrenne?“, forderte Magdalena ihren Vater heraus.
„Warum habt ihr das bisher nicht getan?“ Der Ton des Vaters wurde spitz. „Der ist doch längst über alle Berge.“
Magdalena schluckte schwer. Irgendwie hatte ihr Vater da recht. Seit Julius aus dem Haus geworfen worden war, hatte er sich nicht mehr bei ihr gemeldet. Er wusste auch nicht, dass er eine kleine Tochter hatte. Wie sollte er sie auch in Leipzig ausfindig machen? Es war ein cleverer Schachzug gewesen, sie so weit fortzuschicken. „Hat er denn noch mal nach mir gefragt?“, fragte sie kleinlaut.
„Hier?“ Der Vater runzelte die Stirn. „Natürlich nicht. Ich habe ja wohl deutlich gemacht, dass er hier unerwünscht ist.“ Er hielt kurz inne und wurde dann etwas freundlicher. „Kind, er ist auf und davon. Ich habe ihn auch in Wehlau nie mehr gesehen.“
„Wirklich?“
Der Vater nickte und kniff die Lippen zusammen, als er die Traurigkeit seiner Tochter sah. „Wirklich! Du warst für ihn nur ein flüchtiges Abenteuer. Nun mach dir keine Sorgen! Wir haben das geregelt, und nun wohnst du mit der Kleinen wieder bei uns. Irgendwann lernst du bestimmt einen netten Mann kennen.“
„Nie!“, versicherte Magdalena trotzig. „Nie!“
Der Vater beließ es dabei und lächelte seinem Sohn zu. „Und, hast du einen Bekannten getroffen?“
Hellmuth nickte. „Ja, Ludwig!“
„Ein feiner Kerl – und tapfer! Leitet er immer noch den Ruderclub?“
Hellmuth grinste erleichtert, als sein Vater ganz nebenbei das richtige Thema anschnitt. „Ja, er veranstaltet morgen eine Regatta gegen Tapiau und hat gefragt, ob ich mich anschließen könnte. Sie brauchen wohl noch einen starken Mann.“
„Ah, da wird es viele Zuschauer geben“, freute sich Otto ungewohnt locker. „Die werden alle auf der Brücke stehen, sodass dort überhaupt kein Durchkommen mehr sein wird.“
„Ach, viele werden auch an der Regattastrecke am Flussufer stehen“, meinte Hellmuth. „Sie wollen ja sehen, wer gewinnt.“
„Hoffentlich!“ Der Vater maß ihn mit einem gutmütigen Blick. „Und du willst tatsächlich teilnehmen? Ist das nicht etwas unter der Würde eines Gerichtsreferendars?“
Hellmuth lachte fröhlich. „Noch bin ich das ja nicht! Also kann ich mich ja noch ein bisschen austoben.“