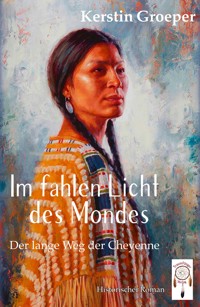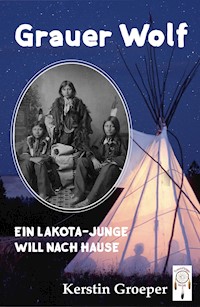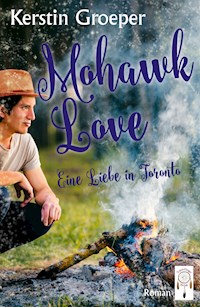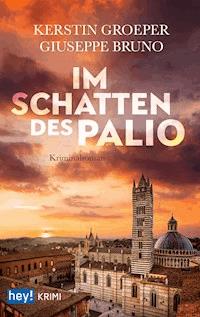4,95 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Ein Volk ist unbesiegt, solange die Herzen seiner Frauen nicht bezwungen sind." Der Winter des Jahres 1870/71 ist hart und die Lebensmittel sind knapp. Wah-bo-sehns, eine junge Frau vom Stamme der Crow, trauert um ihren Ehemann, als ihr Dorf von einer Gruppe Lakota (Sioux) angegriffen wird. Sie fällt mit ihrem Kind in die Hände der Feinde und sieht voller Angst einer ungewissen Zukunft entgegen. Doch Tschetan-withko, genauso einsam wie sie, nimmt sie zur Ehefrau und adoptiert das kleine Mädchen. Dieses Buch erzählt das Schicksal einer Gruppe Lakota in der letzten Phase des Freiheitskrieges ihres Volkes. Es erzählt von ihrem täglichen Leben, ihrer Liebe und ihrem Hass, ihrer Ohnmacht und ihrem Kampf. Nach der Schlacht am Little-Bighorn-Fluss werden die Indianer gnadenlos gejagt und auch die Gruppe von Tschetan-withko und Wah-bo-sehns zieht sich unter unmenschlichen Entbehrungen und schweren Verlusten mitten im Winter nach Kanada zurück. Besonders die Frauen werden mit ihren Kindern zu Opfern eines Vernichtungsfeldzuges der weißen Soldaten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Für Bruno
Der scharlachrote Pfad
Eine Sioux-Saga
Historischer RomanvonKerstin Groeper
Impressum
Der scharlachrote Pfad, Kerstin Groeper
TraumFänger Verlag Hohenthann, 2014
1. Auflage eBook Februar 2022
eBook ISBN 978-3-948878-18-4
Lektorat: Ilona Rehfeldt
Satz und Layout: Janis Sonnberger, merkMal Verlag
Datenkonvertierung: Bookwire
Titelbild: Arlich
Copyright by TraumFänger Verlag GmbH & Co. Buchhandels KG, Hohenthann
Inhalt
Wah-bo-sehns
Lakota Oyate
Hitschikyata
Hokahey
Schunkmanitutanka
Maka-Luta
Che-ni
Miles O‘Brian
Wooyusinke
Kowakipe
Iwoblu
Woablehsa wakan
Kanghi-Witschascha
Wi-wahnyang Watschipi
Wohpeton Witschascha
Wolakota
Wi-Hinachpe
Okusche
Ignipi
Wognaye
Thoka
Pedschi-sla-wakpa
Untschi Makotsche
Iyaglupta
Okize
Trakini
Omnitschiye
Witscha-itschache Tokahe
Mila-hanska
Witschoni
Lo Tschinpi
Pte ole hokschila kin hena
Kupi
Personae dramatis:
Tschetan-withko, Lakotakrieger
Wah-bo-sehns, seine Crowfrau
Graueulenmädchen, adoptierte Tochter
Wolfssohn, Sohn
Verlorenes-Hirschkalb, adoptierte Pawnee-Tochter
Mahtola, jüngster Sohn
Traumpfeil, bester Freund und Schwager von Tschetan-withko
Uinohnah, Ehefrau von Traumpfeil und Schwester von Tschetan-withko
Blitz-im-Winter, Sohn
Heller-Mond, Tochter
Bärenkralle, Medizinmann
Hitschikyata, Crowjunge und Gehilfe des Medizinmannes
Viele-Feinde, Freund von Tschetan-withko
Kleine-rote-Blume, Pawneefrau
Kleines-Hengstfohlen, adoptierter Sohn
Morgentau-im-Gras, Tochter
Schwarzer-Rabe, Freund von Tschetan-withko
Vogelmädchen, Ehefrau
Breite-Schulter, Sohn
Regenwolke, Tochter
Fisch, Kola von Tschetan-withko
Stern-im-Auge, geraubte Pawneefrau
Tschaske, Sohn
Zwei-Pferde, Häuptling der Gruppe
Untschischi, Ehefrau
Elchkalb, später der Ehemann von Che-ni-win
Krummes-Büffelhorn, Sohn
Blitzwolke, Tochter
Grauer-Wolf, Bruder des Häuptlings
Ehefrau
Rote-Erde, Cousin von Elchkalb
Gras-im-Wind, Tochter und Ehefrau von Antilopensohn
Rote-Erde, adoptiertes Pawneekind
Grauadler, Freund von Tschetan-withko
Gebrochener-Zweig, Ehefrau
Weidenzweig, Tochter
Jenny /Che-ni-win, adoptiertes weißes Mädchen
Lächeln-im-Herzen, 2. Frau
Takukin, adoptierter Sohn
Tschoka-sapa, Freund von Tschetan-withko
Fallende-Sterne, Ehefrau
Otter, ältester Sohn
Blaufeder, Tochter
Habichtkralle, jüngster Sohn
Viel-Schnee, 2. Frau vom Volk der Yanktonnai
Crow-Bären-Mädchen, Tochter
Miles O’Brian, weißer Trapper
Rose, Shoshonefrau
Bonny, Tochter
Dublin, Sohn
Jenny / Che-ni-win, Tochter von Miles O’Brian
Tatokala, junger Indianer, der als Scout für Miles arbeitet
Lacht-am-Boden, junger Indianer, der sich der Gruppe anschließt
Weidenzweig, Ehefrau, Schwester von Che-ni-win
Sieht-die-Büffel, Sohn
Antilopensohn, junger Krieger
Gras-im-Wind, Ehefrau, Freundin von Che-ni-win
Baby-Mädchen
Klares-Wasser, spätere Nez-Percé-Frau
Kleiner-Vogel, adoptierter Sohn
Donnerherz, älterer Krieger
Ältere Frau
Älterer Sohn
Morgenröte, Tochter
Tschapa, Sohn
Rabenfrau, 2. Ehefrau
Blauer-Donner, Tochter
Sohn-des-Windes, junger Crowkrieger
Morgenröte, Ehefrau, Freundin von Che-ni-win
Donnern-am-Fluss, Sohn
Geschichtlich überlieferte Personen:
Sitting Bull, Häuptling und Medizinmann der Hunkpapa
Crazy Horse, Hemdträger und Kriegshäuptling der Lakota
Red-Cloud, Häuptling der Oglala-Lakota
Captain Nelson A. Miles, Offizier in den Indianerkriegen
Brigade General George Crook, Oberbefehlshaber
Lieutenant Cornel George Armstrong Custer, Offizier in den Indianerkriegen
General Alfred Terry, Offizier in den Indianerkriegen
Major General John Gibbon, Offizier in den Indianerkriegen
James Morrow Walsh, Offizier der North-West Mounted Police
Doktor Nevitt, junger Arzt der Mounted-Police
Colonel Eugene Smith, Kommandant von Fort Laramie
Captain Guido Ilges, Kommandant von Fort Laramie
Wah-bo-sehns
Montana Territorium (Winter 1870/71)
Wah-bo-sehns kniete im Schnee und schaukelte leise klagend vor und zurück. Sie hatte schon lange keine Tränen mehr und ihre Stimme war nur noch ein heiseres Krächzen. Eine blaue Decke lag lose um ihre Schultern, längst kein Schutz gegen die bittere Kälte, die das Land in den eisigen Klauen hielt. Die Haare wehten ihr ins Gesicht, peitschten sie, als wollten sie die Frau in ihrer Trauer strafen. Apathisch saß Wah-bo-sehns in der Kälte und nahm dies alles nicht mehr wahr. In ihr herrschte Leere, Fassungslosigkeit und eine Trauer, die körperlich schmerzte. An einem Baumstumpf gelehnt schlummerte die Tochter, warm eingewickelt auf dem indianischen Wiegenbrett, dort schlief sie, nichtsahnend von der Trauer und der Verzweiflung ihrer Mutter. Einige Schritte weiter schwankte das Totengerüst eines Mannes im eisigen Wind. Seine Waffen baumelten hin und her, mit Lederschnüren an den Pfosten befestigt, und das hölzerne Klappern erzeugte eine seltsame Melodie. Gleichmäßig, eintönig pfiff der frostige Atem des Kaltmachers, wie ein Todeshauch umstrich er die Grabstätte mit der trauernden Frau, so als wollte er als nächstes nach ihr greifen.
Wah-bo-sehns dachte an all die Toten, die Kaltmacher sich in diesem Winter bereits geholt hatte. Hatte Ah-badt-dadt-deah, der Schöpfer der Welt, die Absarokee verlassen? Regelmäßig wurden sie von Lakota, Cheyenne oder Blackfeet überfallen, doch diese Geplänkel waren nichts im Vergleich zu den Krankheiten der Weißen, die ihr Volk heimsuchten. Viele Menschen, kleine Kinder, Alte, aber auch junge Frauen und Männer waren bereits an der heimtückischen Hustenkrankheit gestorben, die auch ihren Mann dahingerafft hatte. Wie gelähmt hockte Wah-bo-sehns neben dem aufgebahrten Leichnam, unfähig das Geschehene zu begreifen. Immer wieder sah sie sein erstarrtes Gesicht vor sich, eingefallen von der langen Krankheit und im Tode verkrampft, so als würde er verzweifelt um den letzten Atemzug kämpfen. Micgy, ihr Mann! Wie es Sitte war, hatte sie sich als Zeichen der Trauer die Haare gekürzt, die Stirnhaare geschnitten und sich tiefe Schnitte in den Armen zugefügt. Doch das war äußerlich. Innerlich war ihr Herz kalt und leer. Ohne die Sorge um ihr Baby wäre sie ihrem Mann längst in die Geisterwelt gefolgt, hätte ihr Herz gezwungen, endlich stillzustehen. Doch so lebte sie weiter, stillte und versorgte ihre Tochter, hockte teilnahmslos im Schnee, vor Trauer wie erstarrt. Höhnisch krächzend saßen die Raben, Schutzsymbol ihres Volkes, in den Wipfeln der Bäume und spotteten über das Leid der jungen Frau. Flatternd setzte sich einer der schwarzen Gesellen auf das Totengerüst und blickte mit schräg geneigtem Kopf auf sie hinunter.
„Warum lacht ihr über meine Trauer?“, flüsterte Wah-bo-sehns vorwurfsvoll, richtete anklagend die Augen auf ihn, als hätte er dieses Unglück über sie gebracht. So wie viele Menschen ihres Volkes suchte sie das Gespräch mit dem Tier und vernahm wie selbstverständlich dessen Antwort.
„Ihr habt zu viel Mitleid mit euch selbst!“, höhnte der Rabe. Überall sterben in diesem Winter die Tiere, das ist der Lauf der Welt, aber ihr Menschen stört die Ruhe mit eurem Wehklagen.“
„Was weißt du schon über den Verlust, der mir den Verstand raubt!“, klagte Wah-bo-sehns ihn an.
Der Rabe öffnete den Schnabel, ruckte seinen Kopf in die Höhe und antwortete krächzend: „Verlust! Tod! Sterben! Wir leben damit! Auch unsere Kinder sterben im Winter, und unsere Alten werden vom Fuchs gerissen.“
„Empfindest du nichts, wenn deine Kinder sterben?“
„Nein, denn im Frühling brüten wir neue Kinder aus, sie sind alle gleich.“
„Unsere Kinder sind nicht alle gleich. Wir lieben sie!“ Kurz schaute Wah-bo-sehns auf ihre Tochter, dann forderte sie den Raben heraus: „Du bist unser Schutzvogel, aber du schützt uns schlecht!“
„Ich schütze nur die Starken!“ Wieder erklang das heisere Lachen des Vogels. „Achte auf dich, sonst holt der Winter auch noch deine Tochter!“
Wütend sprang Wah-bo-sehns auf und schleuderte einen Eisklumpen nach dem unwillkommenen Gast. „Verschwinde! Verschwinde, denn du störst die Totenruhe meines Mannes!“
Eine Hand griff plötzlich beschwichtigend nach ihrem Arm und Wah-bo-sehns hörte die Stimme ihrer Schwiegermutter: „Lass die Raben lachen! Wir müssen für uns selbst sorgen. Komm, meine Tochter! Dein Baby weint und hat Hunger. Hier ist es zu kalt für dich.“
Mit verschwommenen Augen blickte Wah-bo-sehns auf ihre Schwiegermutter. Stille-Frau, eine zerlumpte Gestalt mit schwarz gefärbtem Gesicht, gebrochen von dem Verlust des Sohnes.
„Ich komme schon, Mutter“, murmelte Wah-bo-sehns widerwillig. Warum trug sie der eisige Wind nicht einfach davon?
„Du solltest dich nicht so weit von unserem Dorf entfernen“, mahnte Stille-Frau eindringlich. Erst im Herbst hatte ihnen eine Gruppe Blackfeet alle Vorräte geraubt und mehrere Angehörige ihres Stammes getötet. Es war gefährlich, den Schutz des Dorfes zu verlassen.
„Ich bin nicht weit weg. Ich bin bei meinem Mann!“, antwortete Wah-bo-sehns fast ein wenig trotzig.
„Aber es ist zu kalt!“
Mühsam nahm Wah-bo-sehns das Kind mit ihren steifen Fingern auf und stapfte in Richtung des Dorfes. Ihre Schwiegermutter folgte ihr und leiser Trauergesang erklang, als die beiden Frauen gebückt gegen den Wind kämpften. Der Schnee war zu Eis gefroren und knirschte unter den weichen Sohlen ihrer Mokassins. Die Zweige der knorrigen Nadelbäume brachen bald unter der Last des schweren Schnees und die Zelte in der Ferne waren unter der weißen Decke kaum zu erkennen. Wie große Zuckerhüte lagen die Zelte in einer Senke, zur Westseite hin völlig mit Schnee verweht. Schutzsuchend, als wären es lebende Wesen, schmiegten sich die Tipis an den Rand des Waldes, nutzten den Windschutz, den die dunkle Wand aus Zweigen und Stämmen bot. Die blauen Bighorn Berge, sonst nur schemenhaft im Dunst zu sehen, erschienen in der eisigen Luft zum Greifen nahe.
Wah-bo-sehns war völlig durchgefroren und erschrocken tastete sie nach den Fingern des Kindes. Doch ihre Tochter fühlte sich warm an, ihr Greinen wurde energischer und lauter.
„Meine Tochter!“, hörte sie die leise Stimme ihrer Schwiegermutter. „Finde wieder den Pfad in das Licht.“
Wah-bo-sehns schaute mit zusammengebissenen Zähnen in den grau verhangenen Himmel. Wo war hier Licht?
„Alles ist dunkel um mich herum“, flüsterte sie.
Die dürren Finger von Stille-Frau streichelten über die Wiege. „Sieh nur, deine Tochter lebt! In ihr liegt die Zukunft unseres Volkes. Wenn du nicht auf dich achtest, wird auch sie sterben.“
Ein trockenes Schluchzen schüttelte die junge Frau und anklagend blickte sie auf ihre Schwiegermutter. „Vielleicht sterben wir alle. Unsere Vorräte sind erschöpft. Selbst die Raben wenden sich von uns ab.“
„Unsere Krieger werden wieder auf die Jagd gehen. Bald. Du wirst sehen.“
„Ach! So viele unserer Krieger sind krank. Meine Milch wird versiegen, wenn sie kein Fleisch bringen.“ Zähneklappernd zog Wah-bo-sehns die Decke fester um sich und drückte das Kind an sich. Sie war zu jung für so viel Leid! Traurig blickte sie auf die schön bestickte Wiege in ihren Armen und auf das kleine Mädchen, das mit großen Augen hervorlugte. „Was wird jetzt aus uns?“
„Komm endlich in mein Zelt! Mein älterer Sohn wird dich gewiss als zweite Frau bei sich aufnehmen. Dann hat dein Kind einen Vater. Er wird es gerne großziehen.“
Wah-bo-sehns Kehle schnürte sich zusammen, sie wollte noch nicht an einen anderen Mann denken. Tränen sammelten sich in ihren Augen. Wie sehr hatte sich Micgy über seine Tochter gefreut und jetzt sollte sein Bruder sie großziehen? Noch wollte sie nicht als geduldete Zweitfrau in seinem Tipi leben! Noch nicht. „Ich danke für deine freundlichen Worte. Ich werde darüber nachdenken“, meinte sie ausweichend. Natürlich war es völlig unmöglich, dass sie als Witwe weiterhin allein lebte, aber sie hatte um einige Tage Ruhe gebeten, um ihre Gedanken zu ordnen und Abschied zu nehmen.
Sie huschte in ihr Zelt und schürte hastig das Feuer an, um die Kälte zu vertreiben. Müde bemerkte sie, dass nur noch wenig Holz vorhanden war. Sobald sie ihr Kind gestillt hatte, musste sie sich wieder auf den beschwerlichen Weg machen, um Holz zu sammeln. Sie setzte sich an das Feuer und legte ihre Tochter an die Brust. Das kleine Mädchen saugte gierig, die kleinen Finger vor Anstrengung zu Fäusten geballt. Das Feuer wärmte Wah-bo-sehns und hungrig blickte sie in den rußgeschwärzten Kessel. Nun, viel war nicht mehr darin, aber für heute reichte es. Einige Jungen hatten Fische gefangen, hin und wieder brachte ein Jäger einen Hirsch mit, doch der Winter war noch lang und das Wild in der Nähe des Lagers wurde spärlich. Sie wusste es, trotzdem klammerte sie sich an die Hoffnung, dass es für sie und ihr Kind reichen würde. „Ihr Kind“ – es hatte noch nicht einmal einen Namen! Micgy hatte ihr einen Namen geben wollen, wenn er wieder gesund war. Doch nun war er tot. Sie blinzelte die Tränen weg und blickte auf ihre Tochter. Satt und zufrieden lag sie in ihrem Arm, selig schlafend. Vorsichtig bettete sie das Kind auf einige Felle, dann legte sie noch Holzscheite nach, damit es im Zelt warm blieb. Die Kälte schnitt ihr ins Gesicht, als sie das Tipi verließ und sie zog die Decke fester um sich. Gerne wäre sie länger am Feuer sitzen geblieben, aber sie musste die Zeit nutzen, solange das Baby schlief. Mühsam stapfte sie durch den hohen Schnee in Richtung Wald und trat unter die Bäume. Hier kam sie besser vorwärts und sie wandte sich ostwärts zu einer kleinen Schlucht. Überall lagen umgestürzte Kiefern, grau und tot, die sie mit ihrem kleinen Beil zerhacken konnte. Mit einem Seufzen sammelte Wah-bo-sehns die schweren Äste und legte sie auf einen Haufen. Mit einem langen Riemen band sie das Bündel zusammen und kletterte die Schlucht wieder hinauf. Ruckweise zog sie dabei das Holz hinter sich her, dann nahm sie es auf den Rücken und ging in ihrer Spur zum Dorf zurück.
Sie erreichte ihr Zelt und schob das Holz zum Trocknen in die Nähe des Feuers. Ihre Tochter gluckste leise und behutsam öffnete Wah-bo-sehns die durchnässte Windel. Sie nahm trockenes Moos aus einem Korb und legte es auf das lederne Tuch, das sie als Windel benutzte. Die kleinen Füße ihres Babys strampelten und die winzigen Fäuste flogen ruckartig hin und her, während sie das Kind wickelte. Ein feines Lächeln huschte über das Gesicht des kleinen Mädchens und betroffen blickte Wah-bo-sehns in das winzige Gesicht. Sie hatte in ihrem Kummer gar nicht bemerkt, dass ihre Tochter inzwischen lachen konnte. Behutsam hielt sie das Baby hoch und lächelte zurück. Es krähte vor Freude darüber, endlich die Aufmerksamkeit seiner Mutter zu haben, doch es war nur ein kurzer Moment des Lichts. Während sie das Baby auf die Felle legte, versank Wah-bo-sehns wieder in ihren Erinnerungen. Sie sehnte sich so sehr nach ihrem Mann, dass es schmerzte. Verbissen klammerte sie sich an alltägliche Dinge, verrichtete methodisch ihre Arbeiten, kümmerte sich fast zwanghaft um ihre Pflichten. Jede Kleinigkeit lenkte sie von ihrer Trauer ab.
Die Wunden an ihren Armen waren verkrustet und juckten ein wenig. Vorsichtig rieb sie an ihnen, jedoch ohne die Narben aufzukratzen. Immer wieder erinnerte sie der unangenehme Juckreiz an ihre Trauer und stille Tränen liefen über ihr Gesicht. Eigentlich war es Sitte, dass sie das getrocknete Blut kleben ließ, sich nicht mehr wusch und schmutzige Kleider trug. Aber es hatte sie so sehr angeekelt, dass sie sich doch mit Schnee gewaschen hatte. Auch wegen des Babys. Sie brachte es einfach nicht über das Herz, das kleine Mädchen an ihre verschwitzten Brüste anzulegen oder auf schmutzige, blutverschmierte Arme zu nehmen.
Sie hörte Schritte auf ihr Zelt zukommen und wunderte sich, wer wohl zu ihr käme. Ein leises Kratzen an der Zeltwand deutete an, dass der Besucher zu ihr wollte. „Komm herein!“, hauchte sie unwillig, denn eigentlich wollte sie allein sein. Es war Hitschikyata, ein stiller Junge, der von den anderen Kindern eher gemieden wurde. Wahrscheinlich, weil sein Vater ein Heiliger Mann war und schon früh begonnen hatte, seinen Sohn in die Geheimnisse der Geisterwelt einzuweihen. So interessierte er sich für Heilpflanzen, hörte lieber die Geschichten seines Vaters, anstatt mit den anderen Jungen wilde Streiche zu spielen. Mit der lässigen Geschmeidigkeit einer Katze ließ er sich auf einem Fell nieder und richtete seine wissbegierigen Augen auf sie. „Wie geht es dir?“, fragte er wohlerzogen.
Sie senkte nur verlegen den Kopf. Was sollte sie darauf antworten?
Hitschikyata übersah ihre Verlegenheit und nutzte ihre Unaufmerksamkeit, um heimlich zwei Kaninchen neben den Eingang zu legen. Er wollte die Frau nicht demütigen, indem er ihr zeigte, wie wenig sie tatsächlich hatte. So wenig, dass selbst ein Kind sich genötigt sah, ihr etwas zum Essen zu bringen. Mit einem Lächeln setzte er sich neben das Baby und streichelte gedankenverloren die Finger des Mädchens, staunte wie winzig sie waren. Vielleicht durfte er sie ja mal auf den Arm nehmen? Er wollte wissen, wie schwer so ein Kind war, schließlich war er der Sohn des Medizinmannes und sollte über diese Dinge Bescheid wissen. Eigentlich wusste er reichlich wenig über Frauen und Babys. Bei nächster Gelegenheit würde er Wah-bo-sehns wieder etwas zu essen bringen und eine gute Gelegenheit abwarten, mit ihr über das Kind zu reden. „Sie ist niedlich!“, strahlte er aufmunternd, bemerkte zufrieden, dass ein winziges Leuchten in den Augen der trauernden Frau zu sehen war. Mit einem kurzen Nicken verabschiedete er sich und verließ das Zelt, um nach seinen Eltern zu sehen.
Wah-bo-sehns sah die beiden Kaninchen und seufzte dankbar. Ein scheues Lächeln huschte über ihre Züge, ein kleiner Dank an den Jungen, den dieser nie sehen, aber erahnen würde. Dann arbeitete sie weiter an dem Kleid, das sie nach der Trauerzeit tragen würde. Die Arbeit lenkte sie ab und völlig in Gedanken versunken legte sie Perlen auf die Nadel, alles Dinge, die Micgy im Herbst noch für sie bei einem weißen Händler eingetauscht hatte. Zum Nähen benutzte sie feine Tiersehnen, manchmal auch das Garn, auf das die blauen und rosafarbenen Perlen in langen Ketten aufgefädelt waren. Sie säumte den Ausschnitt ihres Kleides mit einer Borte und ließ das Muster über die Schultern weiterlaufen. Ihre schulterlangen Haare steckte sie hinter ihre Ohren, damit sie besser sehen konnte und eine innere Ruhe überkam sie, als etwas Schönes in ihren Händen entstand. Ihre Augen tränten nach einer Weile, weil das Feuer herunterbrannte und sie fast nichts mehr sah. Schließlich war das Kleid fertig und befriedigt legte sie es neben sich. Ein letztes Mal wickelte sie ihr Baby und stillte es noch einmal für die Nacht. Dann kroch sie unter ihre Decken und fiel sofort in einen tiefen Schlaf.
Der Warnruf ihres Volkes, gefolgt von schrillem Kriegsgeschrei, ließ sie hochschrecken und benommen sprang sie auf. Die Lakota, ein Stamm der Teton-Sioux, hatten das kleine Dorf der Crow entdeckt und einige Krieger wollten den Feinden ihren Mut beweisen und Beute machen. Sie fielen in den Morgenstunden über das schlafende Dorf her, ihre Gesichter schwarz und möglichst furchteinflößend bemalt. Panik brach aus, als Frauen und Kinder aus den Zelten liefen, schreiend in den Wald flüchteten, und schlaftrunkene Krieger sich den Angreifern in den Weg stellten.
Wah-bo-sehns horchte auf die Kriegsschreie und ihr Herz raste. In Windeseile schlüpfte sie in ein Kleid und in die Mokassins, griff nach ihrer schlafenden Tochter und stürmte aus dem Zelt. Zwei wild brüllende Krieger sahen in ihre Richtung und einer warf in einer drehenden Bewegung seinen Speer auf sie. Instinktiv duckte sie sich, der Speer verfehlte sie nur knapp und ohne weiter auf die Feinde zu achten, rannte sie so schnell sie konnte auf den Wald zu. Sie hörte, dass sie verfolgt wurde und die Angst verlieh ihr Flügel. Mit pochendem Herzen erreichte sie den Waldrand und blindlings flüchtete sie ins Unterholz, bemerkte nicht, wie ihr die Zweige ins Gesicht und gegen Arme und Beine schlugen. Sie blieb mit ihrem wehenden Haar an den Zweigen hängen und riss sich mit einem Ruck los. Ihr Atem kam stoßweise, wie von fern hörte sie das Keuchen des feindlichen Kriegers hinter sich, der stetig näherkam.
Sie presste das wimmernde Kind an sich und hastete immer weiter in den Wald. Das Baby behinderte sie, weil sie die Hände nicht frei hatte, um Zweige und Äste zur Seite zu schieben. Ihre Lungen schienen zu bersten, als sie eine Ewigkeit durch das Unterholz hetzte, doch der Feind ließ nicht von ihr ab. Sie stolperte über verschneite Wurzeln und ihre Füße verhedderten sich in verdorrten Ranken, dann hatte der Mann sie erreicht.
Ihr Schrei verhallte unbeachtet in der endlosen Wildnis, ebenso sinnlos wie das Quieken einer Maus, wenn der Bussard zuschlägt. Eine Hand zog sie ruckartig an ihren Haaren zu Boden, eine andere Hand entriss ihr das Kind und warf es grob in den Schnee. „Nein!“ Ihre Stimme wurde schrill, als sie vergeblich versuchte, nach ihrer Tochter zu greifen. Wah-bo-sehns hörte das Baby abgehackt schreien und panisch kämpfte sie gegen den Angreifer, der sie mit seinem schweren Gewicht zu Boden drückte. Ihre Hand krallte sich in seine Zöpfe, mit der anderen versuchte sie, in die Augen des Kriegers zu kratzen. Blitzschnell drehte der Mann den Kopf zur Seite, dann knurrte er ungeduldig und schlug ihre Hand zu Boden. So viel Wucht lag in dem Schlag, dass sie fast jedes Gefühl in ihrer Hand verlor und sie kraftlos, als wäre sie gebrochen, in den Schnee sinken ließ. Ruckartig wurde ihr Kopf nach hinten gebogen und die eiskalte Klinge eines Messers drückte sich an ihre Kehle. Starr vor Entsetzen blickte sie in die schwarze Fratze, die sich über sie beugte. Schlaff lagen ihre Hände im Schnee, tasteten dann flehend nach der Brust des Angreifers. Der Mann lockerte den Griff in ihrem Haar und sagte etwas zu ihr, was sie nicht verstand. Sie lag da wie versteinert, nur ihre Brust hob und senkte sich, als sie versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Dann fühlte sie, wie eine Hand des Mannes auf unschickliche Weise unter das Kleid fasste. „Nein!“, brüllte ihr Innerstes. „Bitte nicht!“ Sie fühlte, wie sein Unterkörper durch den Lendenschurz gegen ihren Schoß drückte und in Todesangst starrte sie ihn an, vor Schreck und Scham wie gelähmt. Sie versuchte, hinter die schwarze Fratze zu blicken, sah, wie seine roten Lippen sich zu einem verächtlichen Grinsen verzogen. Sie biss die Zähne zusammen und lag ganz still, betete, dass er sie und ihr Baby gehen ließ. Ihre Beine brannten in dem kalten Schnee und immer noch fühlte sie seine Hand an ihrer Brust. Ihr Geist wandte sich in Abscheu ab, es war nur ihr Körper, den dieser Halsabschneider berührte. Wenn nur ihre Tochter leben durfte, dann würde sie auch das ertragen. Hoffnungsvoll bemerkte sie, dass die Klinge seines Messers nicht mehr an ihre Kehle drückte, stattdessen stützte sich der Mann mit seiner freien Hand im Schnee ab. Warum kam niemand, um ihr zu helfen?
Der Krieger war überrascht, dass die Frau, die vorher noch gekämpft hatte, nun wie ein verschrecktes Kaninchen unter ihm lag. In der Nähe wimmerte das Baby, kläglich und abgehackt, sonst war nichts zu hören. Er hieß Tschetan, Falke, und im Moment fühlte er wieder die Kraft seines Namensvetters in seinem Blut. Er hatte Pferde von seinem Feinden, den Psa, rauben wollen, doch dann hatte ihn sein Instinkt diese Frau jagen lassen. Wie ein Falke hatte er sie durch den Wald gejagt und war auf sie niedergestoßen wie ein Raubvogel auf seine Beute. Er hielt sie niedergedrückt, so wie er einen feindlichen Mann niederzwingen würde und erst jetzt bemerkte er, dass er unter dem weiten Ärmel des Kleides ihre Brust umfasst hatte. Weiche, warme Haut, wohlgeformt und verwirrend weiblich. Peinlich berührt glitt seine Hand ein wenig tiefer, suchte eine andere Stelle, um sie festzuhalten, ohne an diese Weiblichkeit erinnert zu werden. Fast ein wenig amüsiert beobachtete er, wie sie zusammenzuckte und ahnte ihre offensichtlichen Gedanken. Es lenkte ihn ab, erinnerte ihn unangenehm daran, dass er schon zu lange bei keinem Weib mehr gelegen hatte. Aber nicht hier, nicht jetzt! Verlegen zog er seine Hand zurück, unterbrach den unschicklichen Kontakt mit der Frau. Er hatte ihr genug Angst eingejagt, abgesehen davon, dass es ihm zu kalt wurde. Sollte sie doch ihrem Mann erzählen, welch großmütigem Krieger sie begegnet war! Er wollte seine Kampfkraft nicht schwächen, indem er sich von einer Feindfrau ablenken ließ. Überhaupt, wo waren denn die Krieger, die ihre Weiber verteidigten? Verächtlich blickte er in ihre weit aufgerissenen Augen und plötzlich fühlte er keine Verachtung gegenüber dieser Frau, sondern nur seine eigene Überlegenheit. Das hier war zu einfach, nicht ehrenvoll. Er wollte den Kampf mit ihrem Mann! Zögernd ließ er sie los, richtete sich auf, sicherte bereits mit einem prüfenden Blick die Umgebung.
Wah-bo-sehns fühlte sich erniedrigt und beschmutzt. Immer noch spürte sie seine Hand auf ihrer Brust und die Unschicklichkeit dieser Berührung benebelte sie. Tränen liefen über ihr Gesicht, als sie zu ihrem Baby krabbelte und es hochhob. Das Kind war aus der Decke gerollt und nur mit einem leichten Wildlederhemd bekleidet fror es entsetzlich. Vorsichtig tastete sie nach den dünnen Ärmchen, suchte nach einer Verletzung, aber ihr Baby schien unversehrt. Sie wickelte es wieder in die leichte Schlafdecke und erhob sich zitternd. Würde dieser Feind sie jetzt beide töten? Sie starrte auf den kräftigen Krieger, der sie ausdruckslos beobachtete und wurde ruhig. Wenigstens würde sie ihrem Mann unberührt in die Geisterwelt folgen, wenigstens hatte dieser Feind ihr die Ehre gelassen, schien dies auch gar nicht beabsichtigt zu haben. Er schien eher unschlüssig zu sein, was er nun tun sollte und musterte sie herablassend. Schließlich machte er eine großzügige Geste und bedeutete in Zeichensprache: „Du-gehen-zu-deinem-Mann! Er-viel-feige-nicht-dich-verteidigen!“
Wah-bo-sehns verstand die beleidigenden Zeichen, denn sie waren allen Präriestämmen gleichermaßen bekannt. Sie stand im Schnee und plötzlich wallte bodenloser Zorn in ihr hoch. Sie war in Trauer, eine heilige Frau! Selbst diese verhassten Halsabschneider mussten das wissen! Wie konnte er es wagen, sie anzurühren, sie hier zu demütigen! Der Zorn von Ah-badt-dadt-deah sollte ihn treffen! Wider aller Vernunft schleuderte sie ihm ihren ganzen Hass entgegen und unterstrich ihre Worte in Zeichensprache: „Du-Feigling! Ich-nicht-haben-Mann! Ich-in-Trauer! Du-Feigling! Du-kämpfen-gegen-wehr-lose-Frauen-und-Babys.“ Das Kind hinderte sie ein wenig die richtigen Zeichen zu geben, aber ihre Botschaft war trotzdem klar und deutlich. Hochmütig drehte sie sich um und lief in Richtung ihres Dorfes zurück.
Tschetan war sprachlos über diese Beleidigung. Dieses undankbare Weib! Hatte er sie nicht eben noch verschont? Seinen Großmut bewiesen? Wütend setzte er hinter ihr her, hatte sie nach wenigen Schritten eingeholt, am Arm gepackt und brutal zu Boden gerissen. Mit voller Wucht stürzte die Frau rückwärts in den Schnee, hatte seiner Kraft nichts entgegenzusetzen. Sofort kniete er auf ihr, bohrte sein Knie in ihren Bauch und hob seine Kriegskeule zum tödlichen Schlag. Sein Herz pochte im Rausch der Wut, doch dann traf sein mörderischer Blick ihre vor Entsetzen weit aufgerissenen Augen. Durch den Schleier seiner Wut hörte er das hilflose Weinen des Kindes. Er sah den Schmerz der Frau, ihr tränenüberströmtes Gesicht, ihre Todesangst und plötzlich verrauchte seine Wut genauso schnell wie sie gekommen war. Er hatte die abgeschnittenen Haare als Zeichen der Trauer erkannt, aber ignoriert. Seine Backenmuskeln zuckten, als er die Verletzungen an ihren Armen sah, die sie sich selbst zugefügt hatte. Er hatte sie gesehen, aber für Kratzer von den Zweigen und Ranken gehalten. Warum hatte sie ihr Gesicht nicht geschwärzt? Warum trug sie kein Trauerkleid? War ihre Trauerzeit schon beendet? Zögernd ließ er die Keule sinken. Der Augenblick sie zu töten war vorbei und er wusste es. Diese Frau war mutig und sie war stolz. Wieder fühlte er dieses Begehren in sich aufsteigen, den Wunsch nach einer Frau. Ein plötzlicher Entschluss reifte in ihm heran, völlig widersinnig und ohne die Konsequenzen zu überdenken: Er würde sie mitnehmen! Diese Psafrau würde es sicherlich nicht wagen, ihn zu verlassen, denn sie musste an das Kind denken. Kurz wallte Mitleid in ihm hoch, dass eine so junge Frau bereits Witwe war, sie zählte bestimmt noch keine zehnmal zwei Winter. Entschlossen packte er ihren Arm, riss sie hoch und schob sie vorwärts. „Inachni-yo!“, befahl er, dabei unterstrich er seine Aufforderung mit einem ungeduldigen Ruck seines Kopfes.
Wah-bo-sehns sah ihn entsetzt an, wagte kaum zu atmen, als der Krieger langsam die Waffe sinken ließ. Sie verstand sehr gut, dass sie mit ihm gehen sollte und schluckte schwer. Noch vor einem Augenblick wollte er sie töten und nun wollte er sie mitnehmen? Es war furchtbar kalt, ohne warme Decken würde das Baby erfrieren. Doch der Krieger trieb sie umbarmherzig zur Eile an, brummte etwas in dieser Sprache, die sie nicht verstand. Sie schüttelte den Kopf und machte eine bittende Bewegung in Richtung ihres Dorfes, hoffte ein letztes Mal auf sein Mitleid.
Tschetans Geduld war erschöpft und unmissverständlich zeigte er auf sein Messer. Bald wären ihm die Psa auf den Fersen und dann gefährdete er nicht nur sich, sondern auch seine Freunde. Er hatte bereits genug Zeit mit diesem Weib verschwendet. „Inachni-yo!“, wiederholte er gefährlich leise.
Wah-bo-sehns erbleichte und ließ sich willenlos vor ihm her treiben. Was sollte das? Wieso behinderte dieser Mann sich mit einer Frau und ihrem Kind? Was wollte er? Sie war in Trauer, stand damit keinem Mann zur Verfügung, außerdem stillte sie ein Baby, war also alles andere als begehrenswert! Sein Handeln ergab keinen Sinn! Panische Angst durchlief sie, und sie dachte daran, was geschehen würde, wenn er sein Tun endlich überdachte. Würde er dann zuschlagen? Hinterrücks? Sodass sie seine Keule nicht kommen sah? Ihre Beine wurden schwer vor Angst und wieder hörte sie dieses ungeduldige Knurren.
Schließlich packte der Mann sie am Arm und zwang sie zu einem schnelleren Schritt. Sie keuchte unterdrückt, versuchte ihre Angst irgendwie zu kontrollieren. Aber dieser grausame Mann trieb sie immer weiter in die Kälte, gnadenlos und ohne Pause. Sie taumelte vorwärts, ließ sich immer weiter schieben, während das Entsetzen nach ihrem Herzen griff. Sie wurde verschleppt! Im Winter. Dieser Mann war verrückt! Sie fühlte, wie der Schnee in ihre Beine schnitt und bereits nach kurzer Zeit fraß sich die Kälte in ihren Körper. Es war so kalt! Zu kalt! Der Mann aber drängte sie unbeeindruckt vorwärts und sie fühlte seine gefährliche, drängende Nähe hinter sich, jederzeit bereit, sein Beil in ihren Schädel zu schlagen. Mehrmals stolperte sie im hohen Schnee über Wurzeln und umgestürzte Bäume, stützte sich dann mit ihrer Hand auf, bis ihre Finger steif von der eisigen Kälte waren. Sie hatte in diesem Gewirr aus Bäumen und Ästen, durch die der Feind sie umbarmherzig hetzte, bald jede Orientierung verloren.
Der Mann zischte jedes Mal unwillig, wenn sie stürzte und riss sie an ihrem Arm wieder hoch. Schlotternd vor Kälte steckte sie notdürftig das Kind unter ihre Ärmel, um es wenigstens etwas zu wärmen. Ihr Baby wimmerte leise und das kleine Gesicht wurde unnatürlich grau. Es würde in ihren Armen erfrieren. Wieder taumelte sie vorwärts, vor Angst um ihr Kind fast besinnungslos. Das Wimmern wurde leiser, die Bewegungen weniger und sie wusste, dass ihre Tochter nicht überleben würde. Erschöpft sank sie schließlich auf die Knie und weigerte sich weiterzugehen. Sollte der Feind sie doch hier und jetzt töten, aber sie konnte es nicht ertragen, ihr Kind sterben zu sehen.
„Tokah-ho?“, hörte sie die unwillige Stimme des Mannes.
„Tokah-ho?“, wiederholte er fordernd und machte eine fragende Handbewegung.
Sie sah unsicher zu ihm auf, versuchte sein schwarzes Gesicht zu ergründen. „Es-ist-viel-kalt“, erklärte sie eingeschüchtert mit kurzen Gesten. Tränen schimmerten in ihren Augen, als sie die blauen Lippen ihrer Tochter sah.
Tschetan sah auf das Baby und erkannte ebenfalls, dass es zu erfrieren drohte. Was wollte er eigentlich mit einer Frau und einem Säugling? Wahrscheinlich starben die beiden sowieso auf dem Rückweg! Auch die Frau sah schrecklich aus. Ihre Haut wies bereits erste Erfrierungen auf und ihre Bewegungen wurden langsam. Sollte er die Frau wieder zurückschicken? Aber sie waren inzwischen so weit von den wärmenden Tipis entfernt, dass das Kind auf jeden Fall sterben würde. Unsicher blickte er auf die zusammengesunkene Frau, in deren Augen er keine Angst, sondern nur völlige Verzweiflung sah. Mitten im Winter eine Frau mit einem Baby zu entführen. Wakan-tanka, der große Geist, spielte ihm hier einen merkwürdigen Streich. Aber er begehrte sie und er würde sich eine Klapperschlange in sein Bett holen, wenn er jetzt nichts unternahm. Das schlechte Gewissen stieg in ihm hoch, die Erkenntnis, dass er eine trauende Frau in solche Bedrängnis brachte. Er wollte sie lebend an seiner Seite, wollte ihren geschmeidigen Körper spüren und vielleicht eines Tages ihre Liebe gewinnen. Er lächelte, um sie zu beruhigen, aber mit seiner schwarzen Kriegsbemalung wirkte es alles andere als vertrauenerweckend und so wich die Frau instinktiv vor ihm zurück. Kurz entschlossen nahm er ihr das Kind aus den steifen Händen und steckte es unter sein warmes, weit geschnittenes Lederhemd. Die Frau hatte sich aufgerichtet und versuchte, ihm das Kind wieder wegzunehmen, doch er warf ihr einen warnenden Blick zu, es zu unterlassen. Die Tränen liefen über ihr Gesicht und er empfand Mitleid. „Baby-warm“, zeigte er mit seiner Hand. Sie stieß ein gequältes Stöhnen aus und befürchtete wohl das Schlimmste. Er übersah ihre Angst und drängte sich mit einem großen Schritt an ihr vorbei. Behutsam hielt er dabei das Kind an seinen Körper gepresst. Es war winzig und leicht und behinderte ihn kaum. Noch versuchte er Distanz zu diesem Wesen zu halten, sich nicht an das Gefühl zu gewöhnen, dass es nun ihm gehörte. Warum hatten seine anderen Frauen ihm keine Kinder geschenkt? Der Gedanke stach und er wischte ihn unwillig beiseite. Ohne sich umzublicken, stapfte er durch den Schnee, wohl wissend, dass sie ihm widerstandslos folgen würde und dass sie all ihre Kräfte zusammenraffen würde, um mit ihm Schritt zu halten.
Wah-bo-sehns war völlig überrascht von diesem Verhalten. Hoffnung regte sich in ihr, dass er sie vielleicht beide leben ließ. Warum sollte er sich sonst die Mühe machen, das Baby zu tragen? Schwankend trat sie in seine Spur und beeilte sich, dem fremden Krieger nachzukommen. Ihre Waden brannten von der Kälte, doch sie biss die Zähne zusammen. Wenn sie jetzt aufgab, hätte ihre Tochter kein Mitleid zu erwarten, abgesehen davon, dass dieser Feind wohl kaum ein Baby ernähren könnte.
Tschetan hörte ihre langsamen Schritte, spürte ihre völlige Erschöpfung und hoffte, dass sie bald den Treffpunkt erreichen würden, an dem ihre Pferde warteten. Mit der gefangenen Frau würde er zu Pferd schneller vorankommen, außerdem konnte er ihr dort zumindest eine Pferdedecke gegen die Kälte geben. Das Wimmern des Babys hatte aufgehört und irgendwie berührte es ihn, etwas so Kleines im Arm zu halten. Erst jetzt wurde ihm die Tragweite seines Handelns bewusst und auch, wie weit er noch von seinem eigenen Dorf entfernt war! Sein Handeln war völlig verrückt, im höchsten Maße verantwortungslos. Er verringerte seine Geschwindigkeit, damit ihm die Frau folgen konnte, horchte aufmerksam, ob ihm vielleicht sonst noch jemand auf den Fersen war. Schließlich schrie er wie ein Käuzchen und fast augenblicklich antwortete ihm das Geheul eines Kojoten. Erleichtert trat er auf die kleine Lichtung, die sich vor ihm öffnete, und sah seine Freunde, die ihm bereits entgegenliefen. Deutlich war die Freude in ihren Gesichtern zu sehen, doch dann wich die tiefe Erleichterung dem Gefühl des ausgelassenen Triumphes. Hokahey! Es war ein guter Kampf gewesen! Keiner war verletzt und sie hatten eine Menge erbeutet.
Schwarzer-Rabe zeigte triumphierend zwei Pferde, ein Gewehr und eine kunstvoll bemalte Bisonrobe. Viele-Feinde führte zwei weitere Crowpferde herbei, die schnaubend an der Leine tänzelten. Lachend blickte er auf Tschetan. „Wan, was ist denn geschehen? Ich dachte, wir wollten nur Pferde rauben?“
Abwehrend hob der Krieger seine Hand. „Alles lief gut, doch dann trat das Pferd, das Grauadler erbeuten wollte, gegen einen Holzstoß! Jener Psa kam sofort aus seinem Tipi heraus und ehe ich ihn töten konnte, hatte er das ganze Dorf geweckt.“
„Das haben wir gemerkt! Hoh, sind wir gerannt!“, meinte Viele-Feinde theatralisch.
„Ja!“ Tschetan grinste schief. Dann erzählte er weiter: „Plötzlich stürzten die Feinde wie Hornissen aus ihren Zelten und ich wollte zurück in den Wald. Da floh diese Frau aus dem Tipi und ich verfehlte sie knapp mit meinem Speer.“
„Hohch! Du hast sie verfehlt?“ Völliger Unglauben sprach aus der Stimme von Viele-Feinde.
Tschetan winkte nachlässig ab. „Sie rannte wie ein aufgeschreckter Hirsch in den Wald, ausgerechnet in Richtung unserer Pferde. Ich musste ihr eigentlich nur folgen und trieb sie immer weiter vor mir her. Sie war ganz schön schnell!“
Neugierig blickten die Krieger auf die Frau, die Tschetan erbeutet hatte. Ein guter Coup! Sie klopften ihm anerkennend auf die Schultern und machten anzügliche Bemerkungen: „Eh, eine hübsche junge Frau! Hast du sie schon …?“
Tschetan schubste sie verlegen zur Seite. „Lasst sie in Ruhe!“
Dann sahen seine Freunde das schlafende Baby in seinen Armen und wechselten verwunderte Blicke. „Was willst du mit einer Frau, die ein so kleines Kind hat?“, fragte Schwarzer-Rabe.
„Ich weiß noch nicht“, wehrte Tschetan die Frage ab.
„Warum nimmst du es überhaupt mit, wenn du nur die Frau willst? Sie wird dir bald eigene Söhne gebären.“
Die Frau sah die abfälligen Handbewegungen der anderen Krieger und verstand sehr gut, dass sie ihren Peiniger fragten, warum er ihr den Säugling gelassen hatte. Deutliche Panik lag in ihrem Blick.
Tschetan aber blickte auf das Baby und zuckte mit den Schultern. „Hätte ich es den Wölfen überlassen sollen? Nein, ich nehme beide mit.“ Er sagte es ganz einfach, ohne besondere Betonung, trotzdem wussten seine Freunde, dass er es ernst meinte und seinen Entschluss nicht ändern würde.
Verdutzt starrten sie ihn an und schüttelten den Kopf. „Mit dem Säugling wird uns die Frau nur aufhalten!“, wandte Viele-Feinde ein. Dann schluckte er eine weitere Bemerkung hinunter, als er in Tschetans zusammengekniffene Augen sah. Die Stimme seines Freundes wurde ganz ruhig, fast eisig: „Dann kann ich immer noch entscheiden, was ich zu tun gedenke.“
„Hohch!“ Viele-Feinde senkte verlegen die Augen. Ihren Freund sollte man heute besser nicht reizen, er hatte die schlechte Laune eines Stinktieres.
„Sind dir die Psa gefolgt?“, fragte Schwarzer-Rabe stattdessen.
„Nein!“
„Waren keine da, oder warst du von dieser Frau so abgelenkt, dass du keine gesehen hast?“
Tschetan strafte seinen Freund mit einem vernichteten Blick. „Keine Frau lenkt mich ab! Es waren keine da. Die Psa sind feige wie die Schneehasen und schützen ihre Frauen schlecht. Ich bin überrascht, dass sie überhaupt noch Frauen haben.“
Leises Lachen antwortete ihm auf diesen Scherz und vergnügt musterten die Männer die gefangene Frau. Tschetan schubste sie zu seinem Pferd, bedeutete ihr mit vorgeschobenen Lippen an, dass sie aufsteigen sollte, und reichte ihr das Baby. Dann drehte er sich zu Schwarzer-Rabe um. „Es ist zu kalt für die Frau und das Kleine. Gib mir die Decke!“
Die Augen von Schwarzer-Rabe wurden groß. Sie war doch nur eine Psa, eine Gefangene! Trotzdem gab er Tschetan die schöne Decke und sah erstaunt, wie sein Freund die Frau sorgsam darin einwickelte. Er wechselte einen vielsagenden Blick mit Viele-Feinde und machte mit seiner Faust eine kreisende Bewegung an der Stirn. Tschetan war völlig „withko“ – verrückt, eine Frau mit einem Baby im Winter zu rauben. „Tschetan-withko!“, murmelte er frech.
Tschetan dagegen hatte es satt! Seine Freunde nahmen ihn nicht ernst und er wollte dem ein Ende bereiten. „Wir müssen hier weg! Die Psa werden uns sicher verfolgen, wenn sie sich von dem Schreck erholt haben. Kommt jetzt!“ Er nahm sein Pferd mit der Gefangenen am Zügel, sprang auf eines der erbeuteten Crowpferde von Schwarzer-Rabe, ohne seinen Freund auch nur zu fragen, ob es ihm recht war, und setzte sich in Bewegung. Das Crowpony tänzelte nervös, als ein fremder Reiter auf seinem Rücken saß, doch Tschetan zwang das Tier mit harter Hand vorwärts. Schwarzer-Rabe wollte sich schon darüber beschweren, dass es eigentlich seine Beute war, mit der Tschetan gerade davonritt, doch er sah ein, dass sie so wesentlich schneller vorankamen. Die Frau war sichtlich erschöpft und würde sie nur aufhalten, wenn Tschetan sie zu Fuß gehen ließ. Also sprang er wortlos auf sein Pferd und folgte Tschetan, das andere geraubte Pferd am Zügel hinter sich herziehend.
Frierend tauchte Wah-bo-sehns unter die schwere Decke und schmiegte ihre Schenkel an den warmen Bauch des Ponys. Sie hatte das Gefühl, nie wieder warm zu werden. Dankbar schlug sie das Kind in eine Falte des Umhangs, sodass es in der weichen Fellseite völlig verschwand. Unter ihren langen Wimpern sah sie sich nach einer Möglichkeit zur Flucht um, aber die Zügel ihres Pferdes lagen fest in der Hand ihres Entführers. „Oh, Ah-badt-dadt-deah, welches Schicksal hast du mir zugedacht?“, flüsterte sie leise. „Bitte, hilf mir und meiner Tochter!“
Die Lakota ritten in einer Reihe hintereinander her, die gefangene Frau zwischen sich, und sie dankten Wakan-tanka, dass es zu schneien begonnen hatte. Sie waren nur eine kleine Gruppe, die ausgezogen war, um Pferde zu stehlen und die Langeweile des Winters zu vertreiben. Bei dem Schneesturm würden die Crow ihre Spuren nicht finden und sie brauchten ihre Rache nicht zu fürchten. Bisher war von irgendwelchen Verfolgern nichts zu sehen gewesen. Die gefürchteten Späher der Crow in ihren Wolfspelzen schienen ihre Spur verloren zu haben. Entspannt saßen die Lakota auf ihren Pferden, freuten sich über den gelungenen Raubzug und lachten übermütig, als die Schneeflocken in ihre Gesichter wehten. Waziya, der tobende Riese im Norden, schickte ihnen seinen kalten Atem und meinte es gut mit ihnen. Nach einer Weile glitten sie von den Pferden und rieben sich mit Schnee die Farbe aus den Gesichtern. Sie lachten wie kleine Jungen und prahlten voreinander mit ihren Heldentaten. „Sieh nur die Pferde, die ich erbeutet habe! Schade, dass du keinen Büffelläufer erwischt hast!“, lästerte Schwarzer-Rabe ein wenig über Tschetan.
„Ich habe genügend gute Pferde, aber keine Frau, seit Steht-Groß mich verlassen hat. Also ist es ein guter Raubzug für mich“, erklärte Tschetan ruhig und überging die Stichelei.
Viele-Feinde verzog die Lippen. „Frauen gibt es genug, aber Pferde, gute Pferde, die sind etwas wert! Diese Frau wird dir höchstens davonlaufen, dann hast du nichts!“
„Ich habe genug! Und ich habe genug von eurem Weibergewäsch! Diese Frau gehört nun mir und ich werde zu verhindern wissen, dass sie mir wieder davonläuft! Waschté-yelo!“ Verärgert drehte er sich zu der Frau um und überlegte, ob sie all diese Sticheleien wert war. Sanfte, verängstigte Augen musterten ihn, ansonsten war unter dem warmen Büffelfell nicht mehr viel von der Frau zu sehen. Nun, zumindest würde sie seinen Lenden Freude bereiten und ein flüchtiges Lächeln huschte bei diesem Gedanken über sein Gesicht.
Wah-bo-sehns schluckte schwer. Zum ersten Mal konnte sie das unbemalte Gesicht ihres Entführers sehen, verstohlen beobachtete sie ihn und versuchte, ihn einzuschätzen. Er hatte eine leicht gebogene Nase und ein kräftiges, energisches Kinn. Seine schwarzen Haare waren in feste Zöpfe geflochten, die er mit Otterfellstreifen umwickelt hatte. Feine Strähnen, eigentlich nur einzelne Haare hatten sich im Kampf gelöst und schimmerten silbern, entweder von dem Fett, das er sich in die Haare geschmiert hatte oder als erstes Grau. Er schien etwas älter als seine beiden Freunde zu sein, vielleicht zählte er zehnmal drei und fünf Winter, außerdem war er größer und kräftiger. Seine Kleidung war sorgfältig genäht, aber ohne Verzierung. Nur eine schön bestickte Messerscheide hing an seinem Gürtel und auf dem Rücken trug er einen Köcher aus Pumafell, Beutestück eines unvorsichtigen Crowkriegers, wie sie unschwer erkannte. Sein Kriegsschild war mit dem Kopf eines Wolfes bemalt, der eindrucksvoll die Zähne bleckte. Lange Fransen säumten seine Leggins, nicht genäht, sondern nur an den Fransen zusammengeknüpft, die er an seinem Gürtel befestigt hatte. Sein Lendenschurz war aus blauem Tuch und reichte ihm bis an die Knie.
Die Kleidung der anderen war ebenso zweckmäßig gehalten, schmucklos und einfach für einen Raubzug.
Nach einer guten Weile legten die Männer eine kurze Rast ein und Tschetan half der Frau vom Pferd. Kurz wagte es Wah-bo-sehns, in sein ungeschminktes Gesicht zu blicken. Es war keine Fratze mehr, sondern ruhige, fast freundliche Augen schauten sie prüfend an. Das Baby quengelte und sie setzte sich auf einen Baumstamm, um es zu stillen. Sie hoffte, dass sie lange genug blieben, bis es satt wäre. Sorgsam wickelte sie die Bisonrobe um ihre Schultern, um sich vor den Blicken der Männer zu schützen. Ungeniert schauten die Lakota zu ihr hinüber und sie senkte verlegen die Augen. Oh! Sie hasste die Hilflosigkeit, mit der sie ihnen ausgeliefert war und langsam dämmerte ihr, welches Schicksal ihr blühte. Sie war eine Gefangene, ohne Rechte und Schutz.
Zwei der Männer traten mit einem anzüglichen Grinsen heran und beleidigten sie mit obszönen Gesten. Diese Männer machten sich einen Spaß daraus, die gefangene Frau ein wenig zu demütigen und Wah-bo-sehns wurde vor Entsetzen schlecht. Unsicher schielte sie auf ihren Entführer und hoffte, dass er sie vor den anderen schützte. Er schien ihre Not zu spüren und mahnte mit einem Kopfnicken zum Aufbruch, dann half er seiner Gefangenen wieder auf das Pferd. Fieberhaft suchte Wah-bo-sehns nach einer Möglichkeit zur Flucht. Hektisch prägte sie sich die Landschaftsmerkmale ein, achtete auf ungewöhnliche Felsformationen oder die geschwungenen Hügelketten in der Ferne. Unablässig horchte sie, ob jemand zu ihrer Rettung kam, ihre Augen ständig in Bewegung. Aber es herrschte die Stille des Winters, alles lag im Tiefschlaf, nur der gleichmäßige Schritt der Ponys und hin und wieder eine geflüsterte Anweisung der fremden Männer war zu hören.
Im Schatten der Bäume vernahm sie plötzlich eine Bewegung, ein Rudel Wölfe, das völlig lautlos neben ihnen herlief. Ihr grauer Pelz unterschied sich kaum von den Grautönen der Umgebung, manchmal verharrten sie zwischen den erstarrten Zweigen der Büsche und starrten geduckt zu ihnen hinüber, als warteten sie bereits auf das Aas ihres Körpers. Hilfe suchend wandte sie sich an den Rudelführer: „Bruder Wolf! Hilf mir!“
„Warum sollte ich dir helfen? Du bist doch inmitten deines Rudels, beschützt von drei Männern!“
Wispernd beugte sie sich zu ihm: „Das ist nicht mein Rudel! Sie werden mich töten und mein Junges auch! Bitte gehe zu den Wolfsspähern meines Stammes und leite sie hierher!“
Hechelnd starrte der Wolf sie an, sah so aus, als lachte er. „Du hast nun ein neues Rudel! Sie werden dich beschützen!“
„Aber meine Tochter“, bat sie leise.
„Du wirst neue Junge haben. Die Späher deines Volkes haben zu viele unserer Pelze geholt. Ich kehre nicht zurück, denn dann verliere ich mein Fell. Sorge für dich selbst! Du bist ein Weibchen. Sie werden dir nichts tun. Wenn dein Junges stirbt, wird es meine Jungen ernähren!“ Hochmütig, mit steifer Rute verschwand der Wolf im Halbschatten, folgte im lockeren Trab seinem Rudel.
„Nein!“, stöhnte sie auf und drückte das Kind fester an sich. Ein Schlag mit der Peitsche traf sie am Kopf und Wah-bo-sehns zuckte sichtlich zusammen.
Schwarzer-Rabe hatte den Ausruf gehört und fauchte die Gefangene unwirsch an. „Inila-yanka-yo!“
„Tokah-ho?“, fragte Tschetan ungehalten.
„Sie hat mit den Wölfen geredet!“ Schwarzer-Rabe deutete mit der Peitsche auf die Frau.
Verblüfft schaute Tschetan dem Leitwolf hinterher, der sich ohne Eile entfernte. Dann fiel sein Blick auf die Crowfrau, blieb nachdenklich auf ihr haften. Wurde auch sie von den Wölfen beschützt, so wie er? „Warum schlägst du dann nach ihr?“, tadelte Tschetan seinen Freund.
Achselzuckend schaute Schwarzer-Rabe ihn an. „Sie ist doch nur eine Gefangene!“
Kopfschüttelnd wandte sich Tschetan ab und zog mit einem Ruck das Pony mit der Frau hinter sich her. Ihm gefiel das Verhalten seiner Freunde nicht und er wusste, dass er es beenden musste.
Kurz fiel sein Blick auf die Frau, die sich zitternd vor Angst und Kälte unter das Fell geduckt hatte. Mit kräftiger Hand zog er das Pony hinter sich her. Noch war keine Zeit für Erbarmen oder freundliche Worte
Nach einer Weile erreichten die Männer einen kleinen Bach, der wegen seiner schnellen Strömung noch nicht ganz zugefroren war. Murmelnd floss er über glitzerndes Gestein, das einzig Lebendige in dieser Wüste aus Schnee. Dann durchbrach der heisere Schrei eines Geiers die unnatürliche Stille und mit plötzlichem Entsetzen blickte Wah-bo-sehns nach oben. Würden die Geier ihren Leichnam zerfleddern, wenn dieser Mann sie doch tötete? Furchtsam blickte sie auf den kräftigen Krieger und überlegte, was er wohl mit ihr vorhätte. Achtlos ließ der Krieger die Zügel fallen, dann stiegen die Männer ab, ließen die Pferde trinken und erfrischten sich ebenfalls. Die Fransen ihrer Leggins zeichneten lustige Muster in den Schnee, als sie sich wieder gemächlich der Frau näherten. Ehe sie auf dem Pony fliehen konnte, hatte Tschetan den Zügel ergriffen und schüttelte warnend den Kopf. Seine Hände streckten sich ihr fordernd entgegen und mit seinen Lippen deutete er an, dass sie ihm das Kind geben sollte. Verlegen, weil er ihre Absicht durchschaut hatte, gab sie ihm das Baby und glitt vom Pferd, um ebenfalls zu trinken. Sie nutzte die Gelegenheit sich ein wenig zu waschen und die zerzausten Haare glatt zu streichen.
Leises Knirschen im Schnee war zu hören und erwartungsvoll drehte sie sich um. Vielleicht kamen ja doch einige Absarokee, um sie zu befreien? Nein! Es waren drei weitere Lakota, die triumphierend aus dem dunklen Wald hervorbrachen, offensichtlich mit Beute beladen. Es waren also doch mehr Krieger gewesen, die ihr Dorf überfallen und sich in Gruppen aufgeteilt hatten, um ihren Rückzug zu sichern. Unsicher stand Wah-bo-sehns in der Gruppe von sechs feindlichen Kriegern, die unverhohlen die Beute unter sich aufteilten und offenbar auch über sie sprachen.
Einer der Krieger packte sie und drehte sie abschätzend hin und her, wie ein Pferd, das er eintauschen wollte. Er war etwas älter als ihr Entführer und seine sonst eher gutmütigen Züge wurden hart, als das Begehren in seinen Augen aufblitzte. „Sie ist jung und hübsch! Tauschen wir?“
Deutliche Zeichen untermalten das Gespräch, sodass auch Wah-bo-sehns verstand, was gesprochen wurde. Sie wäre vor Scham am liebsten im Boden versunken.
Ihr Entführer schüttelte entrüstet den Kopf. „Hiya“, – nein, betonte er und hielt Wah-bo-sehns am Arm fest. „Sie gehört mir!“
Der andere Mann lachte abfällig. „Sie ist doch nur eine Gefangene. Sie wäre eine Hilfe für meine Frau. Ich gebe dir zwei gute Pferde für sie!“
Wah-bo-sehns senkte die Augen und wollte nichts mehr hören oder sehen. Die Gesten waren beleidigend und demütigend und zeigten ihr, dass es hier keinen Schutz mehr gab. Allein ihr Entführer entschied, was er mit ihr zu tun gedachte.
Tschetan aber senkte ebenfalls die Augen und schluckte schwer. Er wollte diese Demütigung nicht und so überlegte er scharf, was er tun sollte. Grauadler war sein Freund. Wie sollte er diese Bitte ablehnen ohne Grauadler zu beleidigen? Die Gefühle gingen mit ihm durch, als er nach einer Lösung suchte. Sein Blick fiel auf die verschreckte Frau, dann spürte er das Gewicht des Kindes in seinem Arm. Nein! Er wollte sie nicht mehr hergeben. Weder die Frau noch das Kind. Es fiel ihm nicht schwer, den letzten Schritt zu gehen, er hatte die Entscheidung längst getroffen, als er die Frau gezwungen hatte, mit ihm zu gehen. „Hiya! Ich nehme sie zu meiner Ehefrau“, erklärte er mit fester Stimme.
Grauadler schaute ihn mit großen Augen an. „Hohch! Du willst eine Psa zu deiner Frau machen!?“ Er verwendete mit Absicht das Wort „Psa“, wie die Lakota die Absarokee beschimpften, weil er Tschetan die Unsinnigkeit seines Handelns zeigen wollte. Warum hielt er die Frau nicht einfach als Gefangene, wenn er sie in seinem Zelt wollte?
Tschetan hörte die Beleidigung und seine Stimme wurde eisig: „Ja!“
Viele-Feinde und Schwarzer-Rabe wechselten verstohlene Blicke. Sie hatten ein ähnliches Verhalten vorher schon erlebt und genossen es, wie ihr Freund offensichtlich in die Enge getrieben wurde.
Grauadler zuckte mit den Schultern, aber schließlich war es Tschetans Entscheidung, was er mit der Frau tun wollte. Trotzdem stichelte er weiter: „Woher willst du wissen, dass sie eine gute Frau ist? Vielleicht ist sie zänkisch und faul? Und woher willst du wissen, dass sie dich zum Mann will und dir nicht davonläuft?“
„Nun, das werden wir ja sehen!“ Tschetans Augen schossen Blitze, nur mühsam hielt er sich zurück, erkannte, dass er sich in den Augen der anderen wirklich seltsam benahm. Trotzdem! Diese Gefangene gehörte ihm und er würde ihnen nun beweisen, dass ihm keine Frau mehr weglaufen würde. Kurz entschlossen drückte er Schwarzer-Rabe das schlafende Kind in die Hand. „Pass darauf auf“, flüsterte er drohend.
Erst jetzt sah Grauadler das Baby und seine Augen wurden rund. Soviel Aufregung um eine Frau, die einen Säugling hatte! Tschetan musste völlig verrückt sein. Die Frau stöhnte leise auf, als sie auf den jungen Mann blickte, der nachlässig ihr Kind hielt. Seine strähnigen Haare umrahmten ein rundes Gesicht, das mit abweisenden Augen das Baby musterte, blankes Unverständnis in seinem Blick.
Herausfordernd blickte Tschetan auf seine Freunde. „Ich mache diese Crow zu meiner Frau. Hier und jetzt!“
Dann packte er die Gefangene, die vor Angst ganz steif wurde, und zog sie einige Schritte weiter.
Wah-bo-sehns verstand kein Wort. Verzweifelt blickte sie auf den jungen Krieger, der ihre Tochter hielt, dann auf den Mann, der grob ihr Handgelenk umfasst hatte. Wollten diese Feinde jetzt ihr Baby töten? Panik stieg in ihr hoch, eine entsetzliche Angst, dass diese Männer ihr das Letzte nahmen, was sie noch an Micgy erinnerte. Mit ihren Fäusten schlug sie auf ihren Entführer ein, versuchte vergeblich, sich aus dem festen Griff zu winden. „Hiya! Hiya!“, schrie sie das erste Wort, das sie in dieser fremden Sprache aufgeschnappt hatte. „Gib mir mein Kind!“ Ihre Stimme wurde hysterisch vor Angst.
„Ayuschtan-yo!“ – Hör auf, brüllte Tschetan die Frau an, verwundert über ihren heftigen Widerstand und die Kraft, die sie plötzlich entwickelte. Brutal hielt er ihre Handgelenke fest und der Schmerz ließ Wah-bo-sehns in den Schnee sinken. Entsetzt starrte sie ihn an, ihre haselnussbraunen Augen fraßen sich in den seinen fest, baten um Mitleid.
Tschetan trafen diese traurigen Augen bis ins Mark, Augen ohne jede Hoffnung, die nur noch den Tod erwarteten. Er wollte es beenden! Energisch hockte er sich vor sie hin und suchte ihre Aufmerksamkeit. „Waschté, waschté“, sprach er mit dunkler Stimme auf sie ein, ähnlich wie er ein wildes Pferd beruhigen würde. „Waschté!“
„Hör zu!“, zeigten seine Hände. „Hör zu!“ Und schließlich: „Keine Angst!“
Ihr gehetzter Blick suchte das Baby, aber der junge Krieger stand einfach nur bei den anderen Männern und hielt es mit ausdrucksloser Miene im Arm. Was würde jetzt geschehen? Der Griff ihres Entführers lockerte sich etwas und sie saß still vor ihm, wartete apathisch ab, was er von ihr wollte.
Versuchsweise ließ Tschetan eine Hand los, doch die Frau wehrte sich nicht mehr. Er biss sich auf die Lippen, wollte nicht mehr, dass sie Angst hatte. Nie mehr! Plötzlich amüsierte ihn die ganze Situation. Er heiratete soeben eine Feindfrau! Ruhig blickte er auf die zierliche Frau mit den warmen Augen und stellte fest, dass sie ihm tatsächlich gefiel. Mit deutlichen Gesten fragte er: „Du-gehen-in-mein-Zelt-als-meine-Frau?“
Wie durch einen Nebel drangen die Zeichen zu Wah-bo-sehns. Dieser Feind wollte sie zu seiner Frau machen? Nicht töten! Ihr schwindelte bei diesen Worten, dann traf sie die Bedeutung seiner Worte mit voller Wucht. Sie wollte keinen Mann! Sie wollte nicht in sein Dorf! Micgy! Micgy war ihr Mann und die Erinnerung an ihn schmerzte so sehr. Oh Ah-badt-dadt-deah! Wie konnte er so etwas zulassen? Ungläubig blickte sie in die ruhigen Augen ihres Entführers, der die Zeichen so beiläufig wiederholte, als würde er fragen, ob sie hungrig wäre.
„Du-gehen-in-mein-Zelt-als-meine-Frau?“
Wäre ihre Tochter dann in Sicherheit? Würden die anderen Männer sie in Ruhe lassen? Sie hatte Angst davor, der Spielball für ihre Wünsche zu werden, wenn sie erst ihr Nachtlager aufschlugen. Dieser Mann, der vor ihr kniete und geduldig auf ihre Antwort wartete, versprach Schutz. Ihre Gedanken flogen, als sie wieder Hoffnung schöpfte. Unsicher wanderte ihr Blick zu den anderen Kriegern, die abwartend in der Nähe standen, sichtlich überrascht über das, was dieser Mann hier tat. Dieser Feind wollte sie als Ehefrau in sein Zelt führen, nicht als Gefangene. Mehr konnte sie unter diesen Umständen wahrlich nicht erwarten. „Mein-Baby?“, wagte sie zu fragen.
„Baby-leben-bei-dir!“, versicherte er großmütig. Fordernd wartete er auf ihre Antwort, und kurz überlegte Wah-bo-sehns, was mit ihr geschehe, wenn sie sich weigerte. Würde er sie dann diesem älteren Mann geben? Oder einem der anderen Männer, die vielleicht nicht so viel Geduld hätten? Es schüttelte sie bei diesem Gedanken, gleichzeitig dachte sie wieder an seine kalte Hand, die unter ihr Kleid geschlüpft war. Nun sollte sie seine Frau werden, damit er endgültig das tun konnte, was er vorher schon angedeutet hatte. Sie wusste, dass sie dazu noch nicht bereit war, selbst unter anderen Umständen nicht, aber sie hatte keine Wahl. Auch bei den Crow hätte sie bald wieder geheiratet, schon allein, damit das Kind versorgt war. Nun schützte sie ihre Tochter eben, indem sie die Ehefrau dieses Kriegers wurde. Letztendlich war es gleichgültig, wen sie heiratete. Ihr Herz würde nie wieder Liebe empfinden. Es gehörte allein Micgy! Mühsam schluckte sie die Tränen hinunter, weil sie diesen Feind nicht verärgern wollte. Ihr beider Überleben hing allein von der Laune dieses Kriegers ab, wahrscheinlich hätten die anderen sie längst getötet und kein Mitleid gehabt, als sie in den Wald geflüchtet war. So war eben das Leben. Vielleicht gab es später eine Möglichkeit, dieser Situation zu entfliehen.
„Deine-Frau-ich-sein“, willigte sie ein, hoffte auf seinen Großmut und Schutz. In diesem Moment wollte sie nur noch ihre Tochter unversehrt in die Arme nehmen.
Ein triumphierendes Lächeln huschte über das Gesicht des Mannes. Fürsorglich half er ihr hoch und wickelte sie wieder in die Decke. Dann führte er sie zu den anderen zurück und der junge Krieger übergab ihr mit einem freundlichen Lächeln das Kind. Zu ihrer Überraschung hatte er es in eine weitere graue Decke gehüllt, um es vor der beißenden Kälte zu schützen. Mit klopfendem Herzen drückte Wah-bo-sehns ihre Tochter an sich und sank schwach vor Erleichterung auf die Knie. Sie wollte dem Mann die Decke zurückgeben, doch der winkte großzügig ab, schließlich war sie jetzt die Ehefrau seines Freundes.
Grauadler, Viele-Feinde und die anderen klopften Tschetan anerkennend auf die Schultern. „Ho! Die Psa müssen gut auf ihre Frauen aufpassen, wenn du in der Nähe bist.“ Es war eine Stichelei gegen ihren Freund, nicht mehr gegen die Frau. Andererseits wunderten sie sich, warum ihm diese Frau so wichtig war? Wie hatte sie es in so kurzer Zeit geschafft, sein Herz zu gewinnen?
Grauadler war ein wenig betreten, denn er hatte nicht erkannt, wie ernst es Tschetan mit dieser Frau gewesen war. Mit schiefem Kopf musterte er sie und überlegte, was wohl an ihr wäre, das Tschetan so gefiel. Gut, sie war jung und hübsch, trotz der deutlichen Zeichen der Trauer, die sie trug. Ihre Haare umrahmten ihr ovales Gesicht und sie hatte die sanften Augen eines Hirschkalbs. Kein Wunder, dass Tschetan sie nicht getötet hatte. Dann war da noch das Kind, es war klein und musste noch lange gestillt werden, war also eher eine Belastung für Tschetan. Er wollte es genau wissen. „Was machst du mit dem Kind, wenn wir im Lager sind?“
„Nichts!“ Tschetan zuckte mit den Schultern.
„Du wirst es behalten?“
„Ja!“
Grauadler grinste wie ein Luchs. „Wenn die Psa nun deine Frau ist, wird dann ihr Kind auch dein Kind?“
„Ja …!“ Es war ein lang gezogenes Ja, das Tschetan sich, während er es aussprach, selbst erst überlegen musste.
„Du wirst also sein Vater?“, stichelte Grauadler weiter.
Tschetan biss sich auf die Lippen. Vater? Welch seltsamer Ausdruck!
Eigentlich hatte er der Frau das Baby nur gelassen, damit sie freiwillig mit ihm ging. Kurz fühlte er das Bedauern, dass seine anderen Frauen ihm noch keine Kinder geschenkt hatten. Aber jetzt gehörte dieses winzige Ding ihm, ebenso wie die Frau. Abgesehen davon, dass er der letzte Mensch wäre, der einer Mutter das Kind aus den Armen riss. Dabei übersah er geflissentlich, dass er genau dies bereits getan hatte und durchaus das Risiko eingegangen war, es zu töten. Er konnte selbst nicht sagen, was ihn verändert hatte, aber jetzt waren seine Gefühle klar, vielleicht hatte der ganze Raubzug nur diesen einen Zweck gehabt: die Leere in seinem Herzen zu füllen. „Ja, ich werde sein Vater“, erklärte er entschlossen. „Ich werde darum bitten, dass ich es zu meiner Verwandten machen darf.“
Grauadler stutzte. „Ist es ein Junge oder ein Mädchen?“
Tschetan wusste es nicht. Wieder zuckte er mit den Schultern und sah unverhohlenes Gelächter in den Augen seiner Freunde. Ohne Hemmungen prusteten sie los, amüsierten sich köstlich, ihn aus der Reserve gelockt zu haben. Tschetan wusste nicht einmal, ob er ein Mädchen oder einen Jungen adoptierte! In diesem ungezwungenen Augenblick löste das Lachen seiner Freunde seine Anspannung. In ihren Augen musste er wirklich völlig verrückt sein. „Tschetan-withko“ würden sie ihn in Zukunft nennen, und zu Recht!
Er drehte sich zu seiner neuen Frau um und machte eine fragende Geste nach dem Geschlecht des Babys, freute sich wie ein Vater auf die Antwort, wenn seine Frau ihm das erste Mal das Neugeborene zeigte.
Wah-bo-sehns verstand nicht, warum plötzlich alle lachten und zögerte verunsichert. Tschetan wiederholte die Geste, diesmal mit einem auffordernden Lächeln, das zeigen sollte, dass ihm eigentlich jede Antwort recht wäre.
Zaghaft deutete sie einen Zopf an, das Zeichen für „Mädchen“. Tschetan nickte erfreut und fragte interessiert nach dem Namen. Eine Tochter! Er fühlte sich wie ein Vater und sein Herz klopfte, als wäre er tatsächlich gerade Vater einer Tochter geworden.
Sie dagegen schüttelte betreten den Kopf, denn ihr Baby hatte doch noch keinen Namen.
Tschetan war sichtlich überrascht, aber vielleicht hatte es mit dem Tod ihres Mannes zu tun, dass dieses Kind noch keinen Namen hatte? Es war auf jeden Fall nicht richtig. Jedes Kind brauchte einen Namen! Er schaute auf das winzige Mädchen in ihren Armen, eingewickelt in eine graue Decke, aus der nur die großen braunen Augen hervorlugten. Sie erinnerte ihn an eine kleine graue Eule und er musste lachen. Er würde sie Hihan-Hota-win, Graueulenmädchen, nennen. Er sagte den Namen mehrmals deutlich und zeigte dabei auf das Kind. „Hihan-Hota-win!“ Wohlwollend blickte er auf seine neue Frau, deutete ihren traurigen Blick immer noch als Angst vor der neuen Situation. „In meinem Dorf bist du sicher und in meinem Tipi ist es warm!“, versuchte er sie zu beruhigen.