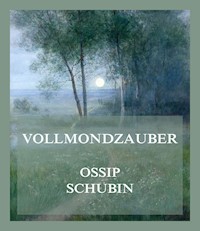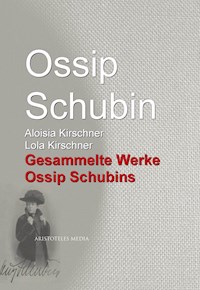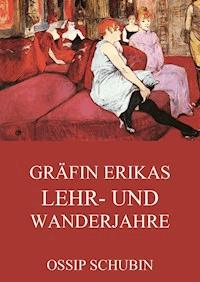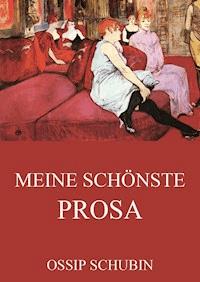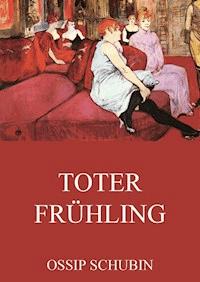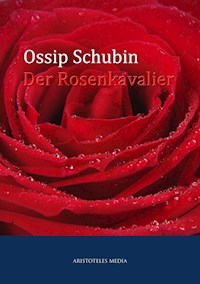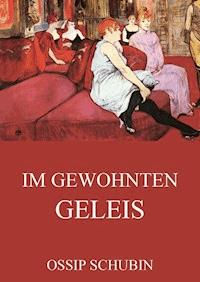
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein politischer Roman aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts.
Das E-Book Im gewohnten Geleis wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im gewohnten Geleis
Ossip Schubin
Inhalt:
Ossip Schubin – Biografie und Bibliografie
Im gewohnten Geleis
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Im gewohnten Geleis, O. Schubin
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849635817
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Ossip Schubin – Biografie und Bibliografie
Eigentlich Aloysia (Lola) Kirschner, bekannte Romanschriftstellerin, geb. 17. Juni 1854 in Prag, verstorben am 10. Februar 1934 auf Schloß Kosatek im heutigen Tschechien. Verlebte ihre erste Jugend auf einem Gut ihrer Eltern (Lochkow) und brachte später verschiedene Winter in Brüssel, Paris und Rom zu; jetzt lebt sie auf Schloß Bonrepos bei Lissa in Böhmen. Sie veröffentlichte unter dem erwähnten Pseudonym, das sie einem Roman Turgenjews (»Helena«) entnommen hat, eine lange Reihe von Romanen und Novellen, die meist in wiederholten Auflagen erschienen sind. Wir nennen davon: »Ehre« (Dresd. 1882, 10. Aufl. 1902); »Mal' occhio und andre Novellen« (Berl. 1884); »Bravo rechts! Eine lustige Sommergeschichte« (Jena 1885); die Novelle »Ein Frühlingstraum« (Augsb. 1884); »Die Geschichte eines Genies. Die Galbrizzi« (Berl. 1884); »Unter uns« (das. 1884, 2 Bde.); »Gloria victis« (das. 1885, 3 Bde.); »Erinnerungen eines alten Österreichers«, drei Erzählungen (Jena 1886); »Erlachhof« (Stuttg. 1887, 2 Bde.); »Etiquette«, eine Rokoko-Arabeske (Berl. 1889); »Dolorata« (das. 1888); »Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht« (das. 1888); »Asbein, aus dem Leben eines Virtuosen« (Braunschw. 1888), dessen Fortsetzung: »Boris Lensky« (Berl. 1889, 3 Bde.; 3. Aufl. 1897), das bedeutendste Werk der Dichterin; »Unheimliche Geschichten« (Dresd. 1889); »Bludička«, Erzählung aus dem slawischen Volksleben (Braunschw. 1890); »O du mein Österreich!« (Stuttg. 1890, 3 Bde.); »Heil Dir im Siegerkranz!« (Braunschweig 1891); »Gräfin Erikas Lehr- und Wanderjahre« (das. 1892, 3 Bde.); »Thorschlußpanik« (Dresd. 1892); »Ein müdes Herz« (Stuttg. 1892); »Finis Poloniae«, Roman (Dresd. 1893); »Toter Frühling« (Braunschw. 1893, 2 Bde.); »Woher tönt dieser Mißklang durch die Welt« (das. 1894, 3 Bde.); »Gebrochene Flügel« (Stuttg. 1894); »Maximum«, Roman aus Monte Carlo (das. 1896); »Die Heimkehr« (das. 1897); »Con fiocchi« (Dresd. 1897); »Vollmondzauber« (Stuttg. 1899); »Peterl«, eine Hundegeschichte (Berl. 1900, 10. Aufl. 1902); »Slawische Liebe« (Braunschw. 1900); »Im gewohnten Gleis« (Stuttg. 1901); »Marška« (das. 1902); »Refugium peccatorum« (Berl. 1903). Diese hastige Produktion der begabten Dichterin hat natürlich einen ungleichen Wert der Werke zur Folge gehabt. Ihre ersten Schriften sind besser als die spätern, und dort zeichnet sich Ossip Schubin durch eine ungewöhnliche Schärfe der Beobachtung, tiefe, oft sarkastische Charakteristik der künstlerischen Bohême und der internationalen Salongesellschaft, die sie mit Vorliebe schildert, und ungewöhnliche Kraft in der Stimmungspoesie aus. Ihre besondere Stärke zeigt sich in der Schilderung der österreichischen Militär- und Adelskreise.
Im gewohnten Geleis
Motto:On rencontre parfois dans la vie des passants brillants, qui n'arrivent jamais!
Erstes Kapitel.
Er war entschieden die Hoffnung der konservativen Partei in seinem Vaterland.
Seit Menschengedenken war dem böhmischen Adel nichts so Geniales entsprossen.
Von seinem ersten Hofmeister an, der ihm noch in der Kinderschulstube das Alphabet und das Einmaleins beigebracht hatte, bis zu den Professoren, von denen er auf der Universität in die höheren Staatswissenschaften eingeweiht worden war, hatte er allen, welche sich mit seiner Belehrung befaßt hatten, die angenehmsten Ueberraschungen bereitet. Er hatte alle Klassen des Gymnasiums mit Auszeichnung absolviert, und promovierte schließlich im zweiundzwanzigsten Lebensjahre.
So etwas war noch nicht dagewesen. Er promovierte vor einem »Parterre von Königen«! Noch nie hatte ein junger Jurist in Prag auf eine so glänzende Gesellschaft heruntergeschaut, noch nie vor einem so aufmerksamen Auditorium die ihm zur Beleuchtung vorgelegten Streitfragen diskutiert oder feine Promotionsrede gehalten, wie Hans Graf Ronsky. Er sprach über die ethische Bedeutung der Staatsgesetze.
Er sprach mit Feuer, mit hinreißender Ueberzeugung – von der Förderung der Kultur durch das Hineintragen eines idealeren Elements in die Nüchternheit der Paragraphen. Seine Erscheinung gehörte zu den angenehmsten – und seine Stimme zu jenen, welchen man gern zuhört, selbst wenn sie Extravaganzen vorbringen.
Ja, man hörte diese Stimme nicht nur gern, sondern man glaubte ihr. Er hatte im höchsten Maß das, was die Franzosen l'accent juste nennen.
Seine Augen bestätigten alles, was seine Stimme sagte – er machte immer so treuherzige Augen, wenn er sprach. Man glaubte ihm, weil er sich offenbar selber glaubte – und wenn er die Abenteuer des Herrn von Münchhausen erzählt hätte, so hätte man ihm auch noch geglaubt.
Seine Rede dauerte länger, als es bei solchen Gelegenheiten üblich ist, aber nicht länger als die Aufmerksamkeit oder vielleicht als die Geduld seines Publikums. Eine elektrische Strömung von bis zur Begeisterung gesteigertem guten Willen durchzog seine Beredsamkeit.
Ob das, was er vorbrachte, von irgend einer praktischen Durchführbarkeit war, darüber dachte keiner nach. Aber es war so edel gefühlt, so schön entworfen – es hatte niemand das Herz gehabt, Hans eine ernüchternde Einwendung zu machen. Die einzige Protestation, welche gegen diesen lang hinziehenden Redestrom erfolgte, waren die hörbaren Atemzüge eines älteren Herrn, der darüber eingeschlafen war. Der größte Teil des Publikums ahnte nichts von dieser Episode, welche sich übrigens nur als vorübergehend erwies, da die Nachbarn des schlafseligen Sünders ihn beide unmutig mit Empörung und Rippenstößen in eine wache Verfassung zurückriefen.
Und als der junge Jurist schließlich mit den Worten endigte: »Das Gesetz soll nicht nur wie ein Polizeimann in pflichtschuldiger Wachsamkeit unsere materiellen Güter und Rechte schützen – nein, es soll auch wie der Engel mit dem feurigen Schwert in begeisterter Kampfbereitschaft vor dem Paradies unserer idealen Errungenschaften und Forderungen stehen!«... da hatte der Enthusiasmus gar keine Grenzen und fast kein Ende.
Der Vater des Promoventen, welcher als ein gutmütiger, durch und durch konservativer Landedelmann im ganzen gegen alle Weisheit als sittenverderblich heftig eingenommen war, verschlang die Weisheit seines Sohnes um so gieriger mit dem Herzen, je eigensinniger sich sein Verstand dagegen wehrte, sie zu begreifen. Er vergoß Thränen – seine breiten Schultern zuckten vor Rührung. Die drei Hofmeister des Jüngers höheres Staatsweisheit, welche sich in einer der hintersten Reihen der Versammelten zusammengesetzt hatten, vergossen ebenfalls Thränen, und obgleich sie ihr ganzes Leben lang in bitterer Feindschaft verhadert hatten, zerquetschten sie sich jetzt beinahe die Hände vor gemeinschaftlicher Begeisterung.
Der alte Leibjäger des Grafen Ronsky weinte wie ein Kind, obwohl er – ein Stockböhme – nicht ein Wort von der langen, in deutscher Sprache gehaltenen Rede des Herrn Grafen Hans verstanden hatte... und gar die Damen ...!
Als der junge Doktor nach seiner glänzenden Dissertation in die Reihen seiner Angehörigen trat, da gab's ein Beglückwünschen, Händeschütteln, Umarmen ohne Ende. Plötzlich aus all den stürmischen Huldigungen heraus fühlte er eine, die intensiver als die anderen war – zwei zarte brennende Lippen auf seiner Hand. Er sah sich um, aber das Wesen, dem die Lippen gehörten, war bereits fortgehuscht – etwas wie eine Flammengarbe zuckte an seinen Augen vorbei – eine Fülle aufgelösten roten Haares, das einem etwa vierzehnjährigen Mädchen gehörte.
Unwillkürlich verfolgte er sie mit den Augen, bis er ihres Gesichtchens ansichtig wurde. Endlich sah er's – etwas Unfertiges, Stumpfnasiges, Blasses, Sommersprossiges, das dunkelrot wurde, als er es mit seinem neugierigen und freundlich belustigten Blick ansah.
»Wer ist das?« fragte ihn ein älterer Herr, einer seiner ihn beglückwünschenden Vettern, indem er die fliehende Gestalt des vor Begeisterung und Verlegenheit glühenden jungen Mädchens eifrig musterte.
»Das? ... Die Tochter meines armen Bruders Konrad,« erwiderte Hans Ronsky. »Sie ist momentan bei meiner Schwester Leontin' zu Besuch.«
»Ah!« Graf Miroslaw – so hieß der alte Herr – setzte sein Monocle fester ein, der rothaarige Wildfang hatte offenbar erhöhtes Interesse für ihn erhalten, »Verspricht hübsch zu werden ... aber ein verteufeltes Temperament! ... Hm! ... Wie ist denn eigentlich die Mutter?«
Hans Ronsky zuckte die Achseln. »Ach, von der sprechen wir lieber nicht,« erwiderte er, »ich habe Konrad nie begriffen! Armer Konrad!« und dann ging man zu anderen Dingen über.
Graf Miroslaw dachte nicht mehr an die Tochter des armen Konrad; Hans Ronsky dachte eigentlich auch nicht mehr an sie – trotzdem fühlte er den ganzen übrigen Tag noch das Brennen der zarten, feurigen Mädchenlippen auf seiner Hand.
Nach der Promotion begab er sich mit seinem alten Vater – der Vater war ungewöhnlich alt für einen so jungen, und unglaublich beschränkt für einen so klugen Sohn – in das Ronskysche Palais. Dieses befand sich auf der sogenannten Kleinseite von Prag, dem eigentlichen Adelsviertel, in einer malerischen, steil bergansteigenden Straße, die sich bis an den Fuß des Hügels erstreckt, von dem aus die Kaiserburg auf ihre Umgebung herabsieht.
Das Palais, welches als besonderes Abzeichen zwei einander wütend anfauchende Löwen – jeden an einer Seite des mächtigen Thorbogens – aufwies, stand um diese Jahreszeit – man befand sich im Juli – fast immer leer, wie die meisten Paläste, die seine vornehme Umgebung ausmachten. Diesmal war aber in den meisten von ihnen ein Teil bewohnt – von Verwandten, die herbeigekommen waren, das neue Licht zu feiern.
Im Palais Ronsky wurde um sechs Uhr nachmittags ein großes Diner gegeben, zu dem außer den nächsten Angehörigen des jungen Doktors auch seine drei Hofmeister zugezogen wurden. Man brachte sehr viel Trinksprüche aus, und die ganze Gesellschaft sah Hans Ronsky bereits in einem historischen Licht.
Die ehemaligen Hofmeister hielten sich nicht so lange bei dieser Veranstaltung auf wie die anderen Gäste. Als sie, und zwar alle drei gleichzeitig, das Fest verließen, ergingen sie sich, noch ganz eingehüllt in den Duft der vorzüglichen Zigarren, welche sie auf die Straße mitgenommen hatten, in Vermutungen bezüglich der Zukunft des Grafen Hans Ronsky. Obwohl sie drei verschiedenen Nationalitäten angehörten, indem der eine ein Deutscher, der zweite ein Czeche, der dritte ein Ungar war, zeigten sie sich doch für diesmal ganz einig in ihren Ueberzeugungen, das heißt in ihrem festen Glauben an die hervorragenden Fähigkeiten Hans Ronskys. Sie bauten eine wahre Walhalla von einem Luftschloß, in welchem Ronsky noch bei Lebzeiten den obersten und untersten – den einzigen Heldenplatz einnehmen sollte.
»Endlich einmal ein Mensch unter den Aristokraten!« sagte der Deutsche, der natürlich ein Demokrat war, worauf der Ungar hinzufügte: »Und ein Genie dazu!« Der Czeche meinte: »Das wird ein Ministerpräsident!«
Und der Deutsche sagte: »Wenigstens ein Bismarck!«
Ueber dieses »wenigstens« konnte man schließlich doch nicht hinaus – darum schwiegen die gelehrten Männer eine Weile.
Erst als sie sich von dem Uebermaß der geäußerten Zuversicht etwas erholt hatten, bemerkte der Czeche: »So ein Kavalier hat doch etwas für sich.«
»Natürlich!« sagte der Ungar.
Der demokratische Deutsche meinte: »Aber Hans Ronsky ist auch etwas ganz Exceptionelles!«
So schritten sie gemeinsam über die alte Karlsbrücke – der Deutsche und der Czeche ihren verschiedenen Wohnungen zu, der Ungar dem Gasthof, wo er sein Nachtquartier bestellt hatte.
Die Zigarren dufteten, und unter den mit altertümlichen Standbildern besetzten Brückenbogen rauschte der Fluß, auf dessen schwarzer Flut sich zwischen dem Licht sehr vieler naher Laternen der Schimmer ferner Sterne wiegte.
In dunklen Umrissen ragte die Kaiserburg in den Nachthimmel empor.
»Etwas ganz Exceptionelles!« wiederholte der Deutsche.
Und der Czeche bemerkte: »Ich glaube, mit Ronsky wird eine neue politische Epoche anfangen in Oesterreich – die Epoche der Unparteilichkeit!«
»Verzeihen Sie,« entgegnete der Deutsche. »Unparteilichkeit ist Schwäche – große Politiker waren nie unparteiisch. Die Hauptsache ist, man muß wissen, was man will!«
»Nun,« meinte der Czeche nachdenklich – »man sollte doch allenfalls auch wissen, was die anderen wollen!«
»Ja, wissen darf man es, aber man darf sich nicht danach richten! Das verwirrt nur,« bemerkte der Ungar, worauf er fortfuhr: »Ich glaube, eine strenge Durchführung des dualistischen Systems ist das einzig Mögliche in Oesterreich – und auf die wird er halten. Ungarn muß als Bundesgenosse behandelt werden und nicht als Provinz. Räumt man ihm die genügenden Rechte ein, so wird Cisleithanien immer einen verläßlichen Freund an ihm finden. Das wird er einsehen. Seine Mutter war eine Ungarin – das Magyarische in ihm meldet sich bei jeder ernsten Gelegenheit!«
»Nun, ich muß hoffen, daß es sich nicht ganz so stark bei ihm melden wird wie bei Ihnen!« rief der czechische Hofmeister – »dann wäre er bald fertig. Sie irren sich sehr, wenn Sie glauben, daß wir uns Ihre Ansichten von der Sachlage gefallen lassen werden. Nein! nie! ... Ungarn, ein politisch reifes Land, als selbständig zu behandeln – und alle anderen Kronländer – Kronländer! – hören Sie, als unmündig in die politische Kinderstube zu stellen, das geht auf die Dauer denn doch nicht!«
»Es ist das einzig Mögliche!« dozierte der deutsche Hofmeister – »eine politische Kinderstube, die von der deutschen Intelligenz beherrscht und erzogen wird!«
»Ronsky wird anderer Ansicht sein,« behauptete der Czeche – »gleiches Recht für alle! wird er sagen. Sein Vater hat nie vergessen, daß er einem der ältesten böhmischen Geschlechter angehört – er hat sein Vaterland nie verleugnet, er hat immer für die czechische Sache gestimmt und sich Anno zweiundsiebzig für die böhmische Krone geopfert! Hans Ronsky wird nie vergessen, daß böhmisches Blut in seinen Adern fließt!«
»Er wird nie vergessen, daß er seine Bildung der deutschen Kultur dankt, daß er an einer deutschen Universität den Ritterschlag des Ritters vom Geist empfangen hat!« rief der Deutsche.
»Das war eben ein Fehler!« ereiferte sich der czechische Hofmeister. »Hätte er vielleicht an der czechischen Universität promovieren sollen?« fragte höhnisch der Deutsche.
»Er hätte an beiden promovieren sollen,« erklärte bedächtig der Czeche.
»Wäre das nicht doch eine etwas weitläufige und schwerfällige Prozedur gewesen?« fragte der Ungar von dem Gipfel seiner politischen Reife herab.
»Es wäre eine freundliche Aufmerksamkeit gewesen für sein Vaterland – für seine Nation!« ereiferte sich der Czeche. »Nun ich's recht überlege, begreife ich nicht, daß er's unterlassen hat. Er muß es vergessen haben!«
»Nein, er hat es nicht vergessen – er wollte nur der deutschen Intelligenz huldigen!« rief der deutsche Hofmeister. »Er ist durch und durch Zentralist, das kann ich euch beiden versichern – er wird mit den nationalen Prätensionen und Kindereien in ganz Oesterreich aufräumen – nicht nur mit den slavischen, sondern auch mit den ungarischen, die übrigens ihre größten Siege einer kleidsamen Magnatentracht verdanken! Ja, er wird Zentralist sein, es ist das einzig Vernünftige!«
»Er wird Föderalist sein, es ist das einzig Gerechte!" schrie der Czeche. »Er wird Dualist sein, es ist das einzig Durchführbare,« behauptete der Ungar.
Bis dahin hatten sie alle drei deutsch gesprochen, weil es die Sprache war, in der sie sich gegenseitig am besten verständigten. Jetzt fing ein jeder in seiner eigenen Sprache zu reden an, was dem gegenseitigen Verständnis Eintrag that, sich als politische Demonstration aber ganz gut machte.
Dem Czechen, welcher zwei Jahre lang mit seinem Zögling in Ungarn verbracht und dank seines Sprachtalentes nützliche Kenntnisse gesammelt hatte, ging es noch am besten. Der Deutsche verstand gar nichts – aber so untergeordneten Nationalitäten gegenüber war das auch nicht nötig.
Um seine Verachtung recht deutlich auszudrücken, sing er an zu singen, natürlich die »Wacht am Rhein«.
Nun stimmten auch die beiden anderen Demonstrationshymnen an – die Wirkung war nicht harmonisch, und das Bestreben eines jeden ging nur danach, den anderen zu überschreien.
Und als die drei, welche unter dem Kleinseitner Brückenturm so freundschaftlich vereint gewesen waren, auf dem Kreuzherrnplatz am anderen Ufer der Moldau auseinandergingen, reichte keiner dem anderen die Hand, und jeder schien es als eine besonderer Genugthuung zu empfinden, dem anderen den Rücken kehren zu können.
Hans Ronsky hatten sie vorläufig vergessen, und als er ihnen später wieder einfiel, hätten sie nicht mehr so genau anzugeben gewußt, was sie von ihm hofften.
In dem alten Palast in der Spornergasse ging es indessen noch immer lustig zu. Der böhmische Adel fuhr fort, seinen Intelligenzsieg zu feiern. Er feierte ihn mit Toasten, zuversichtlichen Prophezeiungen und schlechten Witzen. Seitdem die drei gelehrten Männer sich aus seiner Mitte entfernt hatten, fühlte er sich freier.
Ganz so überzeugt von den zukünftigen Leistungen Hans Ronskys wie die drei waren seine Standesgenossen nicht – beschäftigten sich überhaupt nicht so viel mit »Leistungen«.
Ein paar sehr junge und ein paar sehr alte Idealisten unter ihnen, diejenigen, welche die politischen Zustände in Oesterreich nicht mehr, und diejenigen, welche sie noch nicht kannten, glaubten noch an eine mögliche Besserung des Staatswesens.
Die Erfahrenen unter ihnen waren längst davon überzeugt, daß in Österreich überhaupt nichts zu hoffen sei. Sie gaben sich einer bequemen Hoffnungslosigkeit hin, die ihnen erlaubte, in ästhetischem, von allerlei unpolitischer Kurzweil gewürztem Müßiggang dem langsamen Auseinanderfallen der Monarchie zuzusehen. Alles, was sie vom Schicksal verlangten, war, daß die Monarchie eben nur auseinanderfallen und nicht platzen sollte. Im übrigen hatten sie längst den Wahlspruch des fünfzehnten Ludwig auf ihre Fahne geschrieben: »A près nous le délouge!« und ließen sich's wohl sein. Immerhin freuten sie sich an dem neuen Licht, das unter ihnen aufgegangen war, wenn auch mit Maß.
In einer der hohen Fensternischen des alten Saales, von dessen mit Gobelins bezogenen Wänden blaßrosa Menschenleiber aus märchenblauen Landschaftshintergründen heraufschimmerten, standen Fürst Karl von Lindberg, ein gewesener Staatsmann, und der schon erwähnte Graf Miroslaw, gewesener Diplomat – beide Vettern Ronskys im zweiten Gliede.
»Was hältst du von dem Burschen ... Famos! – so etwas noch nicht dagewesen unter uns ... ein Kopf! ... Brillante Studien! Wenn unsereiner mit so einer Basis ins Leben getreten wäre, wär's besser gegangen!« rief Fürst Lindberg.
»Weiß nicht,« erwiderte Graf Miroslaw. Er war viel gereist, hatte in seiner Eigenschaft als eleganter Bummler alle berühmten Hauptstädte der Welt kennen gelernt. Er war bekannt für seine treffenden, die verwickeltsten Situationen grell beleuchtenden Witzworte; ebenso wie für seine Uebereilungen im Gespräch. »Weiß nicht – sehr viele verlernen über ihren Bemühungen, Weisheit aufzuspeichern, die Fähigkeit, sie zu gebrauchen! Die meisten großen Männer waren auf der Schulbank nicht viel wert!«
»Ja, aber mein Lieber, wir müssen doch mit unserer Zeit fortschreiten! Heutzutage verlangt man von einem Staatsmann etwas anderes als früher. Früher begnügte man sich mit der Praxis – heute verlangt man die Theorie neben der Praxis ... das heißt die wissenschaftliche Begründung unseres Thuns!« dozierte Fürst Lindberg.
»Ach, hol der Teufel die wissenschaftliche Begründung, hol der Teufel die gesetzlich geschützte Neugierde und Impertinenz unserer Reichsratsabgeordneten, welchen das Recht eingeräumt worden ist, uns über unsere Regierungsmaßregeln zur Rechenschaft zu ziehen!« rief Graf Miroslaw. »Das, was man zum Regieren braucht, ist keine Schulweisheit – es ist Thatkraft und rascher Entschluß!«
»Rascher Entschluß!« wiederholte der Staatsmann ... »ja, der bedingt ...«
»Einen großen Mangel an ›wenn und aber‹ – und wenn ich nicht irre, hat unser Hans einen Ueberschuß davon!«
»Ja, weißt du, in Oesterreich, wo man so viel berücksichtigen und bedenken muß ...« »Der Teufel hol die Rücksichten und Bedenken!« erhitzte sich Graf Miroslaw immer heftiger.
»Weißt du, er hat gegen sich, daß seine Mutter eine Ungarin war, sein Vater ein Altczeche, und daß er an einer deutschen Universität promoviert hat!« meinte bedächtig der Staatsmann.
»Mit einem Wort, daß er ein Oesterreicher ist!« lachte Graf Miroslaw. »Der Umstand ist ja allerdings traurig, aber nicht ausschlaggebend dafür, daß er ganz gewiß seine Carriere verfehlen wird. Er ist eine schwache Natur – im gewohnten Geleise wird er rascher vorwärts kommen als ein anderer – aber außerhalb des gewohnten Geleises wird er sich nie zurechtfinden. Neues wird er uns nicht bieten. Wir brauchen einen Blücher der Politik, und Hans Ronsky wird nie etwas anderes sein als ein Bureau-Hamlet!«
Fürst Lindberg zuckte die Achseln; er führte die pessimistische Beurteilung, welche Graf Miroslaw der jungen Leuchte angedeihen ließ, auf neidische Gemütsaufwallungen des alten Diplomaten zurück.
Indes stand Ronsky, umgeben von einer Schar zu ihm emporsehender Studiengenossen, in welche sich auch ein paar ältere Herren mischten, unter einem sehr großen Reiterporträt, welches einen historisch berühmten Helden Ronsky mit dem Marschallstab in der Hand und hohen, großartig bespornten Reiterstiefeln an den Füßen, auf einem mild schnaubenden Grauschimmel und gegen einen Hintergrund von rauchenden Trümmern, blutenden Leichen und mehr oder minder zertrümmerten Kanonen darstellte.
Schön sah er aus, in seiner ganzen vornehmen schwarzen Länge unter dem Konterfei seines historischen Ahnen und gegen den Sims eines übrigens herzlich geschmacklosen roten Marmorkamins gelehnt! Groß und stramm, eine süperbe Haltung, den Kopf ein wenig zurückgeworfen, mit den feurigen ungarischen Augen, die ihm seine Mutter geschenkt, nach oben schauend – ein klein wenig Lord Byron, aber mit einem sehr steifen und sehr hohen Hemdkragen, war er ganz dazu geschaffen, nicht nur seiner Umgebung zu imponieren, sondern im gegebenen Moment die Menge hinzureißen.
»Wir werden's noch erleben, daß du berühmter sein wirst als der Alte hinter dir!« sagte einer der jungen Leute.
Hans sah um sich. »Wenn es auf Kosten von so viel Trauer und Zerstörung geschehen müßte, wär' mir die Berühmtheit nicht wünschenswert,« sagte er. Seine Stimme war wie ein Traum. Es war eine Männerstimme, aber sie hatte das weiche, umflorte Vibrieren mancher weiblicher Kontraaltos.
»Das sieht dir ähnlich, das bist wieder ganz du!« riefen einige seiner besonders begeisterten Jünger.
Hans legte dem neben ihm stehenden jungen Menschen die rechte Hand auf die Schulter. »Ihr wißt,« sagte er, »mein Motto ist ›Allezeit voran‹! Aber ...« er hob die linke Hand – eine sehr schmale, lange Hand mit einem losen Handgelenk – »aber...« fuhr er fort, »immer nur mit edlen Mitteln für einen edlen Zweck!«
»Sonderbarer Schwärmer!« bemerkte einer der ihn Umgebenden.
»Sonderbarer Schwärmer – her oder hin, aber ein Mordskerl ist er doch!« rief ein anderer; »und wir sind alle stolz auf ihn, das ist ausgemacht!« Das sagte der junge Mensch, auf dessen Schulter Hans sich gestützt hatte.
Hans nahm die Hand von seiner Schulter, um ihn damit auf den Rücken zu klopfen. »Mein Getreuester!« murmelte er; »nun, ich hoffe, daß ich euch Ursache geben werde, immer auf mich stolz zu sein!« »Aber Hans!« murmelte der ›Getreueste‹ – im gewöhnlichen Leben hieß er Graf Binsky – und ringsum glänzten feuchte Augen.
»Du, Hans!« tönte es jetzt aus einem anderen Ende des Saales herüber, »laß momentan deinen edlen Zweck und deine hohen Ziele in Ruhe, mögen sie wachsen und gedeihen! Aber sag mir ... hast du dich entschlossen – kommst du mit mir auf den Hirschen? Wenn du um elf Uhr mit mir abfährst, sind wir um zwölf in Mestec – schlafen zwei Stunden und sind um vier Uhr auf dem Anstand! – Sei fesch!«
»Ich käme sehr gern," meinte Hans – dann sich den Kopf krauend, setzte er hinzu: »aber ich hab' dem Papa versprochen, daß ich mit ihm nach Stiblin fahr' – er findet, daß heute noch nicht genug Champagner getrunken worden ist auf meine Gesundheit, und hat irgend eine Feier in Scene gesetzt.«
»Bei der von vorn angefangen werden soll,« lachte der Versucher. Es war ein Diplomat und hieß Graf Flintsch. »Hm! ... hm!« Flintsch vertiefte sich mit den Händen in feine Hosentaschen und mit den Augen in den Anblick des Plafonds, auf dem irgend ein vor zwei Jahrhunderten in Prag gastierender Maler in etwas greller, frei nach Julio Romano gehaltener Ausführung einen Phöbus gemalt hatte, der mit zwei wahnsinnig schnaubenden Schimmeln durch ein kupferfarbiges Flammenmeer hindurchraste.
»Hm! Kutschiert der Kerl schlecht!« meinte nachdenklich Graf Flintsch; dann sich von neuem an Ronsky wendend, fügte er hinzu: »Hm! Es wird wohl eine höchst erbauliche Feierlichkeit sein. Huldigungen sämtlicher Vasallen, Rentmeister, Oberförster und Güterinspektoren von zehn Uhr früh bis fünf Uhr nachmittags, jede halbe Stunde ein anderes Detachement – zum Schluß Familiendiner mit sechs alten Tanten! Verflucht ledern!«
Hans machte eine kleine Grimasse und streifte die Asche von seiner Zigarette herunter. »Das kann wohl sein,« gab er zu, »aber was willst du, der Papa freut sich darauf!«
»So ist er!« murmelte der Getreueste, »das ist der ganze Hans. Was liegt daran, wenn er sich langweilt – sein alter Vater freut sich darauf!«
»Aber beschäm' mich doch nicht so, Geni,« – der Getreueste hieß nämlich Eugen und wurde Geni gerufen – »das ist doch so natürlich!«
»Was?« fragte trocken Graf Flintsch.
»Nun, daß man seinen Vater nicht gern kränkt!«
»Du hast deinen Alten schauderhaft verwöhnt – das kommt davon!« seufzte Flintsch, dann knickte er sich in einen sehr niedrigen Sessel zu Füßen des siegreichen Helden Ronsky zusammen und begann von neuem: »Weißt du – ich stehe mit meinem Vater sehr gut, ich mache nicht mehr Schulden, als er selber für unumgänglich notwendig hält – und da ich Malteserritter bin, braucht er nicht zu fürchten, daß ich mich zu einer Mesalliance hinreißen lasse. Aber, wenn er mir mit so etwas käme – hm! ... so etwas wie diese – Feier, die dir da in Stiblin bevorsteht – da... da würde ich einfach, auf die Verdienste gestützt, die ich nicht hab' – auf die du dich aber berufen kannst, sagen: ›Lieber Papa, ich habe dir heute so viel Vergnügen gemacht, daß du mir auch ein kleines Pläsier gönnen mußt. Ich kann heute nicht mit dir nach Hause fahren, ich muß mit Gustl Flintsch abziehen und einen Hirschen schießen!‹ Aber das ist natürlich deine Sache!«
Der große Saal wurde allmählich leerer und leerer. Einer der Gäste nach dem anderen hatte Hans, ein letztes Mal beglückwünschend, die Hand geschüttelt und sich zurückgezogen. Der alte Ronsky war verschwunden, um sich zur Abreise zu rüsten, von älteren Herren war niemand mehr anwesend als Graf Miroslaw, welcher sich indessen der Gruppe junger Leute zu Füßen des historischen Ronsky genähert hatte und nun aufmerksam zuhörte. Er war sehr gespannt darauf, ob Hans Ronsky, welcher, wie er wußte, ein leidenschaftlicher Sportsman war, der Versuchung unterliegen werde oder nicht. Dem Gesichtsausdruck des jungen Mannes nach hätte er auf »ja« gewettet. Denn Hans Ronsky hatte angefangen, sehr nachdenklich auszusehen – und wenn man über eine Versuchung nachdenkt, so unterliegt man immer.
»Meiner Ansicht nach wird dein Alter die Kränkung verwinden,« fuhr Graf Flintsch fort, »mehr als das – wenn du den Morgen nach deiner Promotion einen Sechzehnender schössest, so wär' er nur noch ein wenig stolzer auf dich als zuvor – falls das überhaupt möglich ist!«
Flintsch blies die Backen auf und machte – wie er es zu stande brachte, ist seine Sache – einen ganz kurzen Hals und sehr breite Schultern: »Wissen Sie schon, Sie Schneider oder Müller oder Schmidt, mein Bub, der Hansi, hat einen Sechzehnender g'schossen, hundertfünfundsiebzig Schritt mit der Kugel am Morgen nach seiner Promotion – abends Champagner – in der Nacht die Eisenbahn – und früh der Hirsch – nicht zu glauben – aber 's ist halt eben der Hansi!«
Die Nachahmung der Sprechweise des alten Herrn war so täuschend, daß alle Anwesenden in herzliches Lachen ausbrachen.
Hans, der junge Doktor, wurde immer nachdenklicher.
»Na, überleg dir's,« meinte Flintsch, »in dreiviertel Stunden geht der Zug. Ich eile jetzt, mich reisefertig zu machen. Wenn du fünf Minuten vor halb elf Uhr auf der Nordwestbahn bist, ist's Zeit genug!«
Graf Flintsch war fort – Geni, der Getreueste, hatte sich ebenfalls verabschiedet, nur Graf Miroslaw war geblieben. Er sollte in dem Ronskyschen Palais übernachten.
Er ging mit langen Schritten unter den leise klirrenden, venetianischen Glaslüstern über das spiegelglatte Parkett. Hans Ronsky stand noch immer unter dem Porträt seines historischen Ahnen und grübelte. Endlich hob er den Kopf. »Gute Nacht, Onkel Max!« rief er.
Graf Miroslaw blieb stehen. »Zu was hast du dich entschlossen, Hansi?«
»Neides zu verbinden,« erwiderte Hans lustig. »Ich hab' mir's überlegt, es geht famos. Ich fahr' mit Gustl, geh' mit ihm auf den Anstand, um elf Uhr fahr' ich ab von Mestec und bin noch zur rechten Zeit vor dem Diner in Stiblin!«
»Famos! famos! Hans, aber beeile dich!« mahnte Graf Max Miroslaw.
Hans verschwand, um mit seinem Vater zu reden.
Ein wenig später rollten zwei Wagen aus dem mit Löwen garnierten Portal des Ronskyschen Palais.
Hans fuhr auf die Nordwestbahn – sein Vater auf den Staatsbahnhof. Der Zug, mit dem der Vater abfahren sollte, ging um zehn Minuten später als der des Sohnes.
»Hm! hm! Hat ein wenig lang überlegt, der junge Herr; wollen abwarten, was daraus wird,« brummte Miroslaw, dann verfügte er sich in das für ihn bereit gehaltene Schlafgemach hinauf.
Etwas über eine Stunde mochte vorübergegangen sein – Miroslaw stand gerade im Begriff, einzuschlafen, als er einen Wagen unten halten hörte, worauf ein scharfes Klopfen an das bereits geschlossene Portal erfolgte. Graf Miroslaw sprang aus dem Bett, riß ein Fenster auf und blickte in die Straße hinunter.
»Wer ist's?« rief er.
»Ich,« antwortete eine verdrießliche Stimme – die Stimme Hans Ronskys.
»Ja, was zum Teufel... ich glaubte, du seist längst über alle Berge.«
»Nein... wie du siehst, nicht... ich hab' den Zug versäumt. Gustl konnte mir nur noch aus dem Coupéfenster zuwinken, als ich kam – und dann ...«
»Nun?«
»Dann versuchte ich den Papa einzuholen!... Um eine Sekunde hab' ich's verpaßt! Fatal!«
Das Thor knarrte in seinen Angeln und öffnete sich.
»Gute Nacht, Onkel Max,« klang's noch hinauf – dann hatte sich das Thor hinter dem jungen Mann geschlossen.
Graf Miroslaw aber streckte sich von neuem behaglich auf seinem Lager aus.
»Er hat den Zug versäumt – er hat zu lange gebraucht, um sich zu entschließen – er wird immer zu lang brauchen und... immer den Zug versäumen!« murmelte er vor sich hin und lächelte leise. Dann schlief er ein.
Nach diesem über alle Maßen glänzenden Debüt praktizierte Hans Ronsky ein paar Jahre lang in einem Ministerium, worauf er die diplomatische Carriere antrat – und zwar aus verschiedenen Gründen.
Manche behaupteten, es geschehe, um weiter zu praktizieren und im Auslande nützliche Erfahrungen zu sammeln, welche seiner späteren österreichischen Ministerpräsidentschaft zu gute kommen sollten; andere sagten, er würde Diplomat, um dem Hader der Parteien in Österreich zu entfliehen, und noch andere wußten es ganz bestimmt, daß er vor seiner Schwester Leontine ins Ausland geflüchtet war.
Vielleicht waren alle diese Begründungen richtig – aber ganz besonders diejenige, welche auf seine Schwester Leontine Bezug hatte.
Die Gräfin Leontine Woronitzky war nämlich eine bedeutende Frau, und wenn eine bedeutende Frau nicht der Segen ihrer ganzen Umgebung ist, so ist sie gewöhnlich der Fluch derselben. Das letztere war bei Gräfin Leontine Woronitzky der Fall. Infolgedessen war sie ganz danach angethan, daß jeder, welcher mit ihr näher zu thun hatte, so bald als möglich trachtete, ihr davon zu laufen und sich hiermit ihrer zärtlichen Bevormundung zu entziehen.
Diese zärtliche Bevormundung, welche sie allen angedeihen ließ, die ihr das geringste Interesse einflößten, war fürchterlich! Am schmerzlichsten hatte dies der eigene Gatte der hervorragenden Frau empfunden, der, weil er ihr in dieser Welt nicht mehr entlaufen konnte, vor kurzem in die andere entflohen war.
‹
Hans floh nicht so weit, sondern erst für ein Jahr nach Washington, dann nach Berlin.
Es war heute gerade acht Tage her, seitdem er seine Junggesellenwohnung in den Zelten bezogen hatte, und das Heimweh steckte ihm noch in allen Gliedern.
Er fand alles häßlich in Berlin, besonders die Frauen. Die anmutigen unter ihnen erinnerten ihn an zierlich einherhüpfende Störche, während die energisch einfachen eine entschiedene Aehnlichkeit mit Kadetten in Weiberröcken aufzuweisen schienen. Sein Freund, Graf Flintsch, trachtete ihm vernünftige Ansichten beizubringen. Flintsch hatte sich in Berlin eingelebt und fühlte sich glücklich da. Er war eine von den vergnügten, sanguinischen Naturen, die sich jede Situation zurechtzurücken wissen und immer ihre Rechnung dabei finden.
»Ich versichere dir, es wird dir hier noch sehr gut gefallen,« wagte er zu behaupten, »ganz besonders dir. Du bist nun einmal nicht danach angethan, dein Leben einzig mit Sport und Tänzerinnen zu verzetteln, was, ein paar Komtessenschwärmereien abgerechnet, in Wien nun mal unsere Hauptbeschäftigung ausmacht. Du willst etwas leisten, und ehe du dazu Gelegenheit findest, willst du mit gescheiten Leuten darüber reden – und ich versichere dir, daß, wenn es auch nicht so viele hübsche Komtessen hier giebt wie in Oesterreich, die Zahl der bedeutenden Frauen, mit denen man reden kann, größer ist!«
»Nun, schließlich giebt es immerhin auch bedeutende Frauen bei uns zu Hause,« sagte Hans.
Graf Flintsch erriet sofort, daß Hans an die Gräfin Leontine dachte, und Hans erriet, daß ihn Flinsch erraten habe. Die Augen der jungen Leute begegneten einander – sie fingen beide an zu lachen.
»Hm! wie zum Beispiel Gräfin Woronitzky,« bemerkte Gustl kaltblütig. »Es ist ja natürlich, daß die nächsten Anverwandten unserem Gedächtnis immer am gegenwärtigsten sind – aber ich versichere dir, das ist doch noch etwas anderes. Bei aller grenzenlosen Hochachtung, welche ich für Gräfin Leontine hege, würde ich sie doch nicht zu den Frauen rechnen, mit denen man reden, sondern eher zu jenen ... hm ... denen man zuhören kann!«
Wieder begegneten die Augen der beiden jungen Männer einander, und diesmal fingen sie wieder beide an zu lachen; aber sie lachten ganz kurz – denn Flintsch mußte natürlich aufhören, sobald Ronsky aufhörte, und Ronsky hörte nicht nur sehr bald auf, sondern nahm sogar einen staatsmännischen Ernst an. So mitten in seine unbefangene Jugendlustigkeit hinein kam ihm oft plötzlich der Gedanke, daß ein Mensch, der zum zukünftigen Ministerpräsidenten von Oesterreich auserkoren war, seine Würde wahren müsse, selbst den vertrautesten Freunden gegenüber.
»Bei wem bist du denn eigentlich schon gewesen, wen hast du bereits kennen gelernt?« fragte Flintsch weiter.
Ronsky zählte eine Reihe wohlklingender Namen auf.
Flintsch schüttelte den Kopf. »Und unter all den Menschen solltest du niemand gefunden haben, mit dem du dich hättest unterhalten können?«
»Niemand, mit dem ich mich wohl gefühlt hätte.«
»Nun, ich versichere dir, das wird noch kommen; die Berliner Gesellschaft ist interessanter als die Wiener, schon, weil sie nicht so abgesperrt ist, schon, weil man in ihr Menschen begegnet, die man in Wien höchstens durch den Operngucker zu sehen bekommt. In ganz Wien findest du keinen Salon wie den von Rheinsbergs – ebenso, wie du kaum eine Frau findest in der Art der Gräfin Rheinsberg.«
»Die ist zufälligerweise eine geborene Oesterreicherin," warf Hans ein.
»Ja,« gab Flintsch zu, »und noch obendrein eine Böhmin, aber sie hat sich im Ausland entwickelt! Du hast sie noch nicht kennen gelernt?«
»Nein...« Hans hatte sie noch nicht kennen gelernt, hauptsächlich deswegen nicht, weil ihm seine Schwester Leontine streng eingeschärft hatte, es nicht zu unterlassen. Leontine war nämlich eifersüchtig auf die Gräfin Rheinsberg, deren glänzender Geist und Schönheitsruf durch ganz Europa verbreitet war – und da sie eifersüchtig war, war sie natürlich auch neugierig.
Der Grund, weshalb er der Gräfin Rheinsberg bis dahin ausgewichen war, verschwieg Hans dem Freunde, er brachte nur etwas Allgemeines über seine Antipathie gegen Blaustrümpfe vor.
Flintsch zuckte die Achseln. »Warte, bis du sie kennen gelernt hast,« sagte er. Dann machte er Ronsky einen Vorschlag.
Er stand eben im Begriff, einen Bazar zu besuchen, zu dem ihn mehrere Damen gebeten hatten. Auf dem Bazar würde Hans einen kompendiösen Klavierauszug von ganz Berlin antreffen – wenigstens von dem weiblichen Teil Berlins. Warum sollte ihn Hans nicht begleiten?
Hans haßte Bazare – er hatte die Absicht gehegt, den Nachmittag, behaglich in einem Excelsiorfauteuil ausgestreckt, mit dem interessanten Studium von einem Band Toqueville zu verbringen. ... Er ließ sich bitten ... aber... er ließ sich erweichen.
Der Erlös des in Rede stehenden Bazars war als milder Beitrag zur Errichtung eines Kinderspitals bestimmt. Infolgedessen hieß er der »Spitalsbazar« – ja, viele nannten ihn kurzweg das »Spital«. Man hatte große Mühe gehabt, ihm irgend eine packende, die Neugierde des Publikums anregende Seite abzugewinnen. Es gab auch dies Jahr gar zu viel Konkurrenz in Bazaren!
Der einzige Bazar, welcher in diesem Jahr einen großen, unbestrittenen Erfolg aufzuweisen gehabt hatte, war der Frauengroschenbazar, welcher »grauer Frosch« genannt, unter der Präsidentschaft der Fürstin Bismarck im Kongreßsaal abgehalten worden war.
Die Präsidentschaft der Fürstin sicherte dem Unternehmen die Sympathieen des Fürsten. Er war an beiden Bazartagen eine volle Glockenstunde lang anwesend gewesen – und das machte den Erfolg des Unternehmens aus.
Das Publikum hätte sich totschlagen lassen, um den Reichskanzler zu sehen. Für das bloße Entree waren große Summen eingegangen – Kopf an Kopf hatten die Spießbürger den runden Tisch umstanden, an dem der Fürst zwischen zwei schönen Frauen mit herzhaftem Appetit sein Gabelfrühstück eingenommen hatte. Es war ein großartiger – ein historischer Moment, noch Kindern und Kindeskindern wollten sie's erzählen, daß sie den »Fürsten«, den »Reichskanzler« – daß sie »Bismarck« hatten Hummer essen sehen!
Ja, so etwas konnte das »Spital« der Menge nicht bieten.
Nach langem Hin- und Hersinnen hatte man sich dazu entschlossen, die ungarischen Zigeuner spielen zu lassen. Es war zwar nur ein recht mäßiger Ersatz für den Reichskanzler – aber immerhin etwas.
Uebrigens nicht nur was seine pièce de résistance anbelangt, sondern in jedem Detail war der arme Spitalbazar auf Hindernisse gestoßen – ganz besonders in Bezug auf das Lokal, in dem er sich niederlassen sollte. Keines der Ministerien hatte ihm ein Obdach gewährt. Nach langem Hin- und Herirren hatte man ihm den großen Saal der Kriegsakademie geöffnet, wo er sich dann schließlich etwas verschämt und kleinlaut niederließ.
Man hatte auch gar zu viele Bedingungen an seine Anwesenheit in der Kriegsakademie geknüpft. Zum Beispiel war eine Verordnung gekommen, daß die Komiteedamen nur eine Viertelstunde vor oder eine Viertelstunde nach zwölf Uhr die Haupttreppe benutzen durften, wodurch man einer Begegnung der Kriegsschüler mit den Komiteedamen vorzubeugen hoffte.
Ob man fürchtete, daß die Begegnung die Komiteedamen aufregen könnte oder die Kriegsschüler, blieb dahingestellt. Immerhin war die Verordnung demütigend.
Da, wie die Damen bald merkten, es mit den Zigeunern nicht gethan war, um dem armen Spitalbazar einen halbwegs zweckentsprechenden Erfolg zu sichern, hatte man schließlich eine glänzende Idee.
Das Komitee wendete sich an die Gräfin Rheinsberg mit der Bitte, sich an die Spitze des Unternehmens zu stellen.
Und die Gräfin Rheinsberg sagte zu. Von dem Augenblick an hob sich die Popularität des »Spitals«.
Gräfin Rheinsberg war zwar nicht so berühmt wie der »eiserne Kanzler«, aber eine Zugkraft war sie doch, und alles, was sie anrührte, gedieh. Es war kaum ruchbar geworden, daß sie dem Bazar ihr Interesse widmete, als bereits zwei Prinzessinnen von Geblüt ihre Mitarbeiterschaft an dem wohlthätigen Werk freiwillig anboten.
Diesen und noch anderen »Tratsch« erzählte Flintsch seinem ernst angelegten Freund auf dem Wege in die Dorotheenstraße, während er mit ihm die erschrecklich steile und gerade Treppe hinaufstieg, die in das Stockwerk führte, wo der Bazar einquartiert worden war. Hans hörte mit einem halben Ohr zu und lächelte mit einem Mundwinkel. Dann fing Flintsch an, von der Gräfin Rheinsberg zu schwärmen.
Da blieb Hans mitten auf der Treppe stehen und zog die Brauen zusammen.
»Du wirst sie entzückend finden!« versicherte Flintsch. Hans aber schüttelte die Zumutung ungeduldig duldig von sich ab.
»Bezaubernde Eigenschaften mag sie haben,« gab er spöttisch zu, »sie dankt ihnen ja ihre glänzende Existenz; aber ich werde mich nie mit dem Umstand abfinden, daß sie sich als zwanzigjähriges Mädchen an einen Greis verkauft hat!«
»Erstens war er, wenn auch ein älterer Mann, nichts weniger als ein Greis, da sie ihn heiratete,« verteidigte Flintsch die Gräfin, »zweitens hat sie ihre Pflicht an seiner Seite tadellos erfüllt – es ist auch nicht das Mindeste gegen ihren Ruf...«
Doch da hatten sie den Saal erreicht – Tische rechts, Tische links, Tische in der Mitte, die ganze Länge des Saales entlang Tische – alle mit züchtig drapierten Beinen und die heterogensten Gegenstände tragend: Kinderwäsche, Verbandzeug, Seife und Parfüms – Kaffee und Thee – Fleischkonserven – Schokoladebonbons – Blumen – Luxusgegenstände und so weiter.
Wie alle Wohlthätigkeitsveranstaltungen hatte der Bazar eine demokratische Verfassung, das heißt der aristokratische Aufputz ruhte auf plebejischer Basis, und an den vornehmsten Tischen machte sich irgend eine bürgerliche Intelligenz nützlich.
Unten gegen die Eingangsthür zu war alles bürgerlich – dort wurden auch meistens baumwollene Gegenstände und Küchengerätschaften verkauft – aber gegen den oberen Teil des Saales zu wurde die Sache immer exklusiver und gipfelte schließlich in dem sogenannten Prinzessinnentisch.
Neben der Eingangsthür saßen auf einer kleinen Estrade die Zigeuner. Sie feierten gerade eine Ruhepause und tranken Bier – das kleine Orchester im Schnürrock – der Dirigent, weizengelb mit pechschwarzem Haar und Bart – mehr malaiisch als zigeunerhaft anzusehen, in schwarzem Gesellschaftsanzug und Lackstiefeln.
Ein Summen wie in einem großen Vogelkäfig, in dem die Vögel frisch eingefangen sind, ging durch den ganzen Saal. Das weibliche Element war entschieden vorherrschend! Der Geruch von Treibhausblumen mischte sich mit dem Geruch von rotem Kattun.
Die beiden Freunde strebten dem Prinzessinnentisch zu. Zwei sehr niedliche, sehr vornehme Damen, denen die anderen vornehmen Damen besondere Ehrfurcht bezeigten, standen neben dem Tisch. Eine von ihnen blickte aufmunternd einem etwas geknickt einhergehenden, graubärtigen Mann ins Gesicht, der ihren Blick mit einem heftig abwehrenden: »Aber ich bitte, meine gnädigste Gräfin, ich habe schon ...« beantwortete.
Er hatte nämlich schon einer anderen von den Damen einen Tausendmarkschein übergeben und wehrte sich gegen weitere Plünderungen.
Er war einer der reichsten Bankiers von Berlin und ging immer so geknickt einher, als ob er die Menschen um Verzeihung bitten wollte, daß er so viel Geld habe. In dieser übertriebenen Bescheidenheit bildete er ein Gegenstück zu einer jungen Frau, auf welche Flintsch seinen Freund Ronsky aufmerksam machte. Sie stand, erdrückt von ihren unverdienten Vorzügen, mit beständig niedergeschlagenen Augen da und – so behauptete Flintsch – pflegte ihren Freunden mit Vorliebe zu versichern: »Ich kann ja nichts dafür, daß mich der liebe Gott so schön gemacht hat!«
Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Helden der Bescheidenheit war, daß Herr Schwarz das Geld, für welches er sich entschuldigte, wirklich besaß, während die Schönheit der Frau von Binder mehr eine eingebildete Krankheit war.
An dem Prinzessinnentisch machte sich Flintsch sehr liebenswürdig – er stellte seinen Freund vor, erzählte ein paar boshafte Anekdoten und kaufte einen Fächer, der von einer der Prinzessinnen gemalt worden war.
Seinen Zweck aber erreichte er nicht: Marie Rheinsberg befand sich in dem Augenblick nicht an dem Prinzessinnentisch, infolgedessen konnte er ihr seinen Freund auch nicht vorstellen. Sein Blick schweifte durch den Saal. Von dem Blumenstand aus, der sich knapp neben dem Prinzessinnentisch befand, kamen zwei Mädchen auf ihn zu und reichten ihm lachend die eine einen Strauß Tulpen, die andere einen Strauß Veilchen. Ehe er ihnen die Blumen abnehmen konnte, war Hans ihm zuvorgekommen. Er reichte jeder der jungen Damen ein Zwanzigmarkstück, wobei er sich tief verbeugte und bat, vorgestellt werden zu dürfen.
Nun wurde er umringt, aus allen Weltgegenden kamen schlanke Mädchenhände, die ihm Blumen anboten.
»Der reinste Parzival,« murmelte Flintsch. Hans fing es an schwül zu werden – auf eine so gründliche Ausplünderung war er nicht gefaßt gewesen. Schon wollte er sich unter einem höflichen Vorwand und mit einer bescheidenen Schlußspende losmachen, als er plötzlich bemerkte, daß vom anderen Ende des Saales ihn ein Paar seltsam leuchtende Augen beobachteten. Die Augen standen unter einer weißen, von kastanienbraunem Haar umwellten Stirn. Stirn und Augen waren das Merkwürdigste in dem Gesicht, in dem übrigens alles schön war, die gesunden, aber zarten Farben, ebenso wie die Züge – eher große Züge, die in die Ferne ebenso wie in der Nähe wirkten und an die schönsten Köpfe von Burne Jones erinnerten; dazu eine volle Gestalt, etwas klassisch Harmonisches in allen Verhältnissen, und doch in der ganzen Erscheinung so viel Geist und Leben sprühende, echt moderne Vornehmheit. Ein pelzverbrämtes, dunkelblaues Sammetkleid, auf dem kastanienbraunen Haar auch irgend etwas Pelzverbrämtes, das einen Hut darstellen sollte und mit einem Busche von Reiherfedern und einer altertümlichen Diamantagraffe geschmückt war. Ohne sich erklären zu können, wie das kam, erriet Hans sofort, daß diese ausnehmend schöne Person die Gräfin Rheinsberg sein mußte, die arme Marie Berg, die sich an den reichen norddeutschen Edelmann verkauft hatte.
Ein Wunsch, an ihr herumzumäkeln, befiel ihn, welcher Wunsch sofort von einem anderen abgelöst wurde – dem Wunsch, Eindruck auf sie zu machen. Vorbei war's mit Vorsicht und Mäßigung. Er zog seine Börse und schüttelte, ohne zu zählen, den ganzen goldenen Inhalt derselben in die Hände des ihm am nächsten stehenden jungen Mädchens aus, wobei er lachend sagte: »Einer für alle, so weit es reicht,« hierauf aber den ihm von allen Seiten aufgedrängten Blumenreichtum in die Arme nahm und mit einer ritterlichen Verbeugung auf den Prinzessinnentisch niederlegte.
»Sehr gut! Damit hast du dir deinen Platz in der Berliner Gesellschaft erobert,« flüsterte ihm Flintsch zu. »Ein bißchen aufs Effektmachen müssen wir abzielen, besonders im Anfang!«
Hans runzelte die Stirn. Er war einer von jenen, die es nicht lieben, wenn man die Dinge brutal beim Namen nennt. Sein Blick schweifte nach der Schönheit im pelzbesetzten blauen Sammetkleid – er merkte, daß ihre Augen ihm Beifall zollten.
»Na, dort ist sie!« rief Flintsch.
»Wer?« fragte scheinbar arglos Hans.
»Nun sie – Gräfin Rheinsberg – dort neben dem Tisch mit den Fußsocken und wollenen Bettdecken steht sie. Sie ist nämlich ein schrecklicher Wohlthätigkeitsfex – aber ohne Ostentation, das muß man ihr lassen! Komm, Hans!«
»Ja, wenn dir ein Gefallen damit geschieht!«
Die beiden jungen Leute näherten sich der schönen Frau. Ein neugieriges Gemurmel surrte hinter ihnen drein. Flintsch kannte man seit zwei Jahren. Er war allgemein beliebt, war überall gern gelitten – aber er hatte nie Aufsehen erregt. Er war in jedem Sinn des Worts mittelgroß, paßte überall hinein und ragte nirgends hervor. Er war der Attaché, wie er im Buche steht – auch in seinem Aeußeren vom Kopf bis zu den Füßen Durchschnittsware des männlichen österreichischen Luxusartikels. Ronsky dagegen mußte auffallen, wo er erschien. Das ungarische Blut, welches er von seiner Mutter hatte, schlug stark bei seiner Erscheinung durch. In seine moderne Vornehmheit mischte sich irgend ein Element ritterlicher Romantik, das für die Frauen etwas Unwiderstehliches hatte.
Er trug die Haare um ein Spürchen länger als die meisten seiner Standesgenossen und einen leichten, lockigen Bart um das schmale, auffallend feingeschnittene Gesicht. Dazu war er um einen Kopf größer als Flintsch. Kein Wunder, daß ihm alle Blicke folgten, und daß alle hoffähigen jungen Damen von Berlin sich nach seinem Her- und Auskommen erkundigten.
Als die Gräfin Rheinsberg merkte, daß die beiden jungen Männer auf sie zuschritten, wurde sie plötzlich zerstreut – und aus Zerstreutheit kaufte sie ein halbes Dutzend wollener Decken und ein ganzes Dutzend baumwollener Nachtjacken. Sie hatte den Handel gerade abgeschlossen, als Flintsch vor ihr stehen blieb.
»Gestatten Sie mir, Ihnen meinen Freund Graf Ronsky vorzustellen, einen Landsmann!«
»Und wenn ich nicht irre, eine Art Vetter,« bemerkte die Gräfin und heftete freundlich lächelnd den Blick auf ihn. Ihr Lächeln hatte ebensoviel Glanz wie ihre Augen. Dabei reichte sie dem jungen Mann die Hand, eine Auszeichnung, die er mit einem ehrerbietigen Lippenstreifen erwiderte.
»An mir war es nicht. Sie an unsere Verwandtschaft zu erinnern, Gräfin!« sagte er. Sein Ton war sehr höflich, aber etwas gezwungen.
Ein Schatten zog durch ihre hellen Augen. Offenbar hatte sie das Gefühl, ihre Liebenswürdigkeit an einen Unwürdigen oder, was noch ärger ist, an einen Undankbaren verschwendet zu haben. Nun sind wir Menschen einmal derartig geraten, daß uns auf der Welt keine Verschwendung mehr gereut als verschwendete Liebenswürdigkeit. Sie änderte sofort Ton und Haltung, sprach von den gleichgültigsten Dingen so unverwandtschaftlich wie möglich.