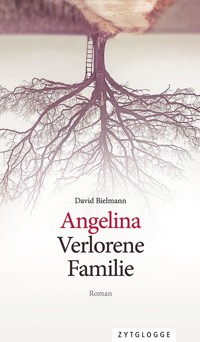25,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1820 im freiburgischen Rechthalten: Die 21-jährige Christina Aeby wird tot aufgefunden. Am Vorabend besuchte sie mit ihrem Freund Peter Roschi den Maimarkt in der Stadt, und nun vernimmt man im Dorf vom Gewaltverbrechen. Was ist auf dem Heimweg passiert? Mit ihrer Schönheit hat Christina Aeby am Markttag die Blicke auf sich gezogen. Viele sind mit ihr in Kontakt getreten und können nun etwas erzählen. Die Landjäger beginnen mit den Ermittlungen. Am Ende wird jemand des Mordes überführt. Doch ist es der Täter? Noch heute erinnert im Ort ein Gedenkstein an die Tat, und der Name Christina Aeby ist manchem Einheimischen ein Begriff. Doch was damals genau geschah, ging vergessen oder gelangte nie an die Öffentlichkeit. David Bielmann rekonstruiert in seinem Roman die Ereignisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
DAVID BIELMANNIM SCHATTEN DER LINDE
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
© 2018 Zytglogge Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Angela Fessler
Cover: Fabienne Bielmann, Dimorph.ch
e-Book: mbassador GmbH, Basel
David Bielmann
IMSCHATTENDERLINDE
Die Ermordung der Christina Aeby
Roman
Die kursiv gedruckten Passagen entstammen den originalen Akten von 1820, die sich im Staatsarchiv Freiburg befinden. Sie wurden teilweise an den aktuellen Sprachgebrauch angepasst.
In der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 1820 wurde Christina Aeby im Alter von einundzwanzig Jahren zur Dorflegende. In den zwei Jahrhunderten, die auf die Nacht folgten, schufen Künstler zu ihrem Gedenken Mahnmale, Dichter verklärten sie in Liedern und romantisch-schaurigen Erzählungen, Eltern machten sie zur Heldin von Gutenachtgeschichten, an die sich die Kinder zeitlebens erinnerten und die sie ihren eigenen Kindern vortrugen. Die Geschichten um Christina Aeby wandelten sich, lösten sich von den tatsächlichen Ereignissen, wurden zum Mythos. Doch was damals genau geschah, ging vergessen oder wurde dem Volk bis heute vorenthalten.
Kein schöner Land in dieser Zeitals hier das unsre weit und breit.Wo wir uns findenwohl unter Lindenzur Abendzeit.
(Volkslied)
ERSTER TEILDIE LIEBENDEN
1.
«Schau!»
«Was ist?»
«Schau nach rechts!»
Wilhelm Repond schaute nach links. Er sah nichts.
«Und jetzt links!», sagte Peter Bächler leise.
Endlich sah auch Wilhelm nach rechts. Dann hielten beide die Luft an.
Die zwei jungen Männer, die auf dem Schindeldach des Schuppens sassen, hatten nicht allzu viele Gründe, mit sich und dem Leben zufrieden zu sein. Sie hatten keine regelmässige Arbeit, da man wusste, wie die beiden arbeiteten, sie hatten keine Aussicht auf einen eigenen Hof und sie hatten meistens keinen Schnaps. Sie hatten keine Ersparnisse, keine schönen Kleider, und natürlich hatten sie auch keine Frau. Der faule Stockzahn des einen und die abstehenden Ohren des anderen stimmten, was Frauen betraf, auch wenig zuversichtlich. Als Protest gegen die herrschende Ungerechtigkeit auf Erden legten sie sich in letzter Zeit oft ins Gras oder auf das Dach des Schuppens, schauten verächtlich den tüchtigen Leuten zu und kauten gestohlenen Tabak. Es war ihnen klar geworden, dass sich dieses harte und fast ein bisschen sinnlose Leben mit Müssiggang besser ertragen liess als mit Eifer, der sich nicht auszahlte. Natürlich bekam man Sprüche zu hören, wenn man seine Untugenden so zur Schau stellte. Aber die Sprüche waren ja schon gekommen, als man sich noch bemüht hatte. Man musste die Leute reden lassen, das erleichterte vieles. Und niemand konnte ernsthaft behaupten, das Dach des Schuppens neben der Kirche sei ein schlechter Platz, wenn Christina Aeby durch das Dorf spazierte. Das lange helle Haar, das im Sonnenschein glänzte. Das Gesicht, so zart wie jene der Engel an der Kirchendecke. Der Körper, der noch die Reinheit eines Mädchens, aber bereits die Reize einer Frau besass …
«Wo will die schöne Frau denn hin?», fragte Wilhelm Repond interessiert und stellte, noch während er redete, fest, dass es der Frage ein wenig an Einfallsreichtum mangelte. Es war offensichtlich, wo sie hinwollte. Wo sonst sollte sie hinwollen als in die Stadt auf den Frühjahrsmarkt? Alle, die heute im Dorf und der Umgebung unterwegs waren, wollten in die Stadt. Doch wenn man im eigenen Dorf eine so schöne Frau antraf, konnte man sich den Gang in die Stadt eigentlich sparen. Dann musste man das Glück geniessen, das durch den Körper schoss, und hoffen, es möge noch eine Weile anhalten. Christina Aeby. Allein ihr Name stand für etwas Herrliches, Himmlisches. Für etwas, das aus dem Alltagsnebel herausragte und einem eine Ahnung gab, was jenseits des Nebels möglich wäre.
«In den Wald, Pilze sammeln», sagte Christina.
Der Anblick der beiden Burschen, die bemüht locker mit gekreuzten Beinen auf dem Schindeldach des Schuppens sassen, trieb ihr ein Lächeln ins Gesicht.
Die unerwartete Antwort machte Wilhelm Repond kurz sprachlos. Peter Bächler sprang bereitwillig in die Bresche.
«Mit wem denn?»
Es hätte erfinderischere Fragen gegeben, dachte er selbstkritisch, er wusste nämlich genau, mit wem Christina Aeby Pilze sammeln wollte. Den ganzen Morgen hätte man Zeit gehabt, sich eine Unterhaltung mit Christina auszudenken. Das hatte man natürlich versäumt, deshalb war ihm auf der Stelle nichts anderes in den Sinn gekommen. Doch auch ein geistloses Ansprechen war besser, als Christina schweigend vorbeiziehen zu lassen.
Dass Christina Aeby etwas Besonderes war, hatte sich – anfänglich zum Stolz, bald zum Leidwesen der jungen Rechthaltner – über die Dorfgrenzen hinaus gesprochen. Die Betrübnis unter den Einheimischen war gross gewesen, als sich letzten Sommer die Kunde verbreitete, ein gewisser Peter Roschi aus Plasselb würde Christina erfolgreich umwerben. Sie hatte also einen Freund, das war irgendwann zu befürchten gewesen, aber es hätte nicht ausgerechnet ein Plasselber sein müssen. Und als man den Roschi dann bei Gelegenheit kritisch studierte, sah man einen zwar recht ordentlichen Kerl, aber keineswegs einen so umwerfenden, mit dem man sich nicht hätte messen können. Er war ein ganz normaler Bauernsohn. Jedenfalls dachte man, dass es so viel nun auch nicht brauchte, um den begehrten Platz an Christinas Seite zu ergattern, und dass man selber mit etwas mehr Vehemenz vielleicht doch auch infrage gekommen wäre.
«Ich gehe mit meiner Mutter», sagte Christina und lächelte so reizend, dass man oben auf dem Dach fast schwindlig wurde. Dann ging sie ihres Weges, dem Kirchgemäuer entlang auf das Wirtshaus zu in Richtung Stadtgasse.
Als es von Christina nichts mehr zu sehen gab, hatte Wilhelm Repond eine Vermutung: «Die hat dich doch für dumm verkauft! Die geht doch nicht mit ihrer Mutter. Sonst wäre die auch schon da.»
Peter Bächler nahm sein Tabakdöschen aus der Hosentasche und stopfte sich eine Portion in die Backe. Auch Wilhelm Repond bediente sich.
«Wenn ihr zwei immer so dumm mit den Frauen redet, wird das nie etwas!», rief jemand zum Dach hinauf.
Sosehr ein gewisses Mass an Spott zur Tagesordnung gehörte – von einem Leichtfuss wie dem Knecht Lauper verhöhnt zu werden, musste man als Höchststrafe bewerten.
«Was … was hättest du denn anders gemacht?», fragte Peter Bächler.
Lauper nickte überlegen, rammte die Heugabel in die Erde und stellte sich breitbeinig hin.
«Buben», rief er, «hört mir jetzt gut zu!» Er prüfte mit einem scharfen Blick die Aufmerksamkeit der beiden, dann begann er mit einer kleinen Lehre in Sachen Liebe: «Es ist nicht ratsam, eine Frau zu zweit anzusprechen. Das führt selten zum Erfolg. Gefallen ihr dann beide, ist sie bloss verwirrt und kann sich nicht entscheiden. Gefällt ihr nur einer, stört der andere. Habt ihr nicht genug Mut, mit einer Frau allein zu reden?»
Peter Bächler kaute auf seinem Tabak herum und hoffte auf eine bissige Entgegnung von Wilhelm Repond. Doch auch der kaute auf seinem Tabak.
«Zweitens», fuhr Lauper fort, «darf man die Frauen nicht am Morgen ansprechen. Niemand hat am Morgen schon Zeit für die Liebe. Essen besorgen, backen, kochen, waschen, auf die Kinder aufpassen, die Alten pflegen – tagsüber hat man ganz anderes im Kopf. Am Abend aber, wenn die Pflicht erfüllt ist, wenn es langsam dunkel wird, da muss man dann handeln.»
Das klang alles gar nicht so übel, so viel Wissen hatte man Knecht Lauper auf diesem Gebiet nicht zugetraut. Aber das durfte er nicht mitbekommen. Peter Bächler spuckte unbeeindruckt Tabaksaft aus.
«Und drittens», Lauper machte eine kleine Pause und sah belustigt zu den beiden hoch. «Mit diesem ekelhaften Tabak im Maul nimmt euch sowieso niemand ernst.»
Dann ging er mit einem lauten Lachen zurück in den Stall.
Es war eine Weile still.
Und plötzlich hatte auch Peter Bächler eine Vermutung: «Sie hat auch dich für dumm verkauft! Sie geht doch nicht in den Wald, geht doch nicht Pilze sammeln. Sie geht in die Stadt!»
2.
Knecht Lauper. Auch er hatte Christina vorhin durch einen kleinen Spalt in der Stalltüre länger als nötig nachgesehen. Natürlich verdrehte Christina auch ihm manchmal den Kopf. Immer wenn er sie erblickte, war er verliebt in sie. Sah er sie für eine Weile nicht, liess die Liebe nach, denn er besass ein schlechtes Erinnerungsvermögen. Dann wusste er zwar noch, dass sie sehr hübsch war, die Einzelheiten aber hatten sich aus seinem Gedächtnis gelöst. Wenn doch nur ein Maler nach Rechthalten käme und ein Gemälde von Christina schüfe, damit ihre Schönheit ewig wäre, hatte er einmal im Wirtshaus ausgeführt. Zum Glück hatte ihm niemand zugehört.
Er versetzte sich in Gedanken in seine Jugend. Er sah einen galanten Jüngling mit vollem Haar und geradem Rücken. Wenn er noch einmal jung wäre, dann wüsste er, was zu tun wäre. Dann würde er all die Kenntnisse, die er über die Liebe hatte, anwenden und sich um die Tochter von Schneider Aeby bemühen. Ganz unschuldig würde er mit ihr nach getaner Arbeit auf den Fofenhubel spazieren, mit ihr den Sonnenuntergang betrachten und sie dann, wenn es fast finster wäre, an sich ziehen … Aber er war eben kein galanter Jüngling mit vollem Haar und geradem Rücken mehr. Er hatte sich in den von der Gicht geplagten Knecht Lauper verwandelt. Und er hatte ja eine Frau. Nicht die schönere als Christina, aber das wäre auch recht viel verlangt gewesen.
3.
Christina verliess das Dorf über die Stadtgasse, einen Hohlweg, den Fuhrwerk, Zugtiere und Wetter über die Jahrhunderte tief ins Gelände geschnitten hatten. An den Flanken des Wegs traten die Wurzeln der Bäume wie hölzerne Innereien aus dem Boden und krochen in immer neuen Wucherungen über die Erde. Die Äste samt dichtem Blattwerk neigten sich von beiden Seiten über die Senke und machten sie dunkel. Früher hatte sich Christina gefürchtet, die Stadtgasse allein zu passieren. Heute erreichte sie sorglos das Wegkreuz am Ende der Gasse und blieb stehen. Roschi war noch nicht da. Er war meistens noch nicht da, wenn man mit ihm abgemacht hatte. Er hatte viele gute Züge, aber er hatte einen etwas sonderbaren Umgang mit der Zeit. Er mochte die Zeit nicht. Seine Tage seien bereits dem straffen Diktat der Arbeit und der Sonne unterworfen, sagte er jeweils, da brauche er nicht noch die Kirchenglocke, die sich einmischte. Dagegen hatte Christina im Grunde nichts einzuwenden. Nur hätte er bei einer solch gleichgültigen Handhabung der Zeit auch einmal zu früh sein dürfen. Die Kirche von Giffers schlug neun Uhr.
«Ein herrlicher Tag, nicht wahr?», sagte Hans Delaquis, als er gemeinsam mit seinem Esel an Christina vorbeizottelte.
Christina blickte über die grünen Wiesen, die gelben Felder, die fernen Hügel des Welschlandes. Die Sonne tauchte die Landschaft in Gold, alles grünte, wuchs und erblühte, und die Vögel feierten die Rückkehr des Lebens. Der unheilvolle Sommer, der vor vier Jahren ins Land gezogen war, hatte die Menschen verändert. Er hatte sie wieder Demut vor der Natur gelehrt, er hatte ihnen ihre Grenzen gezeigt. Der Sommer 1816 hatte unter anderem bewirkt, dass sich auch in der düsteren Stadtgasse niemand mehr fürchtete und dass selbst eine zwielichtige Gestalt wie Hans Delaquis, der weder eine besondere Leidenschaft für die Natur besass noch für sein übervolles Herz bekannt war, wegen eines prächtigen Tages ins Schwärmen geriet. Der Sommer 1816 war gar kein Sommer gewesen. Nach einem ganz gewöhnlichen, jedenfalls kein Unheil ankündigenden Frühling wurde der Himmel damals grau und schwer. Dann regnete es, tagelang, wochenlang. Dämme brachen, liebliche Bächlein wurden zu reissenden Flüssen. Die Freiburger Unterstadt versank im Wasser, Neuenburger-, Murten- und Bielersee bildeten einen einzigen See, in dem die aufgeblasenen Körper von Schweinen, Kühen und Menschen trieben. Es war kalt und finster, die Pflanzen serbelten dahin, die Ernte blieb aus. Selbst die Wohlhabendsten litten an Hunger, das gemeine Volk aber trieb sich wie Vieh auf den Wiesen oder in den Wäldern herum, auf der Suche nach etwas, das man essen konnte, Löwenzahn, Baumrinde, Holzwürmer. Auf dem Schwyberg lag übers ganze Jahr eine dicke Schneedecke, und auch in tiefer gelegenen Gebieten schneite es im Juli, schneite es im August, die Sonne war nur noch eine Erinnerung, eine Vermutung hinter dem dichten Gewölk. Und dann, irgendwann im Herbst, als die Leute am Ende ihrer Kräfte und Hoffnungen waren, als man schon gar nicht mehr darüber nachdenken mochte, wie lange man diese Apokalypse noch aushielt, kehrte die Sonne zurück. Doch da waren diese Flecken. Die Sonne war mit dunklen Flecken bedeckt. Und dann donnerte es und die Erde bebte, und der Weltuntergang schien endgültig besiegelt.
Nun schlug auch die Kirche von Rechthalten neun Uhr. Wenn sich nicht einmal die Kirchen einig sind, dachte Christina, dann musste man wohl Roschi auch etwas Spielraum zugestehen. Andererseits: Wenn zwei Kirchen der Meinung waren, es sei schon neun Uhr, dann hatte ein Bauer schlechte Argumente.
Auf den Wegen herrschte viel Betrieb. Keiner meinte, der Maimarkt könne auch ohne ihn stattfinden. Während Christina allein am Wegrand stand und wartete, wurde sie von allerart Mannsbildern angesprochen. Dabei erwiesen sich Komplimente als besonders beliebtes Konversationsmittel.
«Schöne Bluse!», hörte sie etwa.
Willy Vogelsanger ging schon einen Schritt weiter und sagte: «Schöner Rock!»
Und Niklaus Tinguely fasste sich ein Herz und wagte ein «Schöne Haare!».
Christina dankte jeweils artig, sie wollte nicht eingebildet und unfreundlich sein. Aber doch sehnte sie nun die Ankunft ihres Freundes herbei.
«Hättest du einen Einheimischen, müsstest du nicht so lange warten», gab ihr der Sigrist Augusin zu bedenken.
«Ich warte lieber», antwortete Christina, woraufhin der Sigrist ohne weitere Worte abzog.
Christina Aeby wusste, warum sie eine besondere Anziehungskraft auf das andere Geschlecht ausübte. Sie wusste, warum man mit ihr reden wollte, warum man ihr hinterhersah, warum es ihretwegen schon viel Kummer und Neid gegeben hatte: wegen ihrer Schönheit. Es war nicht ihr gutes Herz, das die Männer verzauberte, nicht ihr Wissensdurst, nicht ihr Flötenspiel, nicht ihr handwerkliches Geschick, nicht ihre Hilfsbereitschaft, nicht ihr Witz. Wer sie mochte, fand sie schön. Und das gefiel ihr nicht.
Er kam, noch bevor die beiden Kirchtürme die nächste Viertelstunde schlugen.
«Ich komme!», rief er überflüssigerweise, Christina hatte ihn schon längst dahereilen sehen, und noch während er die letzten Schritte zurücklegte, die sie voneinander trennten, begann er über das Melken und die Birnen und die Hühner zu fluchen und dass er wieder alles hatte allein machen müssen.
Christina begrüsste ihn gelassen, zu sehr hatte sie sich auf den Markttag und vor allem auf das Wiedersehen mit Roschi gefreut, um sich von einer kleinen Verspätung betrüben zu lassen. Sie hatte auch Bedauern mit ihm. Er war der einzige Nachkomme und seine Eltern waren alt geworden, er verrichtete die ganze Arbeit auf dem Hof allein. Dennoch hatte er ihretwegen den Umweg von Plasselb nach Rechthalten genommen, eine Strecke, die man zu Fuss in gut einer Stunde zurücklegte. Roschi sah aus, als hätte er heute keine halbe Stunde gebraucht. Erschöpft sank er in die Knie, nahm sein Stofftuch aus dem Hosensack und fuhr sich damit über Gesicht, Hals und Nacken. Man konnte ihm wohl nicht vorwerfen, sich nicht beeilt zu haben.
«Wie lange bist du schon da?», fragte er keuchend.
«Seit neun Uhr.»
«Es ist also schon neun Uhr?»
«Jetzt nicht mehr.»
Roschi stiess die Luft aus. Er hatte es wieder einmal nicht geschafft. Vielleicht musste er sich doch angewöhnen, auf die Kirche zu hören.
«Es tut mir leid», sagte er.
«Schon gut», winkte Christina ab, «so hatte ich viel Zeit, mich mit reizenden Männern zu unterhalten.»
«Und wie schneide ich im Vergleich zu ihnen ab?»
Sie sah ihn an. Die Konkurrenz war nicht besonders gross, aber reizend konnte man ihn heute wohl nicht nennen. Er trug eine lange weisse Hose, darüber einen braunen Rock, ein gelbgestreiftes Gilet, und über seine Schulter hatte er sich eine heiterbraune Weste geworfen. Sein Haar war zu lang geworden und geriet ausser Form, und um sich ordentlich zu rasieren, hatte ihm wohl wieder einmal die Zeit gefehlt. Nein, Roschi besass keinen ausgeprägten ästhetischen Sinn. Äusserlichkeiten schienen an ihm abzuprallen. Das mochte sie an ihm.
Sie hatten sich auf dem Kartoffelfeld kennengelernt. Wie Roschi sich damals mit ihr unterhalten hatte, ganz unaufdringlich und doch voller Anteilnahme, hatte sie fasziniert. Er hatte sie wie eine ganz normale Kartoffelleserin behandelt. Auf jeden Fall nicht wie eine schöne Frau.
«Du hältst dich recht gut», antwortete Christina verschmitzt, «jedenfalls, wenn du den Rock ausziehen würdest.»
«Gefällt er dir nicht?»
«Hm. Du hast sicher ganz schön heiss damit.»
Also zog Roschi den Rock wieder aus und steckte ihn in seinen Lederbeutel. Den Weg von Plasselb nach Rechthalten war er nicht in diesem schweren Rock gerannt, er hatte ihn erst beim Farneraholz angezogen. Um ihr zu gefallen. Es schien nicht gelungen zu sein.
«Jetzt sehe ich einen ziemlich reizenden Mann», sagte Christina. «Mit dem ich endlich auf den Markt gehen möchte.»
«Also, gehen wir!», sagte er entschlossen.
Natürlich verlor er kein Wort über ihre schöne weisse Bluse, über ihren schönen blauen Rock, über ihre schönen blonden Haare, die unter dem Strohhut hervorsahen. Sie nahm ihn bei der Hand, zog ihn an sich heran, roch ein Gemisch aus Seife, Schweiss und Stall und wollte ihm einen Kuss auf den Mund geben. Doch er bremste sie.
«Was ist denn?», fragte sie verwundert.
«Später … Ich bin bachnass. So will ich dich nicht küssen.»
Wieder nahm er das Stofftuch und tupfte sich damit das Gesicht ab.
«Ich ekle mich doch nicht vor deinem Schweiss», sagte sie und unternahm einen zweiten Versuch, wurde von Roschi aber erneut zurückgewiesen.
Da roch sie den Schnaps. Das war eigenartig. Roschi trank selten, jedenfalls nicht am Morgen, nicht allein und schon gar nicht, wenn er sich mit ihr traf. Sie vertraute ihm doch. Er belog sie doch nicht. Wenn er am Morgen gearbeitet, sich umgezogen und von Plasselb nach Rechthalten gelaufen war – dann hatte er doch keine Zeit gehabt, um mit jemandem zu trinken? Aber er roch schwach und unverkennbar nach Schnaps. Christina fragte sich, ob die Verspätung, der ausgebliebene Kuss und der Schnapsgeruch mit einer Sache zusammenhing, von der sie nichts wissen sollte. Sie zogen los in Richtung Stadt.
4.
An jenem 3. Mai 1820 waren auch vier junge Männer aus Guggisberg unterwegs. Mit einem geliehenen Ross und einem gestohlenen Wagen holperten sie im Schritttempo durch die Gegend und fanden, dass die Reise ruhig etwas schneller vorangehen dürfte, zumal sie ja eigentlich auf der Flucht waren. Den Wagen hatten sie letzte Nacht aus der Scheune eines schwerhörigen Bauern entwendet, ein Abenteuer, das so nicht nötig gewesen wäre, denn das klapprige Gefährt aus morschem Holz hätte man wohl geschenkt bekommen, wenn man danach gefragt hätte. Das Pferd hingegen wollte der Besitzer bestimmt zurückhaben, doch was bedeutete das schon? Jeder wollte irgendetwas, die Armen wollten Geld, die Jünglinge eine Frau, die Hunde einen Knochen. Und sie, sie wollten eben nicht mehr in Guggisberg bleiben. Sie wollten ins Welsche oder besser in ein noch ferneres Land, am liebsten eigentlich ans Meer.
Der Kutscher – zumindest hatte er sich zu Beginn der Reise stolz zum Kutscher ernannt, obwohl es sich beim alten Wagen nicht im Geringsten um eine Kutsche handelte – schluckte schwer, seit sie Guggisberg verlassen hatten. Seine Heimat war ihm doch teurer, als er vermutet hatte, und jeder Blick zurück, mit dem er noch einmal und noch ein letztes Mal das Guggershorn in Augenschein nahm, versetzte ihm einen Stich ins Herz. Gelegentlich sprach er dem Pferd ermundernde Worte zu, doch eigentlich richtete er sie an sich selbst. Der Jüngste von ihnen lag auf der Ladefläche des Wagens und schlief. Ein ins Gesicht gezogener Hut schützte ihn vor der Sonne und verbarg seine Träume, die sich manchmal in seinem Gesicht abzeichneten. Und ganz hinten, rückwärtsfahrend und mit in der Luft baumelnden Beinen, sassen zwei Knechte namens Etter und Mosimann nebeneinander. Bei den beiden ging es wesentlich lebhafter zu und her als beim wehmütigen Kutscher und dem jungen Hostettler, der immerhin leise schnarchte. Sie führten ein philosophisches Gespräch über die Frauen der Region. Mit dem Ergebnis, dass man ihnen keine Träne nachweinte.
«Es ist doch wahr», sagte Etter mit einer verächtlichen Armbewegung. «Die Frauen bei uns. Schwarze Zähne, ledrige Haut, die Haare voller Läuse.»
«Dreckige Fingernägel.»
«Krumme Beine.»
«Schnurrbärte.»
«Dicke Hintern.»
Jetzt wäre wieder Mosimann dran gewesen. Dass ihm nichts mehr einfiel, lag gewiss nicht an den Frauen im Bernbiet, sondern an seiner Müdigkeit. Also lachte er einfach, ein Lachen, das bedeutete, dass die Aufzählung noch ewig zu ergänzen wäre. Etter lachte mit und berichtete anschliessend, was er sonst noch über die Frauen und ihr Aussehen aufgeschnappt hatte: «Hier in der Gegend, da hat Gott noch geübt. Da hat er selber noch nicht gewusst, was eine schöne Frau ist. In Brasilien und Amerika aber, da hat er sein Handwerk dann beherrscht.»
Mosimann stellte sich vor, wie die Frauen in Brasilien und Amerika aussehen mochten. All die Makel, die man vorhin aufgezählt hatte, fand man dort nicht. Und da es in diesen Ländern nie kalt war, warfen sich die Frauen bestimmt auch nicht in eine dicke Kluft. Und sie waren fröhlich, gesellig und offenherzig, denn dort gab es keine Sorgen.
«Den Beutler von Bodenacker habe ich auch gefragt», sagte Etter. «Ob er mit uns mitkommen will, in ein Land wo es schöne Frauen gibt. Weisst du, was er geantwortet hat?»
Mosimann schüttelte seinen Lockenkopf.
«Er sagte, nein, ihm gefallen die Frauen hier.»