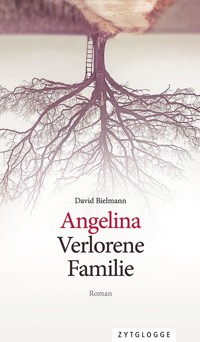
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lenzerheide, 1824. Johann Friedrich Moser wird mit siebzehn Jahren zum ersten Mal Vater. Er lässt sich mit seiner Familie auf einem abgelegenen Hof nieder und arbeitet als Abdecker. Es folgen zehn weitere Kinder. Ein Jahrhundert später wird die 8-jährige Angelina Eugster, eine Nachfahrin von Johann Friedrich, durch das halbstaatliche «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» ihrer Familie entrissen und aus Graubünden fortgebracht. Die theoretische Grundlage dafür bildet eine eugenische Schrift, die der Psychiater Johann Josef Jörger über die Familie Moser verfasst hat. Während Angelina über Umwege in verschiedenen Heimen in den Kanton Freiburg kommt, sucht die Mutter Maria Ursula verzweifelt nach ihrer Tochter. David Bielmann folgt den Spuren seiner Ahnen, von Obervaz über Basel, Zürich, Bern, Lugano und Strassburg nach Rechthalten – und erzählt dabei ein unheimliches Stück Schweizer Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
Erster Teil
1824–1884
___
Johann Friedrich Moser (1807–1888)
Marianna Moser (1830–1884)
Paul Fidel Parpan (1830–1875)
Abraham Markus (1807–1888)
Franciscus Parpan (1866–?)
Johann Josef Jörger (1860–1933)
Zweiter Teil
1918–1926
___
Auguste Forel (1848–1931)
Maria Ursula Eugster (1901–1972)
Florian Mattli (1890–1945)
Alfred Siegfried (1890–1972)
Ulrich Wille junior (1877–1959)
Dritter Teil
1926–1930
___
Engelina Eugster-Parpan (1874–1935)
Nicolo Jochberg (?–1963)
Gion Gisep Candreia (1892–1984)
Robert Speich (1902–1972)
Helene Bielmann (1888–1962)
Vierter Teil
1931–1937
___
Jacob Eugster (1864–1937)
Peter Kilchör (1883–1936)
Gaudenz Canova (1887–1962)
Robert Bielmann (1879–1946)
David Frankfurter (1909–1982)
Olga Waser (Name geändert, Lebensdaten unbekannt)
Fünfter Teil
1939
___
Eduard Neiger (1876–?)
Emilio Arigoni (Name geändert, 1900–1965)
Angelina Eugster (1921–2014)
Nachträge
___
Nachträge - Text
Zitierte Quellen
Weitere Quellen (Auszug)
Über den Autor
Über das Buch
DAVID BIELMANN
ANGELINA
Der Autor und der Verlag danken für die Unterstützung:
Gemeindeverband Region Sense
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
© 2023 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, BaselAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Angelia SchwallerKorrektorat: Tobias WeskampCoverbild: © Simon Berger auf Pixabay
David Bielmann
ANGELINA
Verlorene Familie
Roman
Erster Teil
1824–1884
___
«Reis du ins Graubündner Land,
das ist das Athen der heutigen Gauner.»
Johann Friedrich Moser (1807–1888)
Lenzerheide, Graubünden
1824
Im Alter von siebzehn Jahren durchtrennte Johann Friedrich Moser mit dem Messer, das er tagsüber zum Häuten von Tierkadavern benutzte, seinem ersten Sohn die Nabelschnur.
Die Mutter besass schon mehr Lebenserfahrung als der jäh zum Vater gewordene Jüngling: Eugenia war zweiundzwanzigjährig und hatte bereits die Pocken und die Franzosen durchgemacht. Doch auch für sie war es die erste Geburt, und als sie danach wie tot im von Fruchtwasser und Schweiss und Blut durchtränkten Stroh lag, war sich Johann Friedrich sicher, dass sie diese Tortur kein zweites Mal erdulden würde.
Aus dem Tal war eine zerfurchte Frau gekommen, die innerhalb eines Jahres ihren Mann und zwei Töchter verloren hatte und sich nun als Hebamme anbot, um etwas gegen den Tod zu unternehmen. Kaum war es da, kümmerte sie sich um das blutige Bündel, wusch es mit etwas gar kräftigen Handgriffen und wickelte es in das Lammfell.
Gebannt sah Johann Friedrich ihr zu und dachte, dass es fahrlässig gewesen war, diese vom Unglück umrankte Person ins Haus zu bestellen. Darüber vergass er völlig, sich um seine Frau zu kümmern, deren Schreie plötzlich verstummt waren. Erleichtert stellte er fest, dass sie blinzelte. Er trocknete mit seinem Hemdärmel ihr Gesicht, behutsamer, als die Hebamme das Kind gewaschen hatte, hielt ihre Hand fest, suchte nach Worten, fand keine.
Johann Friedrich Moser kannte sich mit toten Tieren und kaputten Kesseln aus, aber nicht mit Neugeborenen und Frauen, die eben entbunden hatten. Seit Eintritt der Wehen hatte er alles darangesetzt, sich an der Aufgabe zu beteiligen, und doch fühlte er sich die ganze Zeit hilflos, um nicht zu sagen: überflüssig. Ein Becher Wasser, ein liebes Wort, ein Streichen über die Wange – keine von seinen Handlungen war von wirklichem Nutzen gewesen. Eugenia hatte das gemeinsame Kind allein zur Welt gebracht.
So blieb sein wichtigster Beitrag zur gelungenen Geburt die Säuberung des Ziegenstalls. Schon Tage zuvor hatte er die drei Ziegen tätschelnd auf das Himmelsdach eingestimmt und sie auf die zugefrorene Wiese geführt, er hatte den Stallboden gewischt, mit heissem Wasser geschrubbt und grosszügig mit Stroh belegt. Eugenia konnte sich am Tag der Niederkunft über die Schmerzen, über Gott und dessen ganze Natur beklagen, nicht aber über die liebevoll vorbereitete Geburtsstätte.
Später trug Johann Friedrich seine erschöpfte Frau vom Stall in die Stube. Die Hebamme brachte das Kind, legte es der Mutter auf die Brust, und zu Johann Friedrichs Entsetzen verabschiedete sie sich daraufhin. Sie wollte ihn bereits allein mit den beiden lassen? Aber das Kind lebte, die Mutter auch, und die Hebamme gab sich hoffnungsvoll, dass sich daran über Nacht nichts ändern würde.
Nachdem sie gegangen war, setzte er sich an die Bettstatt und hörte, wie das Kind atmete – sein Sohn, der noch kaum etwas anderes konnte als atmen. Er sollte Johann Friedrich heissen, was er angesichts der geringen Strapazen, die er im Vergleich zu seiner Frau erlitten hatte, etwas ungerecht fand. Es war eine Ehre, die er im Grunde nicht verdiente. Aber was wollte man, das Kind war nun mal ein Junge und kein Mädchen. Eugenia drehte den Kopf zum Mond, der im Fensterrahmen hing, da fiel ihm ein, dass man den Jungen auch Eugen hätte nennen können. Eugenias Vater hiess so und hatte ihr den Namen damals aus Verzweiflung gegeben, da er keine Söhne bekam. Mit einem Eugen hätte man die missglückte Familiengeschichte wieder einigermassen zurechtgebogen. Allerdings konnte man sich auch nicht alle Probleme der Vorgeneration aufhalsen. Er bemerkte, dass er an einem Eugen viel weniger Freude gehabt hätte als an einem Johann Friedrich – und dass er den Namen seines Sohnes wohl zur Bestimmung erhoben hatte, um sein Gewissen zu entlasten. Eine Weile noch hörte er dem beständigen Atem zu, und plötzlich bekam er Angst.
Leise stahl er sich aus der Stube und schritt hinaus in die kalte Novembernacht. Aus einem Hohlraum im Vordach zog er die Flasche Kräutergeist hervor, die er sich für aussergewöhnliche Tage aufbewahrte. Er hielt sie gegen den Mond und stellte erschrocken fest, wie tief der Pegel stand, dabei hatte es in vergangener Zeit kaum aussergewöhnliche Tage gegeben. Vielmehr hatte er aus fadenscheinigen Gründen die gewöhnlichsten Tage zu aussergewöhnlichen erklärt. Heute aber musste er sich nichts vormachen: Noch bevor er sich auf die Bank setzte, nahm er einen grossen Schluck und – da sich das recht gewöhnlich anfühlte – gleich noch einen.
Ruhe und Dunkelheit hatten sich über das Land gelegt. Ein paar Holzpfähle, die im Sommer einen Zaun bildeten, steckten teilnahmslos in der Erde. An den Abhängen rundherum zeichneten sich die Umrisse dunkler Wälder ab, und unten im Tal lag ein Schimmer auf dem Vazersee.
Es war alles schnell gegangen. In einer Spelunke in Bregenz war er ihr letzten Herbst auf den Fuss getreten, einer Frau mit pechschwarzem Haar und himmelblauen Augen. Sie hatten zusammen einen Krug Wein getrunken, dann getanzt zu den verträumten Liedern eines Barden, und dann waren sie ein paar Tage gemeinsam durch Kälte, Wind und Regen marschiert bis zur Lenzerheide, wo Johann Friedrichs Vater einst einen Stall gebaut hatte. Es gefiel ihm, sie bei sich zu haben, und sie sah offenbar über sein junges Alter hinweg, weil er recht kräftig war vielleicht und bereits Bartwuchs aufwies. Sie hatten nie über sich und die Zukunft gesprochen. Sie war einfach bei ihm geblieben, und jetzt waren sie eine Familie. Es war schnell gegangen.
Als die Flasche leer war und er immer noch Tatendrang hatte, nahm er die Mundharmonika aus der Hemdtasche. In die Stille spielte er eine Melodie, die er schon von seinem Vater gehört hatte, und der hatte sie einst auf Wanderschaft aufgeschnappt, in einer Gaststätte im Piemont oder von Vagabunden in den Vorarlberger Wäldern. Es war eine schöne Melodie, die ihn glücklich machte, die ihn traurig machte, beides zur gleichen Zeit, weshalb er nicht wusste, ob er weiterspielen sollte. Er versuchte, sein Spiel ein wenig abzuändern, und schon klang die eben noch schöne traurige Melodie schief, doch die Melancholie blieb in der Luft, und Johann Friedrich fürchtete, dass nicht allein die Melodie schuld daran war.
Er richtete den Blick nach oben und sah die sieben hellen Sterne, die in der immergleichen Anordnung leuchteten, als wären sie miteinander verkettet. Es war der Grosse Wagen, der beständig wie der Mond seit Urzeiten über den Nachthimmel fuhr, und da wurde Johann Friedrich vom Gefühl getragen, dass auch er von nun an mit allem verbunden war. Er war ein Teil der ewigen Kette geworden, das Mühlrad, auf das alle Schicksale seiner Vorfahren zuflossen und aus dem alle Schicksale seiner Nachkommen herausströmten. Er hatte die Fäden der Vergangenheit mit jenen der Zukunft verwoben, in den Lauf der Geschichte eingegriffen, das Universum verändert. Und jetzt sah er die abertausenden Sterne am Himmel funkeln, wie von einer mächtigen Hand hingeworfen, um den Menschen eine leise Ahnung des Mysteriums zu geben, unter dessen Schleier sie lebten und starben. Johann Friedrich atmete fiebrig, die Kälte schnitt ihm in die Kehle, und als er an den Sternen vorbei in die Unendlichkeit sah, spürte er das Gewicht des ganzen Weltalls auf seinen Schultern.
Benommen vom Schnaps und von der Schwere, die auf dem ganzen Tal lastete, hörte er eine Stimme. Sie klang zart und allwissend und trug ihm auf, den Hang hinunterzumarschieren, in Richtung Süden zu ziehen und nicht mehr zurückzukommen. Johann Friedrich liess die Stimme, liess die Gedanken zu, er stellte sich vor, den Hof zu verlassen, jetzt sofort, und mit ihm die Arbeit, die Frau, das Kind, die Vergangenheit und die Zukunft, um draussen in der Welt jemand zu werden, den es noch nicht gab. Oder der zu sein, der er wirklich war.
Er stand auf und schwankte zum nahen Schuppen. Ein Rabe flatterte krächzend vom Dach, als Johann Friedrich die knarrende Tür aufmachte. Er trat hinein ins Fliegengesurr, hob die frischgeschliffene Truhe auf und brachte sie hinaus ans Mondlicht.
Er öffnete den Deckel. Dutzende Knochen lagen darin, die er sorgfältig gehäutet, abgefleischt und gekocht hatte. Eine Rindermittelhand, ein Ziegenhorn, ein Marderschädel, ein Pferdehufbein, Schweinezähne, Fuchsrippen, Hundespeichen, ein beinahe vollständiges Rattenskelett ... Das war das Leben, dachte er, das Leben auf Erden. Sein Sohn würde Freude daran haben. Schon bald. Johann Friedrich nickte und versorgte die Truhe wieder im Schuppen. Sein Atem hatte sich beruhigt.
Hinter dem Ziegenstall fand er die Ziegen. Schutzsuchend hatten sie sich gegen die Wand gedrückt und dämmerten so dicht beieinander dahin, dass sich ihre Hörner beinahe verkeilten. Froh darüber, dass alles vorbei war, führte er eine Ziege nach der anderen zurück in den Stall. Sie meckerten dankend.
Marianna Moser (1830–1884)
Lenzerheide, Graubünden
1836
«Johann Friedrich, komm, komm einmal, komm einmal her!», rief Vater aus dem Ziegenstall, und sein Gestotter deutete an, dass etwas Grosses geschehen war.
Marianna kauerte hinter dem Holunderstrauch und spähte in den Spalt der nachlässig zugeschobenen Tür. Sie sah, wie Vater im Licht der Öllampe durch den Stall geisterte. Ein angenehmer Schauer befiel sie.
Früher, noch vor Mariannas Geburt, hatte Vater Ziegen im Ziegenstall gehalten. Jetzt aber gehörte der Ziegenstall Vater allein, und wenn er darin arbeitete, durfte man ihn nicht stören, um keine seiner Erfindungen zu gefährden. Mal entwickelte er ein Arzneimittel, um die Kopfschmerzen des Hundes zu lindern, mal kam er spätabends mit einem Messer heraus, das man einklappen konnte, damit es nur dann schnitt, wenn man es wollte. Manchmal aber, nach stundenlanger Arbeit, hatte er bloss zerzaustes Haar. Der Ziegenstall war ein magischer Ort voller Überraschungen. Und jetzt rief Vater aufgeregt nach Johann Friedrich.
Doch er kam nicht. Natürlich kam er nicht, das wusste Marianna, er war vor knapp einer Stunde talabwärts marschiert.
«Franz! Mathias!», rief Vater weiter, und bereits vibrierte die Ungeduld in seiner Stimme.
Auch sie kamen nicht. Franz und Mathias hatten Johann Friedrich begleitet, zum Salpetersieder nach Churwalden, Vater selbst hatte sie geschickt, doch je konzentrierter er im Ziegenstall herumtüftelte, umso weniger begriff er die Welt.
Marianna begann sich über die Abwesenheit ihrer Brüder zu freuen. Wenn alles mit rechten Dingen zuging, dann würde Vater jetzt nach ihr rufen, denn von den sechs Kindern war sie die viertälteste, nur zwei Jahre jünger als Mathias und schon fast gleich gross – doch statt ihren Namen hörte sie einen Fluch, der ihr klarmachte, dass Vater keinen Augenblick an sie dachte.
Enttäuscht biss sie sich auf die Unterlippe. Sie fand, dass es an der Zeit war, auch allmählich ins Familiengewerbe eingebunden zu werden. Sie war jetzt sechs Jahre alt und kein kleines Kind mehr. Aber das Sagen hatte hier derjenige, der seine Söhne suchte, die er eben ins Tal geschickt hatte.
«Marianna!», rief Vater zu ihrer Freude schliesslich doch.
Sie fuhr hoch, rannte zum Stall und antwortete vor der Tür: «Ja?»
Vater drehte sich erstaunt um, dabei hatte er doch nach ihr gerufen. «Wo sind Johann Friedrich, Franz und Mathias?», fragte er.
«Beim Salpetersieder.»
«War das nicht morgen?»
«Vor einer Stunde. Also heute.»
Obwohl sie wusste, dass Vater sie hier für gewöhnlich nicht duldete, trat Marianna einen Schritt vor und sah sich um. Im kleinen Stall, der von der kleinen Lampe dumpf ausgeleuchtet wurde, herrschte ein riesiges Chaos. Auf dem Boden lagen Kessel und Pfannen, Feile, Zange und Hammer, ein zerbrochenes Rad, ein Amboss, ein Fass, ein Fuchsfell. Unter einem Hocker, dem ein Bein fehlte, pickte ein Huhn auf ein Stück Leder ein. Durch das offene Fenster wucherten Brombeeren. Vater jedoch tat so, als wäre hier alles in bester Ordnung. Seine ganze Aufmerksamkeit galt einem Schemel, auf dem sich ein verbeulter Gegenstand darbot. Er ähnelte einer Glocke.
«Ich habe eine Glocke gegossen, Marianna!», sagte Vater begeistert.
Marianna strich sich die Haare hinter die Ohren. Unversehens war sie in der Familienhierarchie um drei Ränge vorgerückt und zu Vaters Vertrauten geworden, damit änderte sich alles. Sie spürte, dass sie jetzt nicht alles sagen durfte, was sie dachte. Fraglos war Vaters Erfindung, für die er mehrere Mahlzeiten ausgelassen hatte, eine Enttäuschung. Aber es stand zu befürchten, dass ein solches Urteil vor allem seine Meinung über Marianna gebildet hätte, nicht jene über die Glocke. Vorerst ging es also allein darum, ihn nicht zu enttäuschen. «Gegossen? Wie?»
Vaters Lächeln zeigte, dass sie voll ins Schwarze getroffen hatte. Sein Blick wurde wärmer, und zum ersten Mal, seit sie bei ihm im Stall war, sah er sie richtig an. Das war wieder der Vater, der am Esstisch sass und wusste, was seine Kinder taten – der Vater, den Marianna eigentlich lieber mochte als den verrückten Erfinder.
«Weisst du», sagte er, «wenn man alte Sachen ganz heiss macht, Sachen, die niemand mehr braucht, kaputte Kessel, zerbrochene Werkzeuge, dann verlieren sie ihre Form, sie werden zu einer Flüssigkeit. Und daraus kann man alles machen, was man sich wünscht.»
«Alles?»
«Alles.»
«Auch eine Geige?», entfuhr es ihr.
Vaters Eifer erlitt einen Dämpfer. Er wühlte in seinem immer wilder wuchernden Bart, als suchte er darin etwas, dann sagte er: «In gewisser Weise, ja. Denn eine Glocke kann ich zu Geld machen. Und das Geld zu einer Geige.»
Das fand Marianna reichlich umständlich, behielt es aber gerade noch für sich. «Und warum hast du ausgerechnet eine Glocke gemacht?», fragte sie.
Vater runzelte die Stirn. «Jetzt pass einmal auf», sagte er. Er hob die Glocke, die etwas grösser war als eine Birne, in die Luft. Dann wartete er wieder, machte es übertrieben spannend, sodass Marianna ganz verlegen wurde. Eine Glocke war eine Glocke, das Einzige, was man aus ihr hervorzaubern konnte, war ein Glockenschlag. Andererseits musste man bei Vater immer auf alles gefasst sein. Endlich schüttelte er das Handgelenk, der Klöppel schlug gegen den Rand.
Vater strahlte.
Marianna schwieg.
Das Huhn döste selbstvergessen vor sich hin.
«Was siehst du?», fragte Vater mit einer Aufregung, die Marianna einschüchterte. «Sag mir, was du siehst, wenn du diesen Klang hörst!»
«Die Glocke?»
«Ja, aber woran denkst du bei diesem Klang?»
Während sie nachdachte, liess er noch einen weiteren Gong folgen, der erneut sofort in der Luft erstickte. Sie hatte eine Idee, aber sie wusste nicht, ob sie es sagen sollte.
«Und?»
«Ich denke an einen Stein, den ich ins Wasser werfe.»
Vater stellte die Glocke zurück auf den Schemel und bedeutete Marianna mit einem Nicken, dass ihre Zeit im Ziegenstall abgelaufen war.
Doch die leise Kritik schien nicht spurlos an ihm vorbeizugehen, denn schon am Nachmittag trennte er für einen neuen Versuch das Metallblatt vom Schaufelstiel und schmolz es über dem Feuer. Marianna sass daneben im Gras und verfolgte das Geschehen ohne Hoffnung, dass daraus je eine Geige werden würde, als sich dem Hof ein Mann, ein Junge und ein Pferd näherten.
Kurz vor dem Schinderschuppen blieb das Pferd stehen, schwankte und warf eine schleimige Flüssigkeit aus dem Maul. Der Mann stellte sich als Parpan vor. Er sprach leise, zeigte mit dem Kinn unauffällig zur Seite, als bemühte er sich gegenüber dem Tier um Diskretion, und wünschte sich eine rasche Heilung.
«Das Pferd ist mir teuer», sagte er. «Ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen. Aber ich habe nicht viel.»
Vater winkte ab, ging um das Pferd herum und tastete ihm mit der flachen Hand den Bauch ab.
Derweil musterte Marianna den Jungen. Er war schmächtig, die Kleider baumelten an seinen Gliedern. Sein schielender Blick strauchelte durch die Gegend und konnte sich nirgends festhalten. Auch er sah alles andere als gesund aus.
«Etwas stimmt mit ihm nicht», sagte Vater fachkundig. Er meinte das Pferd. «Ich vermute, die Lungensucht.»
«Und was heisst das?», fragte Parpan.
«Dass ich es pflegen muss.» Er versicherte sich mit einem abschliessenden Handgriff seines Befunds, kniff die Augen zusammen und nickte. «Marianna», sagte er, «suchst du mir etwas Brunnenkresse? Und zwei Hände voll Körbelkraut.»
Das war das Gute an seiner Vergesslichkeit: Er verzieh schnell. Sie eilte ins Haus, um den Korb zu holen, den Mutter kürzlich geflochten hatte. Er war etwas zu gross für sie, verlieh ihrem Tun aber umso mehr Gewicht.
«Was hast du vor?», fragte Mutter. Sie sass mit dem kleinen Josef am Boden, vor ihnen lagen die Spielfiguren aus der Truhe.
«Ein Pferd heilen!», sagte Marianna und brach auf.
Vater hatte das gewölbte Schaufelblatt aus dem Feuer genommen und einen Kessel bereitgestellt. Parpan und der Junge standen betroffen daneben. Das Pferd hatte sich hingesetzt.
«Paul Fidel, geh doch mit dem Mädchen mit!», sagte Parpan.
Der Junge sah ängstlich zu ihm hoch.
«Nun geh schon!»
Marianna wollte ihn bei der Hand nehmen, da zog er sie erschrocken zurück. Sie hatte keine Zeit für solche Mätzchen, dabei war es doch sein Pferd, nicht ihres. Sie schritt auf die Wiese zu, und als sie zurückblickte, sah sie, dass er ihr widerwillig folgte.
Was hier vorging, erfüllte sie mit Stolz. Immer öfter kamen fremde Leute mit ihren kranken Tieren vorbei und ersuchten Vater um Hilfe. Wenn es den Tieren schlecht ging, dann waren ihre Besitzer meist ratlos, da sie nicht wussten, wie es im Inneren der Tiere aussah. Vater aber wusste es. Er war ein angesehener Mann geworden, da er wusste, wie die Herzen der Tiere schlugen, wie ihre Muskeln arbeiteten und wie sich ihre Sehnen durch den Körper spannten. Und sie war seine Gehilfin, da sie die Pflanzen kannte, die rundherum wuchsen – da sie echte von falscher Brunnenkresse und Körbelkraut von Petersilie unterscheiden konnte.
Das Wiesengras reichte ihr bis zur Hüfte und kitzelte sie an den Unterarmen. Sie sah die gelben Blüten einer Königskerze, Gamander, Huflattich, einen blühenden Schlangenknöterich. Sie roch den Duft von Teufelskrallen und Tausendgüldenkraut, strich an einem Löwenschwanz vorbei, am dornigen Stängel einer Hauhechel, und schliesslich entdeckte sie im Schatten der Fichten eine verdächtige Pflanze. War es bloss Schafgarbe? Sie zupfte ein Blatt ab, legte es sich auf die Zunge und wartete, bis sich das Aroma entfaltete. Es schmeckte nach Anis, und auch ein bisschen nach Fenchel, kein Wunder, denn Anis schmeckte ja ähnlich wie Fenchel und Fenchel ähnlich wie Anis, aber wie auch immer, wenn das kein Körbelkraut war, dann war sie kein Mädchen.
Sie pflückte zwei Büschel, während Paul Fidel durch die Bresche angelaufen kam, die sie ins Gras geschlagen hatte. Er schielte skeptisch auf das Kraut in ihren Händen.
«Willst du mal riechen?», fragte sie. Sie hatte den Drang, ihn in die Komposition der Arznei einzubinden, damit er sich endlich auch ein wenig begeisterte.
Paul Fidel schüttelte den Kopf.
Hatte er Angst? Sollte sie ihm eine Baldrianwurzel anbieten, damit er sich beruhigte? Marianna verwarf den Gedanken und zog weiter. Paul Fidel sah zurück zum Hof.
Am Ufer des Bächleins, das ins Tal hinabfloss, stiess Marianna wie erhofft auf ein dichtes Feld an Brunnenkresse. Um sicherzugehen, sank sie auf die Knie, nahm einen tiefen Atemzug, spürte das Jucken, das langsam die Nase hochstieg, die Augen überlaufen liess und in ein Niesen mündete.
Ganz angetan von ihren Praktiken zur Pflanzenerkennung, in die Mutter sie eingeweiht hatte, legte sie eine Handvoll Brunnenkresse in den Korb.
Bevor sie zurückkehrten, versperrte Paul Fidel ihr auf einmal den Weg. Sie bemerkte, dass er sich Mühe gab, sie entschlossen anzusehen. Beinahe schaffte er es.
«Wer seid ihr?», fragte er mit zitternder Stimme.
«Wie meinst du das?»
«Was für Leute seid ihr?»
«Wir sind Doktoren», sagte sie ohne Aufhebens.
«Stimmt es, dass das alles hier ein grosser Friedhof ist?»
«Du meinst den Tierhimmel. Der liegt gleich da hinten.» Sie gab die Richtung mit dem gestreckten Arm an. «Willst du ihn sehen?»
«Was habt ihr dort alles begraben?»
«Kühe, Schweine, Schafe, Wölfe, Hunde, Füchse – alle Tiere, die du kennst.» Natürlich gab es im Tierhimmel auch Pferde. Sie verschwieg es, da man ja auf die Heilung von Paul Fidels Pferd hinarbeitete. Um die Lücke zu füllen, die dadurch entstand, hatte sie Wölfe genannt, obwohl es hier gar keine Wölfe gab.
«Wölfe?»
«Ja, mit grossen spitzen Zähnen.»
«Und Pferde?»
«Nein. Wir wissen, wie man Pferde heilt.»
«Und Menschen?»
«Nein!»
«Ich habe es gehört. Dass ihr hier auch Menschenleichen verscharrt.»
«Unsinn. Es ist der Tierhimmel. Komm!»
Sie erreichten eine weitläufige, von Tannenwald umhegte Wiese in üppigem Grün. Viele bunte Blumen wiegten sich im Wind, und die Tauperlen im Gras schimmerten in allen Regenbogenfarben. Das Land ohne Schmerzen. Das Paradies. Der Tierhimmel.
Paul Fidel schien sich schon von der Idylle des Ortes überzeugen zu lassen, bis er plötzlich rief: «Da! Da sind Menschen!»
Tatsächlich. Aus einer Senke am anderen Ende der Wiese ragten drei Köpfe heraus. Doch sie bewegten sich. Sie lebten. Es waren Johann Friedrich, Franz und Mathias.
«Das sind meine Brüder. Komm!»
«Wir sollten zurückgehen», sagte Paul Fidel.
Auf seiner Stirn glänzte die Angst. Aber er hatte auch Angst, hier oben allein über die Wiesen zu streifen. Deshalb folgte er ihr, als sie den Brüdern entgegenrannte. Sie hatten sich in einem Erdloch versteckt, das Vater bereits ausgehoben hatte. Einem künftigen Grab.
«Wer ist das?», fragte Johann Friedrich unwirsch, als Marianna eintraf und bald, mit etwas Verspätung, auch der schweissüberströmte Fremdling.
«Das ist Paul Fidel. Sein Pferd ist krank.»
«Paul Fidel? Wer heisst schon Paul Fidel?», sagte Johann Friedrich und lachte.
«Sagt Johann Friedrich», sagte Marianna.
«Er schielt», sagte Johann Friedrich zu seiner Verteidigung.
«Er ist nett», sagte Marianna, obwohl es gar nicht stimmte. Aber wenn sie sich jetzt auf die Seite ihrer Brüder schlug, war er endgültig verloren.
«Na, Paul Fidel.» Galant deutete Johann Friedrich auf die zwei Flaschen, die vor ihm halb versunken in der Erde standen. «Willst du von unseren Wundertränken probieren?»
Franz und Mathias lachten.
«Du hast die Wahl», sagte Mathias. «Mit dem einen Trank kannst du fliegen. Mit dem anderen wirst du unsichtbar.»
Johann Friedrich und Franz lachten.
«Dann trinkt doch selber», sagte Marianna, «und wir sind euch wieder los!»
Alle drei lachten – aber warum lachten sie eigentlich?
«Seht mal her», sagte Mathias und schnappte sich eine Flasche. Marianna erkannte sie. Es war die schmutzige Flasche mit dem dicken Hals, die Vater immer zwischen die Dachbalken schob. Mathias entfernte den Korken, atmete tief durch und spannte die Arme wie Flügel aus. Obwohl Vater immer sitzen blieb, wenn er aus der Flasche trank, war Marianna nun doch gespannt, was geschehen würde.
Mathias nahm einen Schluck. Für einen Augenblick schien alles möglich zu sein, hier im Tierhimmel, wo ja selbst die toten Tiere emporschwebten.
Aber dann begann Mathias zu husten und stürzte mit angewidertem Gesicht zu Boden.
«Das ist nichts für dich», sagte der zwölfjährige Johann Friedrich, nahm Mathias die Flasche weg und trank ebenfalls daraus. Danach geschah überhaupt nichts, genau gleich wie bei Vater. Routiniert verschloss Johann Friedrich die Flasche und stellte sie so achtlos ab, dass sie umfiel. Ungleich vorsichtiger ergriff er die andere Flasche, hielt sie ans Licht und betrachtete ihren Inhalt, als handelte es sich dabei um ein kostbares Elixier. Die rotbräunliche Flüssigkeit, die darin schaukelte, sah aus wie Melissentee.
Ihre Brüder waren Angeber, dachte Marianna. Niemand würde hier einfach so davonfliegen. Und niemand würde sich in Luft auflösen.
«Gib mal deine Halskette», sagte Johann Friedrich zu Franz.
«Vergiss es. Nimm deine», sagte Franz.
«Gib sie», sagte Johann Friedrich mit der Argumentation des Ältesten.
Franz nahm sich die blitzende Kette vom Hals und gab sie seinem Bruder.
Johann Friedrich liess die Kette an seinem Zeigefinger hin- und herpendeln, bis sie stillstand. Dann zielte er sie in den Flaschenhals, blickte noch einmal in die Runde und zog den Finger weg.
Die Kette fiel in die Flüssigkeit, Marianna musste wieder an den dumpfen Glockenschlag denken, und in Johann Friedrichs Augen loderte der Vater auf. Mit glühendem Blick starrten sie auf die Glocke, starrten auf die Flasche, Vater mit jungenhafter Begeisterung, Johann Friedrich mit der Weisheit eines Mannes, und beide, ihr Bruder und ihr Vater, wurden Marianna während eines langen Atemzugs fremd und unheimlich.
Und plötzlich war sie weg.
Die Halskette, die eben noch auf dem Grund der Flasche gelegen hatte, war nicht mehr zu sehen. Dabei bestand kein Zweifel, dass sie auch jetzt noch dort lag. Sie war unsichtbar geworden. Der Trank funktionierte.
Es fiel kein Wort mehr. Alle waren fassungslos, und selbst Johann Friedrich, der doch den Spuk verursacht hatte, setzte die Flasche auf die Erde, betrachtete sie ungläubig aus allen Winkeln, um sich zu vergewissern, dass ihm weder das Sonnenlicht noch sonst jemand einen Streich spielte.
Nach einer Weile fühlte Marianna ein Zupfen am Ärmel. Es war Paul Fidel.
«Ja?», sagte sie.
«Das Pferd», flüsterte er.
Natürlich. Die beiden zogen vom Tierhimmel ab, und zum ersten Mal, seit sie gemeinsam unterwegs waren, ging Paul Fidel voran.
Vater kreiste bereits fingernägelkauend um das Feuer, als sie ankamen. Hastig, damit keine wertvolle Zeit verloren ging, warf er ein Stück Butter in den Kessel und erhitzte es, bis es zerfloss. Mit einem flüchtigen Blick prüfte er das Kraut, das Marianna gesammelt hatte, und gab es ebenfalls in den Kessel.
Hoffnungsvoll verfolgte Parpan die Arbeit des Doktors und streichelte, um auch etwas zu tun, beständig das Pferd. Paul Fidel, nun wieder dicht neben seinem Vater, ahmte ihn herzlos nach. Über die Halskette sagte er kein Wort, und das war, fand Marianna, ein weiser Winkelzug.
Nun war der Doktor ganz in sein Werk vertieft. Als das Kraut zu einer grünlichen Masse zerkocht war, fügte er Baumöl und einige Loth Hundeschmalz hinzu. Es begann zu blubbern, Vater rührte, und schliesslich goss er einen ganzen Schoppen Bier in den Kessel. Zischend stieg eine Rauchwolke auf. Paul Fidel hustete.
Vater liess die Arznei kurz abkühlen, dann schüttete er sie dem Pferd ins Maul.
«Die Lunge ist voller Eitergeschwüre», erklärte er, nachdem er während der Zubereitung kaum gesprochen hatte. «Die Arznei wird alles reinigen. Nach zwei Tagen ist das Pferd wieder gesund.»
Parpan bedankte sich erleichtert. Die Behandlung schien schon erste Wirkung zu zeigen, denn als sie den Heimweg antraten, strahlte das Pferd schon fast wieder eine Kraft aus, dass man es jeden Moment davonzugaloppieren glaubte, und sogar Paul Fidel spazierte unbesorgt hinterher.
Nach zwei Tagen war das Pferd tot. Es wurde geschlachtet, der Metzger konnte das Fleisch des kranken Tiers kaum verwerten, und dann brachten Parpan und Paul Fidel den Kadaver wieder zu Wasenmeister Moser. Sie sagten nichts und ihre Gesichter waren hart. Auch Marianna beobachtete das Trauerspiel betrübt, doch manchmal war es eben zu spät, das wusste sie. Manchmal war die höhere Gewalt stärker als die Könnerschaft eines Menschen. Dann bestattete Vater die Tiere im Tierhimmel, dort lebten sie weiter und hatten es besser als vorher. Das hätte Marianna Paul Fidel gerne erläutert, doch etwas empfahl ihr, zu schweigen.
Der überraschende Tod des Pferdes liess Vater keine Ruhe. Eingehend untersuchte er den Kadaver und fand schliesslich die Lungenwände von einer ungewöhnlichen Masse befallen – «Eitergeschwüre», sagte er zu Marianna, die ihm bei der Arbeit zusah, und er pfiff zufrieden unter seinem Bart hervor. Doch offenbar war dem Geschwür mit Brunnenkresse, Hundeschmalz und Bier nur bedingt beizukommen.
Eine riesige Haut spannte zwischen den Zaunpflöcken, als Marianna sich während des Sonnenuntergangs zu Vater auf die Bank setzte. Stumm sahen sie hinunter auf den See, auf die Tannen, die ihn säumten, auf die Wälder, die sich bis in die Berge hochzogen. Wie so oft, wenn etwas geschehen war, für das es keine Worte gab, nahm Vater die Mundharmonika hervor und begann zu spielen. Eine Weile ergaben auch seine Töne wenig Sinn, doch langsam fügten sie sich zu einer Melodie zusammen, die er mehrmals wiederholte. Sie gefiel Marianna, sie war schöner als die anderen Lieder, die er manchmal zu spielen versuchte, aber auch trauriger. Und obwohl die Tonfolgen einfach waren, so einfach, dass sie einem auch selber hätten einfallen können, schlossen sie etwas ein, etwas, das sie nicht enthüllen konnte. Die Melodie erzählte eine Geschichte, barg ein Geheimnis. Marianna fragte sich, was an dem Gerücht dran war, dass man im Tierhimmel auch Menschen begrub – Menschen, die man vielleicht vorher unsichtbar gemacht hatte? Sie dachte an Paul Fidel. Seine Angst, als sie ihm die Hand entgegenhielt, als wäre sie verteufelt. Gab es Dinge auf dieser Welt, von denen sie noch überhaupt nichts wusste?
«Bist du traurig?», fragte sie in die traurige Melodie hinein.
Vater setzte die Mundharmonika ab. «Nein, mein Goldschatz», sagte er, fuhr ihr übers Haar und lächelte.
Das kam Marianna nicht schlüssig vor. «Warum spielst du dann so?»
Er antwortete nicht mehr, spielte etwas anderes, das zwar weniger traurig, aber auch weniger schön war. Bald legte er die Mundharmonika weg, stand auf und griff in einen Hohlraum im Vordach.
«Hast du irgendwo eine Flasche gesehen?», fragte er.
«Eine schmutzige mit dickem Hals?»
«Ja.»
«Nein.»
«Nein?»
Sie musste schnell antworten, aber sie durfte ihre Brüder nicht verraten, sonst war sie erledigt. «Zuerst fragst du doch immer Johann Friedrich, Franz und Mathias», wich sie gekonnt aus.
«Ach, diese Bengel», sagte Vater kopfschüttelnd.
Marianna biss sich wieder auf die Unterlippe. Sie hätte mehr Zeit gebraucht. Ihre letzte Hoffnung war Vaters Vergesslichkeit.
«Wofür geht man eigentlich zum Salpetersieder?», fragte sie, um das Vergessen mit einem Themawechsel voranzutreiben.
«Für Säure.»
«Säure?»
«Morgen, Marianna. Morgen werde ich dir die Königin unter den Säuren vorstellen.»
Marianna nickte ratlos. Von Zorten her hörte man die Kirchenglocke läuten. Sie klang so, wie man es von einer Glocke erwarten durfte: Man hörte sie auch noch nach dem Anschlag des Klöppels.
«Deine Glocke ...» Marianna war eben eine Idee gekommen.
«Ja?»
«Die ist für Kühe, nicht wahr?»
Er nickte.
«Sollte sie nicht trotzdem so klingen wie die von der Kirche?»
Paul Fidel Parpan (1830–1875)
Obervaz, Graubünden
1844
Die Tränen des Vaters waren ihm schleierhaft. Ein weinender Mann war schon seltsam genug, aber noch weniger verstand Paul Fidel die Ursache. Es war doch alles Vaters Idee gewesen, Vaters Wille, und Paul Fidel hatte sich ohne zu fragen gefügt. Wenn der Vater nicht wusste, was das Richtige für seinen Sohn war, wer dann? Gewiss, ein halbes Jahr bestand aus einer unvorstellbaren Menge an Tagen. Doch als der Vater ihm auf dem gescheckten Rücken eines Kalbs, der als Landkarte diente, die Weiten der Welt erklärt hatte, begriff Paul Fidel, dass er ein Grosser werden konnte. Eine Reise in den Norden, durch ferne Länder und prächtige Landschaften bis ans Schwäbische Meer und das sagenumwobene Schwabenland – es war ein Abenteuer, das Helden schuf. Und nun stand der Vater so gebrochen da, als wäre wieder eines seiner Tiere gestorben.
Auf den Bergen lag noch viel Schnee und im Tal sammelte sich der Nebel, als rund dreissig Kinder aus verschiedenen Bündner Dörfern fortzogen in einen ungewissen Sommer. Unter Paul Fidels Gefährten befanden sich Buben, die gar nicht viel kräftiger aussahen als er, und sogar Mädchen – so hart konnte das Unterfangen also nicht sein. Die Reisegemeinschaft wurde von einer älteren, gleichwohl stämmigen Frau angeführt. Allein ihre zerfetzten Stiefel erzählten Legenden von endlosen Märschen, und die Entschlossenheit, mit der sie voranstapfte, duldete keine Saumseligkeiten. Auf dem ersten Teilstück wagte es niemand, das von ihr wortlos verordnete Schweigen zu brechen. Bald aber fing sie mit einer überraschend tiefen Stimme an zu beten, und ein strenger Blick über die Schulter gebot der ganzen Prozession, ihre Bitten im Chor zu wiederholen. Glorreicher Erzengel Raphael, du grosser Fürst der himmlischen Heerscharen! Du gütiger Arzt Gottes! Du Schutzengel der Reisenden! Mit deinem Lichte erleuchte uns! Mit deinem Heilmittel heile uns! Mit deinen Flügeln beschütze uns!





























