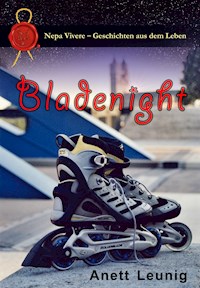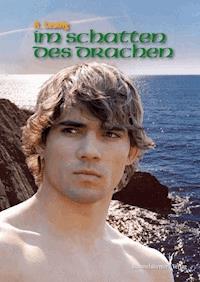
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach einem schweren Motorradunfall ist im Leben von Johannes nichts mehr so, wie es vorher war. Fünf Jahre sind seitdem vergangen, doch noch immer leidet der 30jährige an den körperlichen und seelischen Folgen jenes traumatischen Ereignisses, bei dem er nicht nur einen gesunden, leistungsfähigen Körper, sondern auch seinen besten Freund und erste große Liebe verloren hat. Oder hatte diese Liebe von Anfang an keine Chance? Johannes ist schwul, Marc nicht – oder doch, oder nur ein bisschen? Nie sendet er eindeutige Signale, zieht Johannes immer wieder an, um ihn gleich darauf wieder abzustoßen, spielt ein leichtsinniges Spiel mit dessen Gefühlen, während er sie stets ignoriert. Auf einer gemeinsamen Reise quer über durch Irland geschieht schließlich das Unfassbare, und für Johannes beginnt eine Zeit der Selbstzweifel und -verleugnung. Schließlich entscheidet er sich, an den Schauplatz des Unfalls zurückzukehren, um Marc dort zu suchen, wo er ihn verloren hatte: auf den Klippen der westirischen Steilküste. Bereits auf der Reise nach Irland überschwemmen ihn die Erinnerungen an seine Zeit mit Marc, an ihre erste Begegnung im College und die Entwicklung ihrer Beziehung. Die immer wiederkehrenden Flashlights aus der Vergangenheit belasten jedoch nicht nur ihn, sondern auch den charmanten Geigenspieler Paul, den Johannes in einem Dubliner Pub kennen lernt, und mit dem er eine Romanze beginnt. Schon bald wird aus der spontanen Sympathie eine zarte Liebe, die jedoch auf sehr unsicheren Beinen steht. Aus Angst vor diesen neuen Gefühlen, die je wieder zuzulassen er sich nach Marcs Tod verboten hatte, und aus Scham über seine Behinderung, verschweigt Johannes Paul zunächst seinen wahren Namen, sein Handicap und auch den Grund, weshalb er auf die grüne Insel gekommen ist. Doch lange kann er Paul nicht täuschen, und es scheint fast, als würde sich die Geschichte ein zweites Mal wiederholen und er den verlieren, den er liebt. Denn auch Paul hütet ein Geheimnis vor ihm, das es ihnen beiden nicht leicht macht, zu einander zu stehen. An den wildromantischen Steilklippen des Loop Head schließlich treffen Vergangenheit und Gegenwart aufeinander, um sich im Schatten des Drachen zur Zukunft zu vereinen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A. Leunig
Im Schatten des Drachen
Roman
Himmelstürmer Verlag
eBookMedia.biz
978-3-86361-042-5 PDF
978-3-86361-043-2 PRC
978-3-86361-041-8 ePub
Copyright © by Himmelstürmer Verlag
Originalausgabe, Herbst 2010
Coverfoto: (c) http://www.shutterstock.com
Das Modell auf dem Coverfoto steht in keinen Zusammenhang mit dem Inhalt des Buches und der Inhalt des Buches sagt nichts über die sexuelle Orientierung des Modells aus.
Umschlaggestaltung: Olaf Welling, www.olafwelling.de
Hergestellt mit IGP:FLIP von Infogrid Pacific Pte. Ltd.
„Jemanden an die Hand nehmen
und dabei nicht frieren,
da ist man nicht allein ... vielleicht ...
Vielleicht gibt es so was ...?“
(aus dem Film „Coming out“)
Einleitung
Irgendwo und irgendwann nach dem 09. Mai 2002
Anfangs dachte er, dieses grellgleißende Licht würde seine Sinne ausbrennen, ihn in sich selbst verglühen und nichts als weiße Asche zurücklassen. Er wusste, dass er dagegen ankämpfen sollte, doch er fand keine Kraft, um sich gegen die blendende Wand zu stemmen, sie mit seinem Willen zu durchstoßen. Sein Gefühl sagte ihm, dass auf der anderen Seite dieses Lichtinfernos nichts sein konnte, um das es sich zu kämpfen lohnte. Vielleicht wäre es wirklich einfacher, sich erneut in die tiefen Schatten der Bewusstlosigkeit fallen zu lassen. Einfacher und heilsamer.
Doch irgendetwas zog ihn mit unbarmherziger Penetranz aus dem Nebel heraus, in dem er sich zu verstecken suchte, und schließlich klärten sich seine Sinne. Mit unendlicher Mühe begann er wahrzunehmen, wo er sich befand. Sein Kopf lag auf einem Kissen, das nicht sein eigenes war; die Bettbezüge raschelten lauter als die in seinem eigenen Bett, fühlten sich steif und steril an, als wären sie jahrelang mit dem falschen Waschmittel gewaschen worden. Er wollte seine Augen zwingen, sich ganz zu öffnen, und nach einigen erfolglosen Versuchen taten sie ihm den Gefallen, schenkten ihm einen verschwommenen Ausblick auf die Welt hinter den weißen Nebeln. Sein Kopf schmerzte, als das blendende Licht auf seine Netzhaut fiel. Weiß, weiß, alles war weiß: die Bettdecke, die Wand gegenüber, die Zimmerdecke über ihm, die Neonlampen, die dort hingen. Langsam wandte er den Blick nach rechts, zu der weißen Tür, an der ein weißer Bademantel hing. Dann zurück zur anderen Seite, wo das Fenster sein musste, denn die Helligkeit nahm in dieser Richtung zu. Strahlend weiße Gardinen vor einem grauweißen Himmel.
Dann fokussierten seine Pupillen auf die erste Farbe, die sie in dieser farblosen Welt wahrnahmen: Rot. Das Rot stach in seine Pupillen wie ein glühendes Schwert in sein Herz. Es lag auf dem weißen Nachttisch neben seinem Bett. Ein Schuh, ein Turnschuh. Sein linker Turnschuh. Daran ein Bein, bis über den Knöchel, der Socken baumelte leer über die Nachttischkante. Und alles war rot, rot von Blut. Seinem eigenen Blut. Und jetzt sah er auch, dass seine Bettdecke unten links blutdurchtränkt war. Nass und kalt klebte sie an seinem Bein, und er spürte mehr, als dass er es sah: dort unten hob sich keine Silhouette eines Fußes ab. Flach und schwer lag die Decke auf der Matratze. Schreiend fuhr er auf: „Maaaaaarc!!!“
Teil I
- Der Flug -
Dublin, St.-Stephens-Green, 01. September 2007
Das erste, was ich von ihm wahrnahm, war eigentlich nicht mehr als ein Gefühl, dass da jemand war. Ich sah ihn nicht, jedenfalls nicht direkt, und hören konnte ich ihn über die Entfernung zwischen uns auch nicht. Es war eher wie eine Eingebung, ein instinktives Innehalten und Nachspüren - wie wenn man plötzlich die absolute Gewissheit hat, dass im nächsten Moment etwas Entscheidendes passieren würde, etwas, das das Leben komplett verändern könnte. Ob zum Besseren oder Schlechteren, das wird einem in diesem Sekundenbruchteil nicht klar, und man ahnt es auch nicht; man kann sich nur entscheiden zwischen dem Vorher und dem Nachher, zwischen Ignorieren und Weitergehen - oder Innehalten und sich einfangen lassen.
Ich entschied mich dafür, innezuhalten bei dem, was ich gerade tat, und diesem seltsamen Gefühl nachzuspüren, das meine Haut prickeln ließ wie eine feuchte Kinderzunge, auf der Brausepulver zerging; auszuloten, woher der Klang kam, der meine inneren Sensoren zum Schwingen brachte wie eine Stimmgabel die Saiten eines Instruments.
Es fiel mir ohnehin nicht sonderlich schwer, meine derzeitige Tätigkeit zu unterbrechen: zwei Kinder zu beobachten, die am Ufer des Parkteichs vor mir standen und zwei Brotscheiben in kleinste Bröckchen zerrupften, um diese dann mit ungelenken Bewegungen den Enten auf dem Teich zuzuwerfen. Die meisten der Bröckchen landeten keine zwanzig Zentimeter entfernt vor ihren Füßen - unerreichbar für die eigentlich doch recht dreisten und unerschrockenen Enten. Einige Bröckchen landeten hinter den Kindern - ein Festessen für die Horde frecher Spatzen und Sperlinge, die zu klug waren, um sich mit den Enten um die Brotbröckchen am See zu zanken, und daher lieber diejenigen aufklaubten, die auf der Wiese und dem angrenzenden Weg verstreut wurden.
Ich hatte dieses Schauspiel schon oft beobachtet. Hier im St.-Stephens-Green, der grünen Lunge Dublins, und an vielen anderen Seen, Teichen oder Tümpeln, an denen wir gewesen waren. WIR. Ich schloss die Augen und schüttelte kurz den Kopf, wie immer, wenn sich Gedanken darin einzunisten versuchten, die nicht willkommen waren. Ich war noch nicht bereit dafür.
Jenes prickelnde Gefühl ließ mich nach einiger Zeit meine Augen wieder öffnen, und dieses Mal fokussierten sie nicht auf die plappernden Kinder, sondern auf eine kleine Menschengruppe, die den Kiesweg entlang aus dem Schatten der Bäume heraus in das helle Sonnenlicht spazierte. Es war September, und um diese Jahreszeit stand die Sonne schon ziemlich tief, sodass sie mir in die Augen blendete. Ich zog die Sonnenbrille von der Stirn auf die Nase. Drei Männer kamen auf mich zu, schwatzend, lachend, überschwänglich gestikulierend. Offenbar waren sie in ein angeregtes Gespräch vertieft, über dessen Thema sie sich köstlich amüsierten.
Ich lehnte mich auf meiner Parkbank zurück, drehte mich ein bisschen seitlich und legte den rechten Arm über die Lehne. Diese Haltung, das hatte ich durch sorgfältiges Studium verschiedenster Parkbesucher herausgefunden, sah am coolsten aus; außerdem bot sie mir die Gelegenheit, über die Schulter ganz diskret die Herannahenden zu beobachten und ihre Schritte bis zur anderen Seite meines Blickfeldes zu verfolgen, ohne dabei den Kopf merklich drehen zu müssen. Nicht zuletzt hatte ich so die Möglichkeit, mein linkes Bein unauffällig auszustrecken. Betont lässig legte ich den Kopf in meine rechte Hand, die Augen hinter dem Schutz der Sonnenbrille neugierig auf die kleine Gruppe gerichtet. Der in der Mitte trug einen Hut.
Die drei hatten sich mir mittlerweile bis auf wenige Meter genähert, und jetzt bemerkte ich auch, dass nur zwei miteinander sprachen. Der Dritte ging einfach ruhig neben ihnen her, die Hände in den Taschen seiner grünen Daunenjacke vergraben, die Schritte wohlbemessen, den Kopf mit den leuchtend roten Locken leicht gesenkt. Das Grün der Jacke und das Rot seines Haars bildeten einen seltsam faszinierenden Kontrast. Kurz vor mir schaute er auf und mich direkt an. Für einen Moment nur begegneten sich unsere Blicke, meiner dazu noch hinter den dunklen Gläsern meiner Sonnenbrille verborgen.
Trotzdem hatte ich das Gefühl, als wäre eben etwas ganz Wunderbares passiert. Meine Nackenhaare stellten sich auf, die Ader an meiner Schläfe begann zu pochen, und durch meinen Körper schoss ein süßer Schauer. Wieso? Weil er die Augen nicht abwandte, während er langsam an mir vorbeiging? Konnte er spüren, dass auch ich ihn mit meinem Blick verfolgte?
Die beiden anderen bemerkten nichts, schlugen sich ausgelassen über einen Scherz, den weder er noch ich mitbekommen hatten, auf die Schulter und stießen dann auch ihn an. Das lenkte ihn von mir ab, unterbrach unseren Blickkontakt, was beinahe schmerzhaft für mich war. Irritiert schob ich die Sonnenbrille auf die Stirn, während ich noch immer dem grünen Parka nachschaute. Er war schon fast aus meinem Blickfeld entschwunden, da drehte er sich plötzlich noch einmal um, sah zurück und mich noch immer schauen, und mit einem Mal huschte ein Lächeln über sein Gesicht. War es die Sonne, die mich blendete oder der Reflex, den seine Geste auslöste? Ich spürte, wie ich die Augen zusammenkniff und meine Mundwinkel sich verzogen - zu einem Lächeln, wie mir schien. Das erste seit Monaten. Dann war er fort.
Nach einer Ewigkeit erhob ich mich - oder waren es nur ein paar Minuten gewesen, die ich gedanken- und blicklos vor mich hingestarrt hatte? Mittlerweile fühlten sich meine Glieder so steif an, als hätte ich schon seit Stunden in der kalten Brise gesessen, die jetzt vom See herüberwehte. Es war ganz eindeutig Herbst geworden in Irland, und auch das hektische Pulsieren der Großstadt konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Dinge jenseits von Beton und Glas nach anderen Gesetzen richteten als tickenden Ampeln und Busfahrplänen.
Herbst, das war die Zeit der Farbenpracht, der Ausgelassenheit und des letzten Frohsinns vor der Winterkälte. Auch hier in der Stadt konnte man das spüren. Es war gerade, als könnten sich die Menschen zwischen den luftig-leichten Kleidern des Sommers und den drückend-wärmenden Daunenjacken des Winters nicht entscheiden, und so gestaltete sich die Mode der vorbeiflanierenden Menschen höchst durchwachsen wie das Wetter auf der grünen Insel. Eben verzog sich die Sonne hinter einer Wolke, und wenn ich mich jetzt nicht beeilte, würde ich heute nicht mehr trockenen Fußes nach Hause kommen.
Also rappelte ich mich umständlich auf und begann meinen langsamen Marsch zurück zum Hotel. Ich wusste, dass ich für den knappen Kilometer bis dorthin an die zwanzig Minuten brauchen würde, und ich glaubte, mich mittlerweile damit abgefunden zu haben. Nur ungern und mit tiefer Wehmut erinnerte ich mich an die Zeit, in der Entfernungen und Geschwindigkeiten für mich keine Rolle gespielt hatten. Damals war die Welt für mich grenzenlos gewesen.
DAMALS. Das war ein Wort, das ich eigentlich nicht gebrauchen wollte, und das sich doch viel zu oft in meine Dialoge mit anderen Leuten einschlich. Und noch öfter in die nächtlichen Monologe mit mir selbst.
Letztere waren allerdings seltener geworden, seit ich diese Pillen nahm. Pillen, die mir ein Arzt verschrieben hatte, dessen Namen ich so schnell vergessen hatte, wie er mir das Rezept ausgestellt hatte. Manche Dinge vergisst man leicht, andere niemals. Und Namen sind sowieso Schall und Rauch. Stimmen dagegen nicht, Geräusche nicht, Licht nicht. Sie brennen sich in das Gedächtnis ein wie ein Feuerfunke in Seidenstoff. Und selbst wenn das Brennen und Glimmen aufgehört hat, bleibt da immer noch das Loch mit den ausgefransten, angekohlten Rändern, das sich nicht sauber zunähen lässt, die zerfetzte Haut an der Wunde, die sich nicht schließen will. Nicht kann. Nicht darf.
Die Pillen wirkten wie ein Verband, deckten nachts alles zu mit Stille, Schwärze, traumloser Ruhe. Aber sie heilten nicht, denn morgens, wenn der Verband abgenommen wurde, war alles noch da, wie am Abend zuvor, unverändert.
Mit diesen Gedanken betrat ich das Hotel, nahm von dem kess lächelnden Hotelboy in der Rezeption meinen Zimmerschlüssel und die Nachricht entgegen, dass für mich keine Nachrichten hinterlegt worden waren, fuhr mit dem Lift in den dritten Stock und schloss endlich mein Zimmer auf. Ein süßlicher Geruch nach Kerzenwachs und Blumenparfüm empfing mich - und Einsamkeit. Mit einem gewaltigen Seufzer ließ ich mich in den Sessel am Fenster fallen und lauschte dem Regen, der draußen gegen die Scheibe klatschte.
Dublin, Airport, Mitte Oktober 2001
Irland hatte ihn empfangen, wie es passender nicht hätte sein können: mit einem prasselnden Regenschauer, der binnen der wenigen Gehminuten vom Flugzeug zum Shuttlebus seine Jacke völlig durchweicht hatte.
Dabei war während des Landeanfluges auf die grüne Insel noch strahlender Sonnenschein gewesen, und über der Halbinsel Houth hatte sich ein wunderschöner Regenbogen gespannt, dessen Farben allein für ihn hätten leuchten können - wenn da nicht um ihn herum eine Maschine voller Menschen gewesen wäre, die sich hektisch, jeder auf seine Art, auf die Landung vorbereiteten: man packte, kramte, faltete und schnaubte. Trotz aller Aufregung und innerer Unsicherheit hatte er den kurzen Flug sehr genossen - im Gegensatz zu dem jungen Pärchen in seiner Sitzreihe, das zum ersten Mal in einem Flieger zu sitzen schien; bei jeder Etappe des terrassenförmigen Sinkfluges, die ihnen in den Bauch fuhr wie bittersüße Limonade, umfasste die kleine Blonde neben ihm die Hand ihres Freundes und schloss die Augen, um danach nervös aufzulachen und dem Typen einen Kuss auf die Wange zu drücken. Einen dieser Momente hatte Johannes genutzt, um einen Blick aus dem Fenster zu werfen, und da hatte er den Regenbogen gesehen. Wie passend.
Auch für ihn war diese Reise eine neue Erfahrung. Er war noch nie allein unterwegs und so weit fort gewesen, doch genau das machte für ihn den Reiz der Sache aus. Seit einem Jahr war der Plan für diesen Auslandsaufenthalt während des Studiums in ihm gereift, hatte sich aus einer spontanen Idee zu einem dringenden Bedürfnis entwickelt und war nun zu einer Herausforderung geworden, der er sich mehr als bereitwillig stellte.
Während Johannes forschen Schrittes durch die Gänge und Hallen des Flughafengebäudes zur Gepäckausgabe ging, spürte er schon die Vorfreude auf sein Studium an der Dublin City University mit ihrem modernen Campus und den vielen Forschungsprojekten, die er kennenlernen und vielleicht sogar eines davon würde begleiten können. Eine Welle der Dankbarkeit durchflutete ihn: für Josefine, die ihm bei den Vorbereitungen geholfen und seine Englischkenntnisse auf den aktuellsten Stand gebracht hatte; für die Eltern, die - auf Josefines Drängen hin und angesichts der hervorragenden Ergebnisse seiner Zwischenprüfungen - eine zusätzliche Finanzspritze zu seinem Stipendium locker gemacht hatten; und nicht zuletzt für das Austauschprogramm, das die DCU mit seiner Universität in Karlsruhe verband, und das ihm dieses Experiment überhaupt ermöglicht hatte.
Ein Experiment mit sich selbst. Er wollte sehen, ob er sich zurechtfand in der Fremde - und ob er hier endlich sich selbst fand, trotz der Fremde. Als er sein Gepäck auf dem Förderband heranrollen sah, zögerte er kurz ob der Endgültigkeit seines Vorhabens. Für die nächsten Wochen und Monate war das alles, was zu ihm gehörte: ein paar Klamotten, sein Laptop und die Ideen in seinem Kopf. Zusätzliche Klamotten konnte er kaufen, und der Rechner würde sich in den nächsten Monaten mit neuen Daten und Ideenskizzen füllen. Auch wenn viele Leute anderer Meinung waren und seine Begeisterung nicht nachvollziehen konnten: die Mathematik war bei weitem keine tote und starre Wissenschaft. Sie lebte in allem, was einen umgab, von der Kasse im Supermarkt bis zum Staumeldesystem auf der Autobahn. Und es war eine faszinierende Wissenschaft, deren Logik zu erforschen, zu analysieren und auszuprobieren ihn mehr als reizte. Aber würde er an der fremden Universität jemanden finden, mit dem er seine Ideen teilen und bereichern konnte? Der plötzliche Zweifel versetzte ihm einen scharfen Stich in der Magengegend, und er keuchte leise auf, als er seinen schweren Rucksack schulterte.
Der plötzliche, stechende Schmerz in meinem linken Bein ließ mich auffahren, und ich beugte mich unwillig schnaubend nach unten, um es ein wenig zu massieren. Der gestrige Flug war trotz seiner Kürze sehr anstrengend gewesen. Aber was ist schon leicht, wenn alles anders ist, als es einmal war.
Für den Zugangsschlauch am Frankfurter Terminal war ich mehr als dankbar gewesen; die Gangway in Dublin jedoch hatte mir mit ihren schmalen, tiefen und vom Regen halsbrecherisch glatten Plastikstufen schier unüberwindbare Schwierigkeiten gemacht. Noch schwieriger war es gewesen, sie unter den vermeintlich wissendes Mitleid heuchelnden Blicken der Flugbegleiterin zu meistern, Schritt für Schritt, die Schuhsohle nur halb auf die Stufen setzend, um dem Fehltritt nicht auch noch eine Fehlstellung folgen zu lassen. Ich hatte auch nicht auf mein Vorrecht gepocht und einen Sitzplatz an einem der Notausgänge verlangt, wo der Gang breiter war und somit mehr Beinfreiheit herrschte. Stattdessen hatte ich irgendwo in der Mitte des Flugzeuges am Gang gesessen, wo ich es in Kauf nehmen musste, dass mein Bein aufgrund der angewinkelten Haltung schon nach wenigen Minuten schmerzte wie die Hölle. Bei einer Notwasserung wäre ich der letzte gewesen, der die rettenden Türen erreichte, sofern das Flugzeug beim Aufprall auf die betonharte Wasseroberfläche nicht gleich in der Mitte entzweigebrochen wäre. In diesem Fall allerdings wäre ich ausnahmsweise mal als erster rausgekommen ...
Meine Gedanken glitten ins Absurde. Diese ganze Reise war absurd, und nicht zum ersten Mal fragte ich mich, warum ich mir das alles eigentlich antat. Weil mein Psychologe es mir empfohlen hatte? Der Arsch. Weil Josefine es mir geraten hatte? Süßes Schwesterherz. Weil ich selbst es wollte? Ich stand auf und holte mir einen Drink aus der Minibar.
Wie lange ich in Dublin bleiben wollte, wusste ich noch nicht, und normalerweise hätte ich mir besser ein B&B außerhalb der Stadt suchen müssen. Einen längeren Hotelaufenthalt mitten in der Stadt konnte ich mir von meinem mageren Gehalt als angestellter Verkäufer einer der reichsten Supermarktketten der Welt eigentlich nicht leisten. Rasch spülte ich die aufkommende Bitterkeit über das, was hätte sein können und das, was tatsächlich eingetreten war, mit dem ersten Schluck Whiskey hinunter. Beides brannte in meiner Kehle wie Feuer. Zur Beruhigung ließ ich die bernsteinfarbene Flüssigkeit einige Runden in meinem Glas kreisen, während mir ein paar wirklich gute Unterkünfte in den Sinn kamen. Doch die befanden sich nicht in Dublin, und außerdem hätte ich mich dort ebenso fremd gefühlt wie in der Sterilität dieses Hotels. Nichts war mehr beruhigend vertraut, alles beängstigend anders.
Das Bett war bei meiner Rückkehr frisch gerichtet, der Baderaum gewischt, alles aufgeräumt und gelüftet. Ich hasste die Vorstellung, dass hier irgendjemand tagsüber ein- und ausging, herumräumte und meine Kissen aufschüttelte. Eine Frau vermutlich, wie der schwache Parfümgeruch verriet, der noch immer in der Luft hing. Insbesondere die Tatsache, dass fremde Frauenhände mein Bett berührt hatten, machte mich nicht besonders an. Aber ich hatte keine Wahl. Seufzend zog ich erst mal auf allen Seiten die Decken und Bettlaken unter der Matratze hervor. Diese britische Unsitte, sich im Bett selbst einzusperren, hatten wir beide nie verstehen können ... -
Da war es, dieses WIR. Das zweite Wort, das ich so selten wie möglich gebrauchen wollte. Ich ließ von den halb herausgezogenen Laken ab und ging ins Bad, um mir den Straßenstaub und eben jenes WIR vom Gesicht zu waschen. Dann setzte ich mich auf mein zerzaustes Bett, öffnete meine Hose und streifte die Schuhe von den Füßen. Das war umständlich, und ich wartete damit immer bis zum Schluss, bis ich sicher war, die Schuhe nicht noch einmal anziehen zu müssen. Hier im Zimmer konnte ich auch barfuss gehen, die Auslegware war rutschfest und nicht zu weich. Den dicken Teppich, für mich eine gefährliche Stolperfalle, hatte ich eingerollt und unter das Bett geschoben. Dem Zimmermädchen war es offenbar zu mühsam gewesen, ihn von dort wieder hervorzuholen, wofür ich ihr ausnahmsweise einmal dankbar war. Ich ließ mich rückwärts aufs Bett fallen und starrte zur unpersönlich weißen Decke hinauf. Was für ein Tag!
Eigentlich hatte ich an meinem ersten Tag in Dublin nicht viel unternommen. Morgens war ich mit einem der gelb-blauen Doppelstockbusse zum Strand von Portmarnock gefahren und in der verträumten Einsamkeit der Dämmerung an der Küste entlangspaziert, um mir in der leichten Brise den Kopf freiblasen zu lassen. Das Rauschen des Meeres beruhigte meine Sinne, und die Wellen schwemmten mit ihrem stetigen Hin und Her meine Gedanken weg. Ich hatte mich in die Dünen gesetzt und sie dabei beobachtet, wie sie sich ständig selbst überholten und doch nicht vorankamen. Es war wie ein Kampf gegen unsichtbare Kräfte, die das Wasser wieder und wieder in sich selbst zurückzogen. Der Himmel war bedeckt, und nur an einzelnen Stellen durchbrach ein türkisblauer Schimmer die bleierne Schwere, spiegelte sich in dem wogenden Silber darunter.
Als sich der Strand irgendwann mit Touristen, Joggern und Spaziergängern mit Hunden füllte, nahm ich den nächsten Bus zurück in die City und ließ mich dort von dem bereits erwachten, pulsierenden Leben durch die Straßen treiben, ziellos, orientierungslos. Nur den Körper; der Geist war ganz woanders. Irgendwann war ich dann in jenem Park gelandet, um mich auszuruhen. Und dann waren diese drei Typen aufgetaucht, von denen ich eigentlich nur den einen richtig wahrgenommen hatte - wahrnehmen musste.
Noch einmal witterte ich diesem unheimlich vertrauten Gefühl nach, das mich wie aus dem Nichts überkommen hatte. So etwas hatte ich bisher nur einmal gespürt: an dem Tag, an dem WIR uns begegnet waren. Marc und ich.
Dublin, Campus der DCU, Anfang November 2001
„Hey, are you okay? Come on, get up!“ Alles war so schnell gegangen, dass Johannes noch immer nicht genau wusste, was eigentlich passiert war. Da waren diese verrückten Gören gewesen, die auf ihn zugerast kamen und offenbar nicht bremsen konnten, und dann - rums. Er musste wohl mit dem Kopf auf das Eis geschlagen sein, denn sein Schädel dröhnte, als wäre er mit einem Presslufthammer bearbeitet worden. Nur undeutlich nahm er die Gestalt war, die sich zu ihm niederbeugte und ihm die Hand entgegenstreckte. Es war eindeutig keines der Mädchen. Die waren einfach schreiend weitergeschlittert.
Schnaufend ließ er sich hochziehen, suchte das Gleichgewicht auf seinen zwei Kufen, und lachte verlegen, um seine Unsicherheit in etwas anderes als betretenes Schweigen zu kleiden: „Danke, danke, es geht schon. Ich stehe ja wieder.“ Johannes hob den Blick und tauchte ihn umgehend ein in zwei tiefblaue Augen, die ihn freundlich anzwinkerten. Mit einem Mal schien alles um ihn herum so groß, so weit und so sanft, dass er meinte, die Realität würde ihm entgleiten wie eben seine Füße auf der spiegelglatten Eisbahn, auf der sie beide standen.
„Ist alles noch dran? Tut dir was weh?“
„Nein, ich glaube ... naja, der Hintern und die Schulter, autsch! Aber es geht schon, ist nichts schlimmes, glaube ich.“ Sie sprachen Englisch miteinander, doch hinter dem Akzent des anderen schien sich noch etwas zu verbergen, eine Klangfärbung, die Johannes das Gefühl von Vertrautheit und Fremde zugleich vermittelte und sein Interesse weckte.
„Das war aber ein übler Sturz. Mann, manchmal können einen die Girls schon ganz schön aus der Bahn werfen, was?“
„Tja, wem sagst du das?“ Der Smalltalk tat gut, lenkte von den Schmerzen ab, half über die Peinlichkeit der Schwäche hinweg. Aber er verlief in die falsche Richtung, und das verursachte andere Schmerzen, machte die eigene Schwäche umso deutlicher. Johannes wünschte sich, die blauen Augen würden sich einfach im Blau des Himmels über ihm auflösen - dann würde er wenigstens nicht in ihnen ertrinken müssen.
Einen Augenblick lang wusste keiner von ihnen so richtig weiter, dann fragten sie beide gleichzeitig:„Bist du alleine hier?“
Ihr beider Lachen darauf klang befreit, erleichtert, richtig echt. Der Typ mit den blauen Augen antwortete schließlich als erster.
„Nein, ich bin mit ein paar Freunden da. Die sind ... irgendwo da drüben.“ Er wedelte mit der Hand unbestimmt in irgendeine Richtung. „Und was ist mit dir? Wo sind deine Leute?“
„Ich bin alleine hier.“
Wieder Schweigen. Die Unsicherheit stand zwischen ihnen wie die Dampfwolken ihrer beider Atem. Die Stimme des anderen schlug endlich die erste Brücke zwischen ihnen.
„Lass uns doch ein paar Runden zusammen drehen, hättest du Lust?“
Johannes nickte erleichtert: „Okay. Wie heißt du eigentlich?“
„Marc. Und du?“
„Johannes. Aber die meisten nennen mich nur Jo.“ Es war nicht üblich, diesen Teil seines Namens englisch auszusprechen.
Während er seine Schlittschuhe neu zuband, sinnierte Marc: „Johannes ... - du kommst aus Deutschland, stimmt’s? Ich auch, naja, zur Hälfte zumindest. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Spanier. Sieht man ja auch irgendwie. Ich bin über die Universidad de Malaga hierhergekommen. Austauschprogramm, ist bei dir wahrscheinlich nicht anders ...“
Dieser unbefangene Redeschwall war für Johannes anstrengend und erleichternd zugleich. Ihm war nun klar, warum Marcs Erscheinung ihn sowohl anzog als auch befremdete. Allerdings wurde die Anziehungskraft mit jedem Wort des anderen größer, und er drohte schon wieder aus dem Gleichgewicht zu geraten.
Marc plauderte derweilen weiter.
„Jo - das ist cool. Kurz und prägnant. Ist sowieso ´ne coole Idee, diese Schlittschuhbahn mitten auf dem Campus. Es ist als Kennlernparty für die neuen Semester gedacht. Na, zumindest bei uns hat es funktioniert!“ Und dann mit einem verschmitzten Seitenblick aus den aufreizend blauen Augen über roterhitzten Wangen: „Na los, Jo, dann machen wir jetzt ein bisschen Speed!“
Damit drehte Marc eine kleine Pirouette und holte Schwung. Johannes folgte ihm, und dabei war er sich ganz sicher, dass sein Herz nicht allein von diesem unerwarteten Sprint fast zum Zerspringen klopfte.
Dublin, Temple Bar, 02. September 2007
Unser zweites Zusammentreffen war so ungeplant und überraschend wie das erste. Vielleicht hätte es mich auch nicht überraschen müssen, denn was geschehen soll, geschieht, egal, ob wir etwas dafür oder dagegen tun.
Ich saß in einem der unzähligen Pubs in Temple Bar, Dublins buntestem Kneipenviertel, drehte mein Guinnesglas in den Händen, während ich im Spiegel des Tresens die Leute hinter mir beobachtete. Ich war sehr früh als einer der ersten Gäste hier eingetroffen, hatte deshalb die freie Platzwahl gehabt und mich für einen Hocker am linken seitlichen Flügel der Bar entschieden, wo ich vor den Blicken der anderen Besucher geschützt war und dennoch mittels des Spiegels einen guten Überblick über das Geschehen im Raum und die Neuankömmlinge an der Tür hatte.
Der Pub war urig und fantasievoll zugleich eingerichtet, auch wenn er sich darin von den meisten Pubs der Stadt nicht unterschied: dunkles, schweres Holz, an der Bar Regale voller Flaschen mit bunten Etiketten und mehr oder weniger geheimnisvoll schimmerndem Inhalt. An den Wänden luden lederbezogene Sofas zum Darin-Versinken ein, und kleine Kerzenflammen wiesen den Weg durch das Tischlabyrinth. An den Wänden hingen die verschiedensten Kunstfotos: spärlich bekleidete Frauen der fünfziger Jahre mit rauchenden Zigarrillos in den behandschuhten Händen; vergilbte braun-weiß-Fotos von stolzen Herren neben einst bestimmt modernen Fahrzeugen. Offenbar hatte der Inhaber in Großvaters Erbtruhe herumgestöbert.
Immer mehr Füße scharrten über den Boden, ließen die Holzdielen knarren, Stuhlbeine quietschen. Stimmen surrten durch den Raum, vermischt mit dem Zischen des Zapfhahnes und dem Klingen der Gläser, wenn angestoßen wurde. Verwirrt lauschte ich den Gesprächen: von amerikanischem Englisch über Spanisch, Deutsch und sogar Italienisch wurde hier alles gesprochen, nur kein Irisch. Offenbar war ich in einem der unzähligen Touristenpubs gelandet. Aber eigentlich war es mir gleich, solange meine Kehle nur etwas zu trinken und meine Augen etwas zu beobachten bekamen. Lange musste ich nicht warten.
Es ging auf zehn zu, als sich plötzlich aller Aufmerksamkeit von den Tischen, Gläsern und der Bar weg und auf die mir gegenüberliegende Ecke des Pubs richtete, wo ich schon vor geraumer Zeit Mikrofone hatte stehen sehen. Ein Plakat an der Eingangstür hatte mir bereits beim Betreten des Pubs den Auftritt einer Live-Band angekündigt, und jetzt, da es offenbar losging, verspürte auch ich ein wenig Neugier und Lust auf die Klänge dieses Landes. Ich bestellte mir noch ein Guinness und wartete ab, was weiter geschah.
Die drei Musiker kamen aus einem Nebenraum, den ich von meiner Ecke aus bisher nicht wahrgenommen hatte. Sie waren lässig gekleidet in Jeans und bunt karierten Hemden. Der eine trug Hosenträger darüber, die er schnippen ließ, bevor er seine Flöte an die Lippen setzte. Der andere hatte einen Hut auf und schlug einen kurzen Trommelwirbel auf seinem Bodhrán. Der dumpfe und doch melodische Klang dieses Instruments faszinierte mich. Doch der Anblick des dritten Musikers raubte mir fast den Atem: er war es, auch ohne grünen Parka erkannte ich ihn sofort an seinem leuchtend roten Lockenkranz. In seiner linken Hand hielt er Geige und Bogen.
Ich saß da wie elektrisiert, unfähig, mich zu bewegen, besorgt, dass er mich sehen könnte und gleichzeitig voll unbändigem Verlangen, dass er es doch täte. Aber das war eigentlich nicht möglich, denn ich saß in einer relativ dunklen Ecke und hinter vielleicht fünfzig anderen klatschenden und pfeifenden Pubbesuchern, die die Musiker begrüßten.
Er trat an das vordere Mikrofon, begrüßte die Gäste in breitestem irischen Akzent und legte dann in einer unglaublich graziösen Bewegung seine Geige ans Kinn. In diesem Moment fiel sein Blick doch auf mich. Auch er musste mich sofort erkannt haben, denn ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Da war keine Überraschung, kein Erstaunen, sondern einfach pure Freude darüber, dass die Dinge so waren, wie sie waren, und ich hier war. Mit einer nur minimalen Verzögerung gab er seiner Band den Einsatz, und im nächsten Moment nahm mich ihre Musik gefangen.
Während ich seinem Spiel lauschte, beobachtete ich ihn ungeniert. Als Publikum konnte ich mir das leisten. Seine schlanke Gestalt wiegte sich im Takt der Musik, sein Kopf lehnte leicht auf dem Instrument, und wie eine Feder schien der Bogen die Saiten zu streicheln, während die Finger der linken Hand beim Greifen verspielt über den hölzernen Hals tanzten. Er machte nicht nur Musik, er liebte sie, und er liebte offenbar sein Instrument, dem er mit unendlicher Zärtlichkeit die Töne entlockte, die mich augenblicklich davontrugen: hinaus in die weiten, sanften Hügel Irlands, über die wogenden Grasweiden mit den weißen Schafstupfern, durch pittoreske Dörfer mit leuchtend bunten Häusern und bis weit hinüber zur rauen Westküste mit ihren zerklüfteten Steilklippen. Das alles hatte ich schon einmal gesehen, und jetzt war ich wieder hier. Ich fürchtete die Erinnerungen, die in mir aufsteigen wollten, langsam, unaufhaltsam und erschreckend intensiv trotz all der Zeit, die zwischen dem Damals und dem Heute lag. Gleichzeitig jedoch sehnte ich sie mir herbei, nun, da ich endlich wieder an diesem Ort war, diese Stadt sah und diese Musik hörte.
Der plötzliche Applaus riss mich aus meinen Gedanken. Ich hatte Raum und Zeit verlassen und wurde durch den Lärm nun unsanft in die dunkle Enge des Pubs zurückgeholt. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass wir uns die ganze Zeit über angestarrt hatten. Jeder Ton, den er in der letzten Stunde gespielt hatte, schien allein mir gegolten zu haben, und auch die Ansagen, die komplett an meinem Ohr vorbeigerauscht waren, hatte er mir direkt ins Gesicht gesprochen. Auch jetzt ruhte sein Blick auf mir, während er das Finale ankündigte, die Gäste auf die bevorstehende Sperrstunde hinwies und damit zur letzten Bestellung aufrief.
Eigentlich hatte ich spätestens um diese Zeit gehen wollen, und ich wandte mich zur Bar um. Doch bei der Flut an Getränkebestellungen, die auf den Wirt einprasselten, war es jetzt unmöglich, ihm auch noch meine Rechnung abzuverlangen. Also blieb ich schicksalsergeben sitzen und schielte wieder verstohlen zu ihm hinüber. Gerade trank er in großen Schlucken sein Bier aus, und als er es absetzte, zwinkerte er mir zu und hob dann zum Wirt gewandt die Hand, streckte den Daumen in die Luft, formte darauf zusammen mit dem gekrümmten Zeigefinger ein symbolisches G und deutete auf mich. Im Gegensatz zu mir schien der Wirt diese Geste zu begreifen, denn zwei Minuten später stellte er ein Guinness bei mir ab, das ich nicht bestellt hatte. Ich wollte ihn schon auf seinen Irrtum hinweisen, aber er brummte beschwichtigend: „Don’t panik, this round’s on Paul.“ Damit war die Sache geklärt, obgleich ich das Bier noch nicht anzurühren wagte. Paul also.