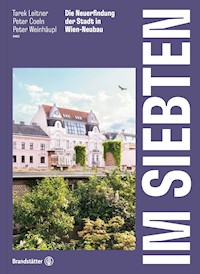
Im Siebten E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brandstätter Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der 7. Wiener Gemeindebezirk ist mehr als ein Stadtteil: Er ist das Testlabor für modernes urbanes Leben schlechthin. Zugleich ist hier, in Neubau, Wien typisch Wien, obwohl "der Siebte" mit seinen sieben Bezirksteilen in all den Reiseführern und Bildbänden, die die Ikonen der Stadt zeigen, selten eine eigene Rolle spielt. Dieser reich bebilderte Prachtband taucht zum ersten Mal in die vielen heterogenen Ansichten des pulsierenden Bezirkes ein, er lädt ein zum entdeckenden Flanieren, zum Perspektivenwechsel, zur Begegnung mit den Menschen, die den Siebten prägen, und feiert dabei die Liebe zur Stadt und zum Stadtleben. Im Zentrum stehen die Transformationsprozesse, mit denen dieses Buch zugleich die Vorreiterrolle des Siebten dokumentiert und zeigt: Urbane Veränderung ist ebenso unaufhaltbar wie chancenreich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die historistische Altlerchenfelder Kirche gilt als »Gesamtkunstwerk«. Bei Speisen – etwa im nahe gelegenen Gasthaus des Karl Krausieder – waren solche Begrifflichkeiten noch fremd.
Die historistische Altlerchenfelder Kirche gilt als »Gesamtkunstwerk«. Bei Speisen – etwa im nahe gelegenen Gasthaus des Karl Krausieder – waren solche Begrifflichkeiten noch fremd.
Auch die alten Fassaden sind nichts anderes als »Streetart«. Das gefällt bis heute, und lässt den Siebten oft sehr konservativ erscheinen.
Auch die alten Fassaden sind nichts anderes als »Streetart«. Das gefällt bis heute, und lässt den Siebten oft sehr konservativ erscheinen.
Tarek LeitnerPeter CoelnPeter Weinhäupl
(HG.)
Die Neuerfindungder Stadt inWien-Neubau
IM SIEBTEN
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Versuchsstation urbanen Lebens
Tarek Leitner
Kapitel 1
Der Kampf um die Stadt
Tarek Leitner
Kapitel 2
Verkehrsberuhigung im Bezirk des Autoerfinders
Tarek Leitner
Kapitel 3
Wohnen wie im siebten Himmel
Tarek Leitner
Menschen im Siebten
Reinhold Posch, Ina Kent, Brigitte Bierlein, Avi Babadostow
Aufgezeichnet von Barbara Tóth
Kapitel 4
Vom Spielplatz der Ideen zum politischen Labor
Barbara Tóth
Streifzug I
Erinnern im Siebten
Peter Weinhäupl
Menschen im Siebten
Lilian Klebow, Georgij Makazaria, Susanne Bisovsky, Marvin Mangalino, Terezija Stoisits, Marianne Kohn
Aufgezeichnet von Barbara Tóth
Kapitel 5
Waarenhaus und Pop-up-Store
Tarek Leitner
Streifzug II
Als die Moderne um 1900 den Siebten umarmte
Peter Weinhäupl
Fotoessay
Getting lost is part of getting there
Francesca Catastini
Kapitel 6
Essen, Trinken, Selbstverwirklichung
Petra Percher
Streifzug III
Eine Insel am Rande des Siebten
Peter Weinhäupl
Menschen im Siebten
Kurt Palm, Karola Kraus, Deborah Sengl, Roland Girtler
Aufgezeichnet von Barbara Tóth
Kapitel 7
Das Fotoviertel verdrängt Mozart und Amerling
Tarek Leitner
Resümee
Kein Ausblick
Tarek Leitner
Anhang
BeitragendeBildnachweisImpressum
Versuchsstation urbanen Lebens
Tarek Leitner
Manchem Menschen gilt Neubau als Versuchsstation des Weltuntergangs. Eine solche war für Karl Kraus einst die gesamte Österreichisch-Ungarische Monarchie. Das Land verkleinerte sich – und mit ihm die Versuchsstation. Sie ist mittlerweile auf einen kleinen Wiener Gemeindebezirk geschrumpft. Es ist: »Der Siebte«. Aber so klein kann die Versuchsstation gar nicht sein, dass sie nicht das Zeug hätte, das Land zu spalten – oder zumindest zu provozieren. Ein Pop-up-Pool wurde dort ersonnen und inmitten einer Hauptverkehrsader platziert (nicht neulich, wie man in Erinnerung haben mag, sondern bereits 1930). Veganista, ein Laden für veganes Eis, wurde dort eröffnet, und die Menschen nehmen beim Anstellen Schlangen in Kauf, die manche*n DDR-Bürger*in hätten umkehren lassen. Man empört sich übers Nicht-Gendern, verordnet sich und anderen vermeintlich politische Korrektheit und schaut ein wenig mitleidig und herablassend auf jene, die das nicht tun. Aber man hat Interesse an fremden Kulturen, und sei es die einer steirischen Landgemeinde. Der Orient ist ja sattsam bekannt. Über 30 Jahre hinweg konnten Kaffeehausbesucher*innen, wenn schon nicht »am«, so zumindest »im« Nil sitzen.
Man ist auch an anderen Meinungen interessiert, weiß sich aber auf der richtigen Seite. Im Siebten rettet man mit der neuen E-Scooter-App das Weltklima (alle Bewohner*innen sind Heavy-User) und sucht verzweifelt einen Parkplatz für den SUV, den man der Sharing-Economy dann doch lieber entzieht. Der Diskurs verläuft entlang der Bruchlinie Lastenfahrrad versus Tesla.
Man legt Wert auf Gärten. Sie werden allerdings zuweilen aus der Horizontalen gebracht, weil das die Fassade begrünt und Regenwasser spart. Man funktioniert Peepshows zu Kunstsalons mit Lesungen hinterm Guckloch um. Und für unsere Vierbeiner werden eigene Pinkelsteine überlegt – Hunde würden Neubau wählen …
Das sind die neuen Wien-Klischees. Sie entsprechen übrigens alle der Wirklichkeit. Es sind zwar vielleicht nicht die ersten Klischees, die jemandem in den Sinn kommen, aber zumindest die zweiten. Und bei so manchem österreichischen Nicht-Wiener dreht sich das momentan gerade um. Da wird das bisherige Wien-Klischee von Lipizzanern und Stephansdom, von Sissi und Schönbrunn von diesen eingangs aufgezählten neuen Klischees überlagert. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Denn über die letzten 200 Jahre, seit es im weitesten Sinn so etwas wie Städtetourismus gibt, erzählen Reiseführer und Bildbände andere Wien-Geschichten. Diese sehen die Ikonen jener Stadt an anderer Stelle.
Die neuen Klischees
Als ich einst von Linz nach Wien übersiedelte, gaben mir Freunde das Büchlein »Reise von Linz nach Wien« aus dem Jahr 1842 mit auf die Reise. Ich musste feststellen, dass darin zwar in einem einzigen Satz Gumpendorf, Laimgrube und Mariahilf gestreift werden, denn so »heißen die Vorstädte, in denen fast Alles Fabrikant ist«, und in einer Zeile die Rede auf die »außerhalb der die eigentliche Stadt umschließenden Linien liegenden Dörfer Fünfhaus, Sechshaus« kommt, aber mit keinem Wort mein präferierter Bezirk Neubau erwähnt wird. Auch der »Illustrierte Führer« durch »Wien im Jahr 1880« widmet dem Bezirk Neubau fast 40 Jahre später immer noch gerade einmal fünfeinhalb Zeilen. Und das im Wesentlichen wegen der zwischenzeitlich errichteten Altlerchenfelder Kirche. Das ändert sich in den weiteren hundert Jahren kaum. Bildbände, vor allem jene aus der Nachkriegszeit, bleiben unverändert bei den Wien-Klischees von Stephansdom bis Schönbrunn, mit gelegentlicher Erweiterung um UNO-City und Donauturm. Und die Nachkriegszeit dauerte atmosphärisch und ästhetisch in dieser Stadt bis in die späten 1980er-Jahre.
Der Fortschritt wirkt manchmal ganz schön historisch: Beginn der autofreien Stadt am Spittelberg.
Ohne die Altlerchenfelder Kirche (im Hintergrund) wäre von Neubau noch länger nicht Notiz genommen worden.
Die transportierten Klischees der historischen und manchmal auch modernen riesigen Gebäudekomplexe vermittelten das Bild eines Wasserkopfs. Und so war es wenig verwunderlich, dass es sich in den Köpfen der Menschen in Restösterreich festsetzte. Wien war schließlich nur noch die Hauptstadt eines Landes, »ce qui reste« – das nach dem Ersten Weltkrieg, wie es der damalige französische Außenminister Clemenceau ausdrückte, übrig geblieben ist.
Schon »Wasserkopf« ist despektierlich und führte dazu, dass die Wiener*innen die übrigen österreichischen Städter (von den Landbewohner*innen ganz zu schweigen) postwendend als G’scherte und Furchengänger betrachteten – und zwar gänzlich ungegendert. Diese wiederum sahen die Wasserkopfbewohner folglich als Großkopferte, wenn nicht gar als Hochg’schissene.
Aber das hat sich geändert. Und Neubau trägt daran keinen unwesentlichen Anteil. Kritik kommt heute subtiler. Auch wenn immer noch alle acht Landeshauptstädte zusammengenommen nur halb so groß wie Wien sind, es geht zunehmend weniger um Geografie und darum, wo Menschen leben. Denn aus Neubauer Sicht endet die Stadt gedanklich schon am Gürtel. Jenseits ist das etwas schludrige Bahnhofsviertel, diesseits aber das mondäne Ankunfts-Café, das alte »Westend«. Tor nach Wien, Tor in den Neubau. Zunehmend mehr geht es um die Ideenwelt der Menschen, unabhängig von ihrem Lebensort, unabhängig von der Geografie also, und viel mehr um ihre Lebenseinstellung, besser gesagt, um ihren Lifestyle. Der kann sich durchaus auch in einem Grazer Stadtteil finden.
Der gewöhnliche Stadtmensch verhält sich zum urbanen Hipster wie der einst so bezeichnete Salon-Sozialist zum Bobo. Diesen sich in den Nullerjahren dieses Jahrhunderts etablierenden Begriff wenden die so Bezeichneten auf sich selbst selten an. Zu sehr wohnt dem Bobo im allgemeinen Sprachgebrauch in Österreich das naive Gutmenschentum inne. Aber wenn man nicht auf die Etymologie des Wortes aus den Anfangsbuchstaben von »bourgeois bohémien« abstellt, sondern auf die Freude über die zuvor erwähnten Experimente in der Versuchsstation des Lebens, dann ist Neubau unter den Regionen Großbobostans mit dem Karmelitermarkt (2. Bezirk) und Teilen von Wieden (4. Bezirk) bis Alsergrund (9. Bezirk) die Region »Zentralbobostan«. Gewiss, Neubau ist Zentralbobostan. Und das schon, seit es dieser Begriff kurz nach der Jahrtausendwende in den allgemeinen Sprachgebrauch geschafft hat. Neubau ist so Bobo wie Kreuzberg oder Berlin-Mitte. Aber deutlich kleiner. Wer kritisiert, dass etwa die Affinität der Neubauer zu Multi-Kulti vor allem im Besuch von hippen Ethno-Food-Lokalen bestünde, und den Hinweis gibt, dass der über dem Stadtdurchschnitt liegende Ausländeranteil doch zu einem großen Stück nur durch Deutsche ausgemacht wird – wer das also kritisiert, wird nicht mehr postwendend beschimpft, sondern des »Wien-Bashings« bezichtigt. »Wien-Bashing« hat gewöhnlich den Archetypus des Neubauers vor Augen, wenn auch selten bewusst.
Die Sorge vor der »Verneubauerung«
Neubau ist exemplarisch für zeitgenössische Stadtentwicklung. Und daher mag dieser Ort gleichermaßen als Testlabor für modernes Leben wie auch als Versuchsstation für den Weltuntergang erscheinen. Denn immer wieder greifen Medien so manch schräge Entwicklung auf und tragen die Kunde vom neuen Sprühnebel zur Gehsteigkühlung, vom neuen Kollektiv-geführten NGO-Café für sauberes Wasser in Dritte-Welt-Ländern, von neuen Co-Working-Spaces in Geschäftslokalen ehemaliger Handy-Shops und von außerökonomischen Tauschmöglichkeiten via »Offenen Bücherschrank« in die Provinz hinaus. Wehe, das wird zum großen Ding. Dann steht ein solcher Bücherschrank plötzlich auch in der entlegensten Kleinstgemeinde. – Und tatsächlich findet man sie dort schon. Was kommt da noch alles nach?
Was da noch kommen mag, ängstigt manche Menschen. Und so ist wohl auch das Zitat eines einst führenden Politikers der rechtskonservativen ÖVP zu verstehen, der sagte: »Es konn ja net sein, dass unsere Kinda nach Wean (dialektal für Wien, Anm.) fahren und als Grüne zruck komman.« Es zeigt weniger die Sorge vor einem sich so leicht ändernden Wahlverhalten als die Existenz zweier Pole im Spektrum der österreichischen Gesellschaft. Des warat jo no schena, wenn mia do in Utzboch so an Sprühnöwi kriagn. (Es wäre ja noch schöner, wenn wir hier in Utzbach solch einen Sprühnebel bekommen.)
Stadt und Land waren schon immer gesellschaftliche Pole. Aber dass ihre Entfernung voneinander in Zeiten immer engerer Vernetzung durch reale Mobilität und virtuelle Kommunikation unverändert groß ist, überrascht dann doch immer wieder aufs Neue. Im langen Bundespräsidentschaftswahlkampf des Jahres 2016, in dem das Land von Kommentator*innen und Politikanalyst*innen als ein gespaltenes ausgemacht worden ist, ging es am Ende ganz offensichtlich nicht nur um zwei zur Wahl stehende Kandidaten, sondern um zwei Lebensentwürfe, die miteinander kaum vereinbar scheinen.
Ausgerechnet der Umgang mit der Seuche des Jahres 2020 und folgende, der diese Lebensentwürfe noch einmal stark akzentuierte, indem er zeigte, wie viele Menschen außerhalb des naturwissenschaftlichen Konsenses leben, bildete scheinbar eine Brücke. Das Land galt in der Pandemie plötzlich als sicherer als die dicht bebauten Bezirke, die so wenig Grün- oder Parkfläche zu bieten haben wie der Siebte. Aber als manche Medien schon den Verfall der Immobilienpreise einläuteten, weil bei den Bobos jetzt die Landlust ausbreche, zog das Virus aufs Land. Die Renaissance der imaginierten Einfamilienhausidylle samt vermeintlich virenfreiem Hüpfkäfig und frischluftdurchfluteter Doppelgarage war rasch vorbei.
Aufs Land zu ziehen hätte sich auch nicht ausgezahlt. Denn der Siebte und das Leben in der suburbanen Einfamilienhauswüste haben nicht beide ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Es ist vielmehr so, dass das Leben in Wien-Neubau die Vorteile von urbanem Leben und die Vorteile von ländlichem Dorfleben vereint.
Ländliches Dorfleben, wie es sich in unserem Kopf und vor unserem geistigen Auge festgesetzt hat, gibt es nicht mehr. Es ist untergegangen. In weniger als zwei Generationen ist es gegen Ende des 20. Jahrhunderts verschwunden. Und seitdem ist Landleben auch nicht mehr zwangsläufig von Naturverbundenheit gekennzeichnet. Mit der Natur in Kontakt zu kommen ist seither für jeden Menschen, unabhängig seines Wohnsitzes, eine bewusste Entscheidung. Von der beheizten Garage ins Einkaufscenter am Kreisverkehr kommt man auch am Land zuweilen an keiner Blume mehr vorbei.
Hinter dem Guckloch wartet nicht immer Sex. Manchmal wird man mit Literatur überrascht.
Die dortigen Bewohner*innen beklagen das nicht explizit. Die Unzufriedenheit mit der Verwandlung ihrer Welt speist sich durch das, was vermeintlich aus der Stadt kommt: Große Supermärkte, die nur mit dem Auto zu erreichen sind. Parkplatzwüsten, die sich in der Folge über die früheren Streuobstwiesen bis an den Horizont ziehen. Überkopfwegweiser, die dorthin leiten, wo ohnedies die hohen, auch nächtlich beleuchteten Firmenlogo-Türme stehen, die diese Aufgabe ebenso erfüllen. Dazwischen überdimensionierte Auf- und Abfahrtsrampen wie bei einer Autobahn, an deren Rändern Häuser zu finden sind, die man an anderer Stelle für sozialen Wohnbau halten könnte. Dieses los-angelisierte Bild des Dorflebens in Österreich (und nicht nur da) verursacht bei den dort lebenden Menschen mitunter ein unterschwelliges Gefühl der Bedrohung der gewohnten Welt. Es scheint eine Bedrohung durch Urbanität zu sein. Aber nichts von Urbanität dieser bedrohlichen Art findet sich in Neubau. Nicht einmal ein richtiges Hochhaus.
So leicht wurde das Interesse an fremden Kulturen zuweilen befriedigt: Das ehemalige Café Nil.
Die Rückkehr des Dorfes in die Stadt
Fast könnte man meinen, nach dem Niedergang des Dorfes im 20. Jahrhundert hat dessen Wiedergeburt im dichten urbanen Raum stattgefunden. Hier finden sich plötzlich kleine Schneider*innen, auch wenn kein darauf hindeutender gleichlautender Schriftzug an der Geschäftsfassade angebracht ist – weil es sich jetzt um ein hippes Fashion-Label handelt. Hier finden sich kleine Werkstätten, nicht wie früher in Hinterhöfen, sondern an der Straßenfront, um Passant*innen an der Arbeit teilhaben zu lassen. Hier findet sich ein kleiner Bäcker, bei dem auch am Sonntag die zu Fuß gekommenen Menschen in Schlange anstehen, obwohl das Brot zu Apothekerpreisen verkauft wird. Es ist dafür in schönstes Geschenkpapier gewickelt. Und hier findet sich in mehrfacher Ausführung das alte Dorfwirtshaus. Mit seiner dunklen Holzverkleidung sieht es nicht nur so aus, wie wir es im Kopf haben. Es erfüllt auch tatsächlich seine gesellschaftszusammenführende Funktion. Aber man kann hier Nähe und Distanz, Mitteilung und Anonymität selbst steuern. Man kann unabgesprochen alte Bekannte treffen oder neue Leute kennenlernen. Ein Stück weit ist also das Dorf nach Neubau gekommen.
Wie lebenswert eine Stadt ist, zeigt sich oft daran, wie viel Leben auf der Straße stattfindet.
Aber nicht so, wie es der Literat Anton Kuh etwa hundert Jahre zuvor für ganz Wien befürchtet hat, als er meinte: »Die Politik trägt Berg- und Almluft herein, holzigen Scheunenhauch. Was in Stammbeisln krakeelt und in Extrazimmern rumort oder kniehosig und wickelgamaschig Marschtakte aufs Pflaster schlägt, was sich da schwarze Lappen ums Haupt wickelt, Baumstämme als Spazierstöcke trägt (…) – das ist der Geist von Schladming, Unterhollersbach und St. Kathrein.« In Neubau geht das höchstens als ironisches Zitat durch. Das bauernbündlerische Erntedankfest überlassen wir der Inneren Stadt, den Neustifter Kirtag dem Bezirk Döbling. Die »Landliebe« in Neubau beschränkt sich gern aufs Bioerdbeer-Joghurt im Gourmet-Spar-Regal.
So wie die Veränderung in den dörflichen Strukturen, setzte der beschriebene Wandel in der Stadt ebenfalls etwa um die Jahrtausendwende ein. Die Zeit davor, wie das Buch unter anderem zeigen wird, bot ein ganz anderes Bild. Aber es scheint so zu sein, dass die Bedürfnisse der Menschen für das Leben im sich verändernden Grätzl formuliert wurden und Auswirkungen hatten. Die einsetzenden Veränderungen in Zeiten des globalen Turbokapitalismus werden daher in ihren äußeren Auswirkungen nicht als bedrohlich empfunden und sind schon aufgrund ihrer räumlichen Dimension nicht monströs.
Zwar ist auch Neubau, wie jeder Wohnort in Österreich, einer permanenten Veränderung unterworfen. In jeder Gasse gibt es ab und zu eine neue Baulücke, die mit einem ganz anders anmutenden Gebäude gefüllt wird. Aber die Substanz in ihrer Gesamtheit ändert sich dadurch nicht allzu sehr. Nur im weiten ländlichen Raum kann ein flächenmäßig gar nicht so großes Bauwerk gleich die Anmutung eines ganzen Landstrichs verändern. In der Stadt geht die Verwandlung des Lebensraums schon aufgrund der engen und dichten Verbauung, die weite Blicke selten zulässt, nicht so rasant vor sich. Der Bezirk ist in dieser Hinsicht – wenngleich er Testlabor modernen Lebens ist – sehr konservativ.
Es schmerzt die Menschen, aber im dicht verbauten Raum heilen die Wunden rasch.
Ringen um Heimat
Vieles bleibt nicht nur so wie es ist, sondern wird im Zuge von Erneuerungen aller Art gleichsam historisierend in seiner Wirkung noch verdeutlicht: Als wäre alles immer schon so gewesen. Wer das erste Mal hier durchgeht, gewinnt an keiner Stelle den Eindruck, hier hat vor Kurzem ein eiserner Besen alles hinweggefegt, damit etwas ganz Neues entstehen kann. Selbst dort, wo es tatsächlich so war. Nicht in Bezug auf jedes einzelne Gebäude, aber insgesamt verändert sich der Bezirk in seiner Anmutung nur evolutionär. Da kann leicht das Gefühl von Heimat aufkommen. Begeben wir uns kurz auf dieses heikle Terrain.
Als Heimat gilt vielfach nicht ein tatsächlicher und eingegrenzter Ort. Vielmehr erschließt sich Heimat dann, wenn sie fehlt. Das Heimatgefühl entsteht durch Heimweh. Und Heimweh kann man nicht nur bekommen, wenn man weit weg von zu Hause ist, sondern auch dann, wenn sich das lang bekannte und gewohnte Zuhause so grundlegend und rasch ändert, wie wir das in manchen ländlichen Regionen und dörflichen Strukturen – aber auch in manch anderen Teilen der Stadt – beobachten. Das derart erzeugte Heimweh ist besonders schmerzhaft. Es lässt sich nicht behandeln. Das ersehnte »Daheim« gibt es ja nicht mehr. Das Heimweh übersteigert sich dann zuweilen in ein Heimatgefühl, das in Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit umschlägt.
Heimweh nach dem alten Westend: Nach mehr als hundert Jahren sperrte das Traditionshaus zu.
Wessen Heimat sich aber so evolutionär und langsam verändert wie in Neubau, der entwickelt das für das Heimatgefühl nötige Heimweh vielmehr durch die Bürden des modernen Berufsalltags mit seiner oft erzwungenen Mobilität. Solcherart lässt sich ein viel entspannterer Zugang zu diesem Gefühl und zu diesem Begriff finden. Im Siebten stößt man kaum auf einen anderen. Heimat scheint im Siebten ein Gefühl zu sein wie im siebten Himmel.
Dieses Lebensgefühl aber ist prekär. Das weiß man auch in Neubau – und präferiert daher den Altbau. Er ist die Versicherung, die vor einer zu raschen Verwandlung der Lebenswelt zu schützen scheint. Mag sich das Berufs- und Privatleben auch in immer rascher abwechselnde Abschnitte aufteilen und jede vorhersehbare Konstante verlieren, die Wohnumgebung – und sei es in der geringsten Stabilität einer WG – soll zumindest die Atmosphäre langer Beständigkeit ausstrahlen. Wer in hohen stuckverzierten Räumen über einen krachenden Fischgrät-Parkettboden geht, braucht sich auch als frisch Zugezogener nicht als Neu-Städter zu fühlen. Das macht auch den vom Land (das ist auch Linz und Vöcklabruck!) zugewanderten Neubauer rasch zum alturbanen Adel. Aber vielleicht ist dieser Drang, als solch Alteingesessener zu gelten, beim typischen Neubauer – und ein solcher gilt als zugewandert – geradezu pathologisch. Die Herkunft aus der diese Annehmlichkeiten nicht bietenden Provinz soll verdrängt werden. Und mit dem Verdrängen ist der Zuwanderer schon richtig in dieser Stadt. Es ist gleichsam der ganz persönliche innere Kampf um die Stadt.
Heimat erschließt sich, wenn sie fehlt: Die Renaissance des Dorfwirtshauses in der Stadt.
Der Kampf um die Stadt
Tarek Leitner
Wer darf was wo machen? Der Kampf um die Stadt ist vielschichtig. Einer davon ist der um die Funktionalitäten, die den Flächen und Gebäuden zukommen. Was wird wofür genützt, was steht wem zur Verfügung? Es ist ein Kampf, der mit vielen Mitteln geführt wird: Juristisch und politisch, medial – und durch Überschreitung rechtlicher Grenzen, durch unbewilligte Abrisse oder, um sie zu verhindern, durch Besetzungen. Und auch mit richtigen Kanonen. Mitten im Siebten zeugt ein monströser Bau von einem besonders gewalttätigen Kampf um die Stadt: der Flak-Turm im Hof der Stiftskaserne.
Nur in Zeiten einer Diktatur lässt sich ein städtebauliches Ensemble, noch dazu verbunden in einer Sichtachse, folgendermaßen fortführen: Michaelerplatz (1. Jh. v.u.Z.) – Burgtor (1824) – Maria-Theresien-Denkmal (1888) – Flaktum (1944). In seiner Form scheint er angelehnt an die Stauferburg Castel del Monte in Apulien. In 130.000 Tonnen Beton gegossen, mit einem Durchmesser von fast 50 Metern auf eine Höhe von 45 Metern, hätten damals 30.000 Menschen Schutz vor Bomben finden sollen. Etwa so viele, wie heute im gesamten Bezirk leben.
Das Material für die bis zu zweieinhalb Meter dicken Betonwände wurde mit dem Zug bis zum Westbahnhof gebracht und von dort auf extra verlegten Schienen zur Stiftskaserne transportiert. Diese Zubringerbahn bog am Neubaugürtel in den Bezirk ein, führte dann über die Seiden- und Zieglergasse bis zur Lindengasse, an deren Ende der Bauplatz lag.
Der Turm bildet ein Paar mit dem im benachbarten Bezirk Mariahilf, im Esterházypark gelegenen Flakturm. Das war jener mit Suchscheinwerfern ausgestattete »Leitturm«. Von dort aus hat den Soldaten an den Geschützen des »Gefechtsturms« das Ziel angezeigt werden sollen. Kanonen stehen heute nicht mehr auf dem Turm. Aber anders als sein Zwilling in Mariahilf, der nunmehr das »Haus des Meeres« beherbergt, wird der Turm im Hof der Stiftskaserne in Neubau weiterhin militärisch genutzt. »Sicherheitsstufe Anton« herrsche hier rund um die Uhr, flüstert uns der für die Besichtigung beigestellte Guide geheimniskrämerisch zu. Der Turm mit einer unterirdischen Verbindung zu Hofburg und Ballhausplatz, zum Regierungsviertel im 1. Bezirk also, und kolportierter Notversorgung für mehrere Monate soll ein gut gehütetes Mysterium bleiben.
Der Turm hat nach wie vor die Funktion, Schutz zu bieten, wenn auch nicht mehr für jene einst vorgesehenen 30.000 Menschen. Zumindest die Staatsspitze, für die hier ein Bunker eingerichtet ist, soll Schutz finden. Aber richtig beschützend wirkt der Turm immer noch nicht. Diese Festung der Verachtung erscheint weiter bedrohlich.





























