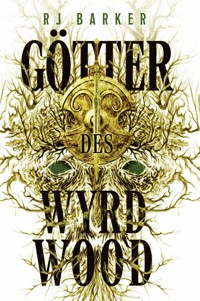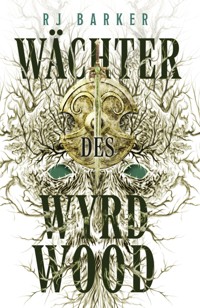14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Panini
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Gezeitenkind
- Sprache: Deutsch
VON ZERFALL UND PROPHEZEIUNGEN Joron Twiners Träume von Freiheit liegen in Schutt und Asche. Seine Schiffsfrau wird vermisst, und alles, was er noch hat, ist Rache. Vom Deck der Gezeitenkind aus führt er die Schwarze Flotte an und nutzt jede sich bietende Gelegenheit, um den Hundertinseln möglichst verheerenden Schaden zuzufügen. Doch seine Zeit ist begrenzt. Seine Flotte schrumpft, die Fäulnis des Keyshan wütet in seinem Körper und er versucht, sich vor einer Prophezeiung zu verstecken, die besagt, dass er und sein vogelartiger Zauberer dazu auserkoren sind, die ganze Welt ins Chaos zu stürzen. Aber die Seedrachen sind zurückgekehrt, was an sich schon ein Wunder ist, und wer vermag schon zu sagen, dass es nach einem Wunder nicht noch ein zweites geben kann? Der furiose Abschluss der einzigartigen Knochenschiffsaga von RJ Barker! Band 3 der Gezeitenkind-Trilogie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1005
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
AUSSERDEM BEI PANINI ERHÄLTLICH
RJ BARKER: DIE GEZEITENKIND-TRILOGIE
Band 1: DIE KNOCHEN-SCHIFFE
Band 2: DER RUF DER KNOCHEN-SCHIFFE
Band 3: IM SOG DER KNOCHEN-SCHIFFE
Nähere Infos und weitere phantastische Bände unter: paninishop.de/phantastik/
RJ BARKER
Die Gezeitenkind-Trilogie III
Ins Deutsche übertragen von Michaela Link
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright © 2021 RJ Barker.
Inside Images © 2019 by Tom Parker
Cover Illustration © by Edward Bettison
Published by agreement with Johnson & Alcock Ltd.
Excerpt from Legacy of Ash copyright © 2019 by Matthew Ward.
Excerpt from The Unbroken copyright © 2021 by Cherae Clark.
Titel der Englischen Originalausgabe: »The Bone Ship’s Wake – The Tide Child Trilogy – Book 3« by R. J. Barker, published 2020 by Orbit Books, London, UK.
Deutsche Ausgabe 2023 Panini Verlags GmbH, Schloßstr. 76, 70176 Stuttgart.
Alle Rechte vorbehalten.
Geschäftsführer: Hermann Paul
Head of Editorial: Jo Löffler
Head of Marketing: Holger Wiest (E-Mail: [email protected])
Presse & PR: Steffen Volkmer
Übersetzung: Michaela Link
Lektorat: Mona Gabriel
Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart
Satz und E-Book: Greiner & Reichel, Köln
YDTIDE003E
ISBN 978-3-7569-9999-6
Gedruckte Ausgabe:
1. Auflage, April 2023, ISBN 978-3-8332-4329-5
Findet uns im Netz:
www.paninicomics.de
PaniniComicsDE
Für meinen Vater,
der mir die Romantik und Schönheit
von Segelschiffen näher gebracht hat
Inhalt
Teil 1 – Der Schwarze Pirat
Das schreckliche Hier und das schreckliche Jetzt
Das schreckliche Jetzt und das schreckliche Hier
Der Schwarze Pirat
Wieder auf See
Und ich habe ein stattliches Schiff gesehen
Der Grund dafür
Blut auf dem Wasser
Ein gut ausgeführter Plan
Die offene See
Das Abwarten
Die Last
Das Meer hasst Diebe
Ein Untergang von langsamem, majestätischem Schrecken
Giganten der Tiefe
In den Tiefen das blauste Eis
Die Geister im Nebel
Der Nebel und die Geister
Ein mit Blut gelöstes Rätsel
Die Rückkehr des Meeresriesen
Teil 2 – Die Schiffsfrau
Die mit dem Fluch beladen sind, die Zukunft zu kennen
Kein sicherer Hafen für die Toten
Die Einsamkeit des Kommandos
Ein Spaziergang
Unter den Verzweifelten
Die Frau und der Diener
Die Überfahrt
Das Deckkind
Die Folgen
Eine Heimkehr
Die sterbende Stadt
Die Bekannte
Und dann trafen sie sich spätnachts
Die Frau im Dunkeln
Die Entscheidung
Auf die Probe gestellt
Der Austausch
Dem Ende entgegen
Eine Vereinbarung
Das Treffen
Wie die Wyrmschwester geentert wurde
Die Flucht
Die Verzweifelten
Nur der Tag der Vollstreckung ist noch offen
Das Gericht der Vögel
Ein Treffen von Liebenden
Die letzte Flucht
Für alle, die fliegen: fliegt schnell, fliegt weit
Teil 3 – Im Sog der Schiffe
Ankünfte und Abreisen
Letzte Sichtung – erste Sichtung
Die Wende
Der Knoten wird geschnürt
Die Schlinge zieht sich zu
Ein Tag des Schreckens
Die letzte Schlacht
Die Bucht
Ruiniert und am Ende
Ihr letztes Kommando
Die Tide wich so weit zurück,
Dass das Schiff auf dem Trockenen lag.
Ihr dürft das Kind nicht opfern,
Rief das Meer mit dem Wellenschlag.
Doch die Hexenpriester wollten nicht hören:
»Das Mädchen stirbt am heutigen Tag.«
Die Dreizehnbern rief aus:
»Auf die Schiffe mit dem Kind!«
Doch das Meer kam zu ihrer Rettung,
Sobald die Worte der Bern hingen im Wind.
Aus: »Das Lied der Glücklichen Meas«
Teil 1
Der Schwarze Pirat
1
Das schreckliche Hier und das schreckliche Jetzt
Wellen wie Bauwerke. Gewaltig und kalt, brutal und scheußlich. Wellen, die über alles hinwegbranden, über Schall und Sicht und Sinne. Wellen, die einem den Atem rauben. Wellen, die einen nach Luft schnappen lassen. Unaufhaltsame, quälende Wellen.
»Und wie genau erweckt Ihr die Meeresdrachen, Meas Gilbryn?«
Mit den zurückweichenden Wellen, mit dem abflauenden Sturm klingt auch die Qual ab und hinterlässt tausend andere, schwächere Schmerzen. Die Haut an ihren Handgelenken und Fußknöcheln, wo die Seile sie an den Stuhl fesseln, wund und aufgeschürft, nachdem sie sich wieder und wieder gegen ihre umeinander gewundenen Fesseln gestemmt hat. Das Nagen des Hungers in ihrem Bauch, das Kratzen in ihrer Kehle von ihren Schreien, der Schmerz ihrer Füße, von den gebrochenen und nie richtig verheilten Zehen. Das Spannen der Kleider auf ihrem Rücken über den Striemen, die die Schläge der Knute hinterlassen haben.
Das Pochen eines kranken Zahns hinten in ihrem Kiefer, etwas, worauf diese Leute noch nicht aufmerksam geworden waren. Daraus schöpft sie ein winziges bisschen Trost. Dieser eine kleine Schmerz gehört ihr, ihr ganz allein, ein winziger Schmerz, den sie sich zunutze machen könnten, es aber nicht getan haben. Noch nicht. Eines Tages werden sie genau das tun, daran besteht keinerlei Zweifel. Sie sind, was Meas’ Schmerzen angeht, genauso penibel wie hinsichtlich der Art und Weise, auf die sie sich um sie kümmern. Aber heute ist es ein kleiner Sieg über ihre Peiniger, den sie für sich beanspruchen wird.
»Ich weiß nicht, wie man einen Meeresdrachen ruft.«
Ein Seufzen. Meas öffnet die Augen und sieht die Hexenpriesterin vor sich auf einem Hocker sitzen. Sie ist wunderschön, diese junge Frau. Ihre braunen Augen sind klar, ihre dunkle Haut ist makellos und schimmert in dem Licht, das durch das vergitterte Fenster hereindringt. Ihr weißes Gewand ist – angesichts ihres Berufs ein wahres Wunder – frei von Blut oder sonstigen Flecken, als sie das Brenneisen nun in die Kohlenpfanne zurücklegt. Meas riecht ihr eigenes verschmortes Fleisch. Es lässt ihr vor Hunger das Wasser im Mund zusammenlaufen, obwohl ihr zugleich der Schmerz von den Brandwunden qualvoll durch die Narben schneidet.
Sie fügen ihr die Brandwunden hinten an der Wade zu. Ganz so, als wollten sie nicht, dass ihr grausames Werk sofort auffällt.
»Das könnte alles aufhören, Meas, Ihr braucht nur die Wahrheit zu sagen.«
Sie sagt ihnen schon seit Wochen die Wahrheit, aber sie glauben ihr nicht. Und so fängt sie wieder an derselben Stelle an. An derselben Stelle, an der sie immer anfängt: »Man pflegt mich mit meinem Titel Schiffsfrau anzureden. Und wenn meine Mutter meine Geheimnisse wissen will, dann sagt ihr, sie soll herkommen und mich darum bitten, sie ihr zu sagen.«
Lachen über ihre Worte. Immer Lachen.
»Ihr seid nicht wichtig genug, um mächtige Leute hier herunterkommen zu lassen«, erklärt ihre Peinigerin. Sie steht auf, geht in den hinteren Teil des kleinen, sauberen weißen Raums und öffnet einen Schrank. »Ihr solltet wissen, dass ich die Allergeringste meines Ordens bin, die Unbedeutendste der Novizinnen. Und ich fürchte, ich bin alles, dessen man Euch für würdig erachtet.« Sie nimmt sich einen Moment Zeit, begutachtet die Regale und trifft ihre Wahl unter den Folterinstrumenten, die dort aufbewahrt werden. Schließlich entscheidet sie sich für eine Rolle aus Varisk-Tuch, die sich in ihren Armen biegt und in der bei jeder Bewegung die darin verborgen Werkzeuge klirren. Meas’ Herzschlag beschleunigt sich, als die Hexenpriesterin zurückkehrt und ihr gegenüber Platz nimmt.
»Ich weiß, dass ich wichtig bin«, betont Meas, während sich Schweißperlen auf ihrer Stirn bilden, »und ich weiß auch, dass meine Mutter hier herunterkommt, denn ich habe Euch draußen vor der Tür mit ihr reden hören. Ich kann euch hören, ganz gleich, wie leise ihr sprecht.« Sie ist sich da ganz sicher.
Die Hexenpriesterin lächelt und legt die Rolle aus Varisk-Tuch auf einen kleinen Tisch neben der Kohlenpfanne.
»Es tut mir leid, Euch enttäuschen zu müssen, Schiffsfrau Meas, aber das ist nur eine andere Frau aus meinem Orden gewesen. Nach allem, was mir gesagt wurde, hat Eure Mutter nie auch nur davon gesprochen, hier herunterzukommen.« Sie sieht Meas eindringlich an. »Sie hat Euch noch nicht einmal erwähnt.«
Bei diesen Worten zerbricht etwas Kleines, aber Bedeutsames in ihr. Sie ist sich so sicher gewesen. Aber die Worte der Hexenpriesterin klingen ehrlich und glaubhaft.
»Jetzt, Schiffsfrau Meas, wollen wir uns einmal Eure Hände ansehen.« Die Finger der Hexenpriesterin sind sanft, als sie Meas berührt, weich und so ganz anders als Meas’ eigene Hände – von den langen Jahren auf See hart und schwielig. Aber sie sind auch kräftig, als sie Meas nun zwingt, die Fäuste zu öffnen, zu denen sie ihre Hände geballt hat. »Die Nägel sind bemerkenswert gut nachgewachsen«, bemerkt die Hexenpriesterin. »Wenn sie aus dem Nagelbett gerissen werden, wachsen sie manchmal missgebildet nach oder auch überhaupt nicht mehr. Aber Ihr seid stark.« Sie lässt Meas’ Hand los und wendet sich dem Tisch zu, rollt das Varisk-Tuch auseinander, um die Werkzeuge darin zu enthüllen: eine Reihe von Zangen verschiedener Größen mit seltsamen Greifbacken und Köpfen, wiewohl Meas mit ihnen inzwischen viel vertrauter ist, als sie sich das je gewünscht hätte. Die Hexenpriesterin lässt sich wählerisch Zeit, nimmt erst eine Zange heraus und inspiziert sie, dann die nächste. »Es ist betrüblich für Euch, dass Ihr ein so wichtiges Geheimnis hütet. Und wohl auch betrüblich für mich. Ich muss vorsichtig mit Euch sein, ach, so vorsichtig, und wir müssen uns Zeit lassen. Wären Eure Geheimnisse weniger wichtig, wäre unsere Beziehung weitaus erfreulicher.« Sie lässt eine Zange vor Meas’ Gesicht klacken.
Auf. Zu.
Auf. Zu.
»Womit ich meine, dass es für Euch eine kurze Beziehung gewesen wäre, Schiffsfrau. Oh, qualvoll, in der Tat, viel qualvoller als alles, was ich Euch bisher habe durchleiden lassen. Aber Ihr hättet es mir gedankt, wenn ich das Messer hervorgeholt hätte, um Euch zur Hexe zu schicken, wenn es das Euch bestimmte Schicksal ist.« Sie legt die Zange zurück. Nimmt eine andere, kleinere heraus.
Auf. Zu.
Auf. Zu.
Sie wendet sich zu Meas um. »Häufig bedanken sie sich wirklich bei mir, wisst Ihr? Menschen haben so viele Geheimnisse und sie werden ihnen zur Last. Ich verschaffe ihnen die Möglichkeit, sich von dieser Last zu befreien. Und ich lasse den Schmerz enden.« Sie öffnet noch einmal mit Gewalt Meas’ Hand und schließt die Zange um das Ende des Nagels an Meas’ längstem Finger. Ein langsam wachsender Druck im Nagelbett. »Sie weinen, Meas. Sie bedanken sich bei mir, und sie weinen vor Freude, wenn ich ihrem Leben ein Ende setze.« Mehr Druck; kein Schmerz, noch nicht. Nur dessen Ankündigung. »Jetzt erzählt mir doch, wie erweckt Ihr die Arakeesianer, Meas Gilbryn?«
Meas starrt in die Augen ihrer Folterin und kann kein Mitleid in ihnen entdecken. Schlimmer noch, sie ist sich sicher, dass die Frau dennoch davon überzeugt ist, Mitgefühl für Meas zu empfinden. Dass sie glaubt, eine Frau zu sein, die eine wichtige Aufgabe erfüllt, wie unangenehm sie auch sein mag. Und dass sie Meas wirklich und aufrichtig bemitleidet. Dass sie glaubt, es sei doch ein Jammer, dass Meas’ Ende nicht schnell, wenn auch qualvoll über sie kommen kann. Druck und Schmerz in ihrem Nagelbett werden stärker und stärker. Und sie weiß, wie sie es schon so viele Male zuvor gewusst hat, dass sie es nicht mehr länger ertragen kann.
»Ich kann keine Keyshan erwecken.« Worte wie Scham brennen in ihrer Kehle, als seien sie giftig. Sie bringen Tränen und ein ersticktes Schluchzen mit sich. »Es ist mein Deckwahrer, Joron Twiner. Der Gullaime nennt ihn Rufer, und sein Gesang weckt die Keyshan aus ihrem Schlaf und ruft sie herauf.«
Die Hexenpriesterin sieht ihr in die Augen. »Dieselben Lügen, Meas, sie werden nicht wahrer, nur weil Ihr sie wiederholt. Aber ich bewundere Eure Kraft. Wir werden Euren Deckwahrer aufspüren, keine Bange, und ich werde mich mit ihm unterhalten.«
Meas wappnet sich, gefasst auf das Abreißen des Nagels und die damit verbundene Qual. Doch stattdessen verschwindet der Druck.
»Ich glaube, meine liebe Meas«, beginnt die Hexenpriesterin und streichelt ihr die Wange, »für heute sind wir fertig. Ihr seid müde und braucht Ruhe. Denkt über den heutigen Tag nach und darüber, was uns die Zukunft bringen mag. Denkt über Eure Geheimnisse nach und darüber, was Ihr mir anvertrauen könntet, um Eurem Schmerz ein Ende zu machen.« Sie rollt ihre Werkzeuge wieder zusammen, geht zum Schrank hinüber und legt die Rolle hinein. »Ich lasse die Seewacht kommen, sie soll Euch in Eure Räume zurückbringen. Ich habe ein Bad für Euch vorbereiten lassen.« Sie dreht sich um, tritt wieder neben Meas und wechselt dann von sanft zu brutal. Umfasst Meas’ Gesicht und drückt ihren Kopf nach hinten, sodass sie durch Tränen der Scham zu der Hexenpriesterin aufschauen muss. »Ihr seid eine gut aussehende Frau, wisst Ihr das? Ihr seht wirklich sehr hübsch aus.« Sie beugt sich dicht zu ihr. »Ich hoffe«, flüstert sie, »wenn ich nur freundlich genug darum bitte, werden sie mich eines Eurer Augen herausreißen lassen.«
Die Hexenpriesterin lässt sie los und geht davon, und Meas bleibt mit zwei widersprüchlichen Gedanken zurück, die in ihrem Kopf miteinander ringen:
Joron, wo bist du? Du hast gesagt, du würdest kommen,
und:
Joron, halt dich fern von mir. Was immer du tust, sie dürfen dich auf keinen Fall in ihre Gewalt bringen.
2
Das schreckliche Jetzt und das schreckliche Hier
Skeariths blindes Auge hatte sich geschlossen, und Deckwahrer Deere schritt durch eine Nacht, so dick und schwarz wie geronnenes Blut. Das sanfte Zischen des Meeres am Ufer war wie ein Luftholen – ein und aus und aus und ein. Das Knirschen von Schindeln unter ihren Stiefeln, als sie auf den Wachturm zuging. Auf dem steinernen Pier die Leiter hinauf und weiter über den Steg aus stabilem Varisk, gehärtet und vom Alter geschwärzt. Der Wind strich ihr übers Gesicht, bislang nur eine kühlende Brise, aber bald würde er zu der schneidenden Kälte der schlafenden Zeit des Jahres werden, wenn eine Schicht Eis alles in Windherd bedecken und die Knochenschiffe in den Hafen einfahren würden, schwer von Eis so weiß wie ihre Rümpfe, um neue Vorräte aufzunehmen, bevor sie ihre Patrouillenfahrten durch die nördlichen Gewässer wieder aufnahmen. Jetzt waren sie nicht mehr so zahlreich wie früher, diese Knochenschiffe, und sie kamen auch nicht mehr so oft hierher. Das Meer war gefährlicher denn je. Keyshan streiften unter den Wellen umher, und nicht nur Keyshan; noch viel Schlimmeres lauerte dort draußen auf dem Wasser.
Sie legte die Hand auf den Griff des Schwertes an ihrer Hüfte, um sich Mut zu machen.
»Bern, gebt auf mich acht«, murmelte sie, um sich dann daranzumachen, die Leiter zum Turm hinaufzuklettern – die Sprossen so kalt, dass ihre Hände davon taub wurden.
»D’wahrer.«
»Habt Ihr irgendetwas gesehen, Tafin?«
Der Mann schüttelte den Kopf. Er kauerte hier in geduckter Haltung und war zum Schutz vor der nächtlichen Kälte in dicke Gewänder gehüllt. »Alles still.«
Ein Luftzug auf ihrem Gesicht.
»Der Wind scheint aufzufrischen«, bemerkte sie. »Ich spüre es, wenn ich mich dem Meer zuwende.« Sie sah, wie das Deckkind das Gesicht verzog, und wusste, dass der Mann anderer Meinung war als sie. Eine dieser vielen hundert unterschwelligen Arten, wie die alten Seehasen einen wissen ließen, dass man etwas Falsches oder Dummes gesagt hatte. »Was ist denn, Tafin?« Sie wartete auf seine nachsichtigen Belehrungen. Sie mochte ihn, und er vermittelte ihr niemals das Gefühl, dumm zu sein.
»Wisst Ihr, zu dieser Jahreszeit weht der Wind immer seewärts. Ihr …« Er brach ab.
Etwas Dunkles vor dem Hintergrund der Dunkelheit. Eine Form, die sich aus der Nacht löste. Ein Schiff auf dem Wasser, aber es tanzten keine Leichenlichter darüber. Sein Herannahen hatte nichts, was auf ehrliche Absichten schließen ließ. Ein schwarzes Schiff, das getrieben von den Winden eines Gullaime schnell näher kam, und noch bevor sie ihren Mund öffnen konnte, kam von Tafin bereits der Ruf und zugleich auch von dem Deckkind auf dem anderen Turm. Panik in ihren Stimmen.
»Schwarzes Schiff in Sicht!«
»Schiff in Sicht!«
Und sie war bereits wieder halb vom Turm herunter, rutschte über die Sprossen. In der Stadt und auf den Hafendocks läuteten Alarmglocken, und sie wusste, dass alle Frauen und Männer sich jetzt ihre warmen Kleider überstreiften und nach ihren Waffen griffen.
Von Angst erfüllt.
Ihre Füße schlugen auf dem Stein des Piers auf und sie stolperte, als sie das Stöhnen des Krieges hörte, ihr das Heulen des Windes über die straff gespannten Sehnen der Schreckensbogen laut und vernehmlich an die Ohren drang. Die vertrauten Geräusche des Abfeuerns, das hohe, elastische Pling der Sehne, das Knallen von Bogenarmen, die nach vorn schlugen, und das Pfeifen der Flügelbolzen. Einen Moment später erklang laut das Geräusch von berstendem Varisk und Gion, und Schreie von Deckkindern erhoben sich, als die Türme von schweren Steinen getroffen wurden. Es war zu dunkel, um den Turm am anderen Ende auszumachen, aber sie hörte das Stöhnen und Krachen des Baus aus Varisk, als er nun in die Tiefe kippte, hörte sein lautes Aufklatschen im Wasser. Wusste, dass der Turm zerstört war. Dann warf sie sich zu Boden, als sie hörte, dass auch der Turm hinter ihr einstürzte. Rollte sich herum, als müsse sie das gewaltige, alles zermalmende Gewicht, das da auf sie zukam, mit dem Gesicht voraus in Empfang nehmen. Als müsse sie ihrem Tod tapfer entgegentreten. Aber im letzten Moment nahm sie die Hände nach oben – ein instinktiver Reflex, wenngleich sie nicht wusste, welche Hilfe sie sich von ihren dünnen Armen bei dem vergeblichen Versuch versprach, das vereinte Gewicht dieser zerstörten Masse aus Gion- und Varisk-Brettern abzuwehren. Zuletzt schrie sie.
Verspürte Scham.
Schock.
Entsetzen, als Tafin neben ihr landete, sein Schädel zerschmettert, sein Körper von Spieren durchbohrt. Ein Geruch wie in einer Schlachtergasse.
Aber sie lebte.
Hatte die Hexe sie heute mit ihrem Lächeln bedacht? Nicht mal die kleinste Wunde hatte sie davongetragen, wo doch der Wachturm überall rings um sie herabgestürzt war. Sie rollte sich herum. Starrte in den Hafen hinaus, als das schwarze Schiff vorbeiglitt. Die Besatzung warf Laternen über die Bordwand. Zuerst dachte sie, es sei als Beleuchtung für die Bogenschützen in der Takelage, aber darum ging es nicht. Kein Pfeil und kein Armbrustbolzen bohrte sich ihr ins Fleisch; man hatte sie entweder nicht gesehen oder man interessierte sich nicht für sie. Nein, diese Lichter waren nicht dazu bestimmt, sie ausfindig zu machen, sie waren vielmehr dazu gedacht, dass Menschen wie sie dieses Schiff sehen konnten. Dass sie den grausamen Keyshanschnabel sehen konnten, der seinen Bug krönte. Dass sie die spitzen Stacheln und Grate sehen konnten. Und die Totenschädel, die über die Knochenrelings an den Seiten verteilt waren, und dass sie unter den hellsten Lampen den Namen lesen konnten. Den meistgefürchteten Namen auf den Hundertinseln, den Namen des meistgesuchten Schiffes.
Gezeitenkind.
Als das Schiff vorbeiglitt, sah sie seine Besatzung, sah die schlachtbereit aufgestellten Deckkinder, die nach Blut und Beute schrien, sah die Leute von der Seewacht der Gezeitenkind, starr wie Standbilder, in Kleidern so schwarz wie das Schiff. Sah den Gullaime, leuchtend bunt in dicken Gewändern und umringt von sechs seiner Artgenossen in geisterhaftem Weiß. Sah den Kommandostab im Ruderbereich. Die Frau mit den Brandnarben, die gewaltigen, hexenverfluchten Gestalten von Muffaz und Barlay Ruderdreher. Und zwischen ihnen allen stand er. Völlig reglos und in Lumpen gehüllt, selbst noch sein Gesicht bedeckt, alles bis auf seine Augen verborgen. Hatte er sich umgewandt, als das Schiff sie passierte? Hatte er sie auf dem Boden gesehen? Sie beobachtet, als er in den Hafen hineinglitt? Ein Angstschauer durchlief sie, denn keine Frau und kein Mann stellte eine größere Gefahr für die Flotte der Hundertinseln dar als dieser Mensch.
Der Schwarze Pirat war nach Windherd gekommen.
Und wo der Schwarze Pirat hinging, folgten Tod und Feuer.
Sie hörte seine Stimme, laut, aber brüchig, wie das Krächzen eines Skeers.
»Bringt das Schiff landwärts. Alle Bogen bereithalten. Gebt meinen Bolzen Feuer, meine Mädchen und Jungen, und schießt gut.«
Bei diesem Befehl wusste sie, dass ihre einzige Hoffnung – dass die Verlorene Jungfer, der im Hafen vertäute Zweiripper, sie retten könnte – dahin war. Oh, die Gezeitenkind mochte durchaus ein Pirat sein, aber ihre Besatzung hatte das Schiff gut im Griff, lenkte es so flott und präzise wie kaum ein anderes Schiff. Es drehte bei und schob sich an die Seite der Verlorenen Jungfer. Deere schmerzten die Ohren, als nun die Gullaime ihre Künste spielen ließen, um das Schiff zu bremsen.
Feuer schoss durch die Nacht von der Gezeitenkind in einer einzigen vernichtenden Salve aus ihren großen Schreckensbogen sowie aus ihren Unterdeckbogen in das kleinere Schiff hinein. Danach stand alles in Flammen. Keine Lampen waren mehr nötig. Boote wurden von der Gezeitenkind abgelassen und weitere schwarze Schiffe wurden durch die Hafenzufahrt gesteuert. Ein Enterhaken klirrte gegen den Stein des Piers, als ein kleineres schwarzes Schiff zum Stillstand kam, und dann war Deere auf den Beinen und rannte, so schnell sie konnte, in Richtung Stadt. Sie war verletzt, ohne zu bluten, hatte Prellungen davongetragen. Sie konnte nur humpeln, im Bewusstsein, dass hinter ihr weitere Enterhaken folgen würden. Sie würden das Schiff seitlich an den Pier heranziehen. Piraten würden ans Ufer schwärmen.
Wie schnell sich die Welt verändert hatte. Noch vor wenigen Minuten war sie so kalt und frisch und grau gewesen wie in jeder anderen Nacht. Jetzt war alles ein Albtraum, und das Licht des Feuers verwandelte Deeres Welt in eine krachende, schreiende Szenerie voller zuckender Schatten.
Das Geräusch von Füßen. Von rennenden Menschen. Waren das ihre eigenen Füße oder die der anderen? Sie warf sich zwischen zwei Gebäude, als eine Gruppe von Deckkindern vorbeigeeilt kam. Waren das ihre eigenen Leute? Oder die der anderen? Sie wusste es nicht. Sie rannte in Richtung Hauptplatz, wo die Verteidiger zu finden sein müssten. War Schiffsfrau Halda auf der Verlorenen Jungfer gewesen? Sie hoffte nicht, denn Schiffsfrau Halda war der einzige Offizier auf der Insel mit zumindest ein wenig Kriegserfahrung; sollte die Verteidigung jetzt Schiffsfrau Griffa zufallen, die noch nie in ihrem Leben mehr kommandiert hatte als einen Ladekran, von einer Flotte ganz zu schweigen, dann wären sie jetzt schon verloren.
Rennen. Weiter. Weiter.
Hinaus auf den Platz, wo überall gekämpft wurde. Sollte hier zuvor noch Ordnung geherrscht haben, so hatte sie sich inzwischen aufgelöst. Tote auf dem Boden, von Armbrustbolzen durchbohrt. Sie wäre beinahe an ihrem eigenen Schwert hängen geblieben, als sie es nun zückte. Hieb damit auf die kaum erkennbaren Gestalten um sie herum ein. Doch sie hatte keine Ahnung, wer sie waren. Ihre eigenen Leute oder der Feind? Schwer atmend, voller Angst. Sie wusste es nicht. Sie hatte viel zu große Angst, um sich darum zu kümmern.
Zuschlagen. Schlitzen. Blut. Schreie. Gebrüll.
Sie wollte leben. Das war alles, worum es ihr ging. Mitten zwischen den auf und ab wogenden Leibern. Den rennenden Leibern. Den panischen Frauen und Männer. Sie wollte leben.
Sie fand einen Platz zum Stehen. Das Feuer des brennenden Schiffs tauchte die Gebäude in einen orangefarbenen Schein, verwandelte ihre Umrisse, machte alles fremdartig. Seltsame, schreiende, grimmige Gesichter tauchten aus der Nacht auf. Sie stieß ihr Schwert nach einer Gestalt. Spürte Widerstand, als ihre Klinge pariert wurde. Taumelte zurück. Fand sich direkt einer schmalen Frau gegenüber, mit verkniffenem Gesicht und bösartigen Augen.
»Komm zu Cwell, Mädel!«, rief die Frau.
Angst rauschte ihr durch die Adern. Diese Frau war der Schatten des Schwarzen Piraten. Deere stürzte sich auf sie. Der Schatten wehrte ihren Angriff ab, verdrehte ihre Klinge und zog sie ihr aus der Hand; dann warf die schmale Frau sie mit einem harten Schubser der Länge nach rückwärts in den Dreck.
»Tötet mich nicht!« Erneut gingen ihre dünnen Arme nach oben.
»Ihr seid Offizier, nicht wahr?«, fragte der Schatten.
»Deckwahrer«, brachte sie hervor und verfluchte sich dafür, dass sie bei der Nennung ihres Rangs vor Angst stotterte.
»Gut, dann wird er wohl mit Euch sprechen wollen.« Der Schatten schwang das schwere Ende seines Curnows und alles war Dunkelheit.
Aufwachen. Blut im Mund schmecken. Die Wärme von Skeariths Auge auf ihrem Gesicht. Das Geräusch der Skeer in der Luft. Die Geräusche von Frauen und Männern auf dem Boden. Weinen und Betteln und Lachen. Das Brennen von Seilen um ihre Handgelenke und Fußknöchel. Sie öffnete die Augen. Sie lag ein Stück oberhalb des Strandes auf der Seite. Schwarze Schiffe füllten den Hafen. Reihen von Frauen, Männern und Kindern knieten im Sand. Alle gefesselt.
Sie versuchte sich zu bewegen. Stöhnte.
»Da ist noch eine wach.« Eine Stimme hinter ihr.
»Dann bringt sie her, je schneller es vorbei ist, umso schneller können wir von hier verschwinden. Ich habe Brekir sagen hören, dass Knochenschiffe der Flotte in der Nähe sind.«
Ein plötzliches Aufflammen von Hoffnung in ihrer Brust. Sie rollte sich herum, sah die Galgen. Vier Menschen hingen daran. Ein fünfter, Schiffsfrau Griffa, da war sie sich sicher, stand mit einem Seil um den Hals auf einem Fass. Der Schwarze Pirat vor ihr. Er trat einen Schritt zurück, hob sein Bein mit dem Knochensporn als Fuß und stieß das Fass mit einem Tritt beiseite. Schiffsfrau Griffa fiel herab, ihr Sturz von dem Seil abrupt gestoppt. Sie schwang wie ein Pendel hin und her, als sich die Schlinge zuzog und sie strampelnd nach Luft rang. In diesem Moment wurde Deere hochgehoben, das Seil zwischen ihren Knöcheln aufgeschnitten, und fast hätten ihre Beine unter ihr nachgegeben. Aber die Deckkinder kümmerten sich nicht darum. Sie zerrten sie über das Dock, vorbei an den johlenden Deckkindern der schwarzen Schiffe. Schließlich schaffte sie es, die Kontrolle über ihre Füße wiederzuerlangen und aufrecht zu stehen, während ihre Feinde ein weiteres Seil über den Querbalken des improvisierten Galgens warfen. Sie legten ihr die Schlinge um den Hals. Stellten ein Fass auf und hoben sie darauf. Zogen an dem Seil, bis sie auf den Zehenspitzen balancieren musste, um atmen zu können.
Erst jetzt trat der Schwarze Pirat auf sie zu.
Er trug seinen Namen zu Recht. Nicht nur seine Haut war dunkel, soweit sie das sehen konnte, sondern auch seine Kleidung. Schwarze Stiefel, schwarze, eng anliegende Hose, schwarzer Überrock und ebenso schwarzer Mantel. Ein schwarzer Schal war um sein Gesicht geschlungen, sodass nur seine Augen sichtbar waren. Augen voller Dunkelheit.
»Euer Name und Euer Rang?«, fragte er. Seine Stimme klang überraschend melodisch.
»Vara Deere. Ich bin Deckwahrer der Verlorenen Jungfer.«
»Tja, Vara Deere«, antwortete er. »Ich fürchte, Euer Schiff gibt es nicht mehr und Euer Rang ist für mich bedeutungslos.«
»Ihr verbergt Euer Gesicht«, sagte sie. Offenbar wurde sie im Angesicht des Todes mutiger, als sie das von sich gedacht hätte. »Liegt das daran, dass Ihr Euch für das schämt, was Ihr seid? Dass Ihr Euch dafür schämt, dass Ihr die Hundertinseln verratet? Ihre braven Bewohner und getreuen Seeleute tötet?«
Er musterte sie aus braunen Augen. »Ich habe meine eigenen Gründe, mein Gesicht zu verdecken, und Scham gehört gewiss nicht dazu«, antwortete er, und es überraschte sie, da sie gar nicht mit einer Erwiderung gerechnet hatte. »Und was den Verrat betrifft: Verrat ist alles, was ich von den Hundertinseln je erlebt habe. Wundert es Euch da, dass ich es mit gleicher Münze zurückzahle?«
»Ihr seid Offizier gewesen«, sagte sie, und als er antwortete, lag Gift in seiner Stimme.
»Ich war ein Verurteilter, Vara Deere, und bin nie etwas anderes gewesen. Ich wurde zum Sterben verurteilt und im Tod habe ich einen Sinn gefunden.« Er trat näher heran. Er roch falsch, übertrieben süß, als habe er in einer zuckrigen Salbe gebadet. »Gut, ich habe Eure Frage beantwortet. Wollt Ihr jetzt meine beantworten?« Er wartete ihre Reaktion nicht ab, sondern zischte ihr nur seine Worte entgegen. »Wo ist sie?«
»Wer?«
»Schiffsfrau Meas Gilbryn, die Glückliche Meas, die Hexe von der Kielhulme-Peilung. Ich weiß, dass die Dreizehnbern Gilbryn sie in ihrer Gewalt hat. Also, wo ist sie?«
»Ich …« Sie fragte sich, ob er wohl verrückt war, wenn er annahm, ein niederer Deckwahrer von einem Zweiripper in jämmerlichem Zustand am hintersten Ende der Hundertinseln wüsste über solche Dinge Bescheid. »Ich habe keine Ahnung.«
Er trat zurück und sie machte sich auf das nun zweifellos Kommende gefasst. Aber er war noch nicht fertig mit ihr.
»Wollt Ihr mir dienen, Vara Deere? Ich habe Offiziere mehr als genug«, erklärte er. »Aber ich kann immer neue Deckkinder gebrauchen.«
Sie starrte ihn an und fand in diesen dunkelbraunen Augen etwas, das sie nicht verstand. Fast als flehe er sie an, Ja zu sagen. Sich ihm bei all dem Plündern und Zerstören der Hundertinseln anzuschließen, dem der Schwarze Pirat über das vergangene Jahr hinweg gefrönt hatte, mit der Folge, dass sämtliche Knochenschiffe der Inseln nach ihm suchten, um seiner Schreckensherrschaft ein Ende zu bereiten.
Sie richtete sich auf dem Fass ein wenig höher auf. »Sie werden Euch kriegen, und dann werden sie Euch hängen«, verkündete sie. »Also würde ich, indem ich mich Euch anschließe, meinen Tod nur ein wenig hinauszögern.« Sie straffte die Schultern. Sie erhob ihre Stimme und sprach so laut, wie sie konnte. »Ihr und Eure Deckkinder seid nichts als mordende Tiere. Und ich gehöre zur Flotte. Ich werde mich Euch nicht anschließen.« Er musterte sie. Nickte.
»Gut«, erwiderte er. »Was Euren Tod betrifft, dürftet Ihr wohl durchaus recht haben, Deckwahrer Deere. Und ich bewundere Eure Pflichttreue. Ich will am Knochenfeuer der Hexe nur allzu gern mit Euch anstoßen.« Dann trat er das Fass unter ihr weg, und das Seil schnitt sich ihr in den Hals, und alles, was von ihr noch übrig war, konzentrierte sich auf einen einzigen Punkt, ein verzweifeltes Verlangen nach Luft.
Dann Dunkelheit.
Alles war Dunkelheit.
3
Der Schwarze Pirat
Er hatte zunächst eine Zusammenkunft im größten Haus von Windherd in Erwägung gezogen, einem alten Gebäude, das ebenso von den Ranken der Schlingpflanzen wie von seinem geschickt ineinandergefügten Mauerwerk zusammengehalten wurde. Aber am Ende war er zu dem Schluss gekommen, dass es besser sei, sich in den vertrauten Wänden der großen Kabine der Gezeitenkind zu treffen. Über sich hörte er das Poltern von Füßen an Deck, während seine Offiziere – sein Deckhalter Farys, sein Ruderdreher Barlay, Jennil, die als seine Stellvertreterin galt – ihre Befehle riefen und alle an Bord des Schiffes ihre Aufgaben verrichteten. Neben ihm stand Aelerin, sein Kursleger, und hinter ihm Cwell, sein Schatten. Nur wenige betrachteten sie ohne eine gewisse Furcht, denn sie war eine Frau, die Gewalttätigkeit nicht nur ausstrahlte, sondern auch genoss, sogar darin schwelgte.
Doch damit war sie nicht allein. Schiffsfrau Coult von der Schlauen Schwester raubte und plünderte mit großer Begeisterung, genauso wie Turrimore von der Blutskeer und Adrantchi von der Schnabelwyrms Freude, und Twiner unternahm keinerlei Versuche, ihnen da Einhalt zu gebieten. Andere, weniger rigorose Schiffsfrauen hatten sich ebenfalls zu ihm gesellt: Brekir von der Knurrzahn stand neben ihm, immer treu ergeben, dazu Chiver von der Letztes Licht und Tussan von der Skeariths Schnabel. Sechs schwarze Schiffe im Hafen und schon das allein beunruhigte Joron Twiner. Diesen Punkt musste er als Erstes ansprechen.
»Willkommen, Schiffsfrauen. Windherd gehört jetzt uns.«
»Alle, die sich uns anschließen wollen, werden auf die Schiffe gebracht«, berichtete Coult. »Für diejenigen, die das nicht wollen, wird gesorgt.«
»Er meint, dass sie zu den Hageren Inseln gebracht werden, Deckwahrer Twiner«, schaltete Brekir sich ein.
»Falls wir genug Platz haben«, fügte Coult hinzu, aber nicht laut, nicht an alle Anwesenden im Raum gewandt. Er äußerte die Worte nur leise, um ihre Wirkung zu testen.
»Ich bin mir sicher, dass wir den nötigen Platz finden können«, erklärte Joron. »Aber zunächst zu den Seekarten. Sechs Schiffe an einem Ort sind zu viele, daher möchte ich Euch mitteilen, welche Eure nächsten Schritte sein sollten. Aelerin, wenn Ihr so freundlich sein wollt.«
Der Kursleger trat vor, seine Gewänder leuchteten weiß zwischen der schwarzen Kleidung von Twiners Schiffsfrauen. Er breitete eine Karte auf dem Tisch aus.
»Wir befinden uns hier«, sagte der Kursleger, und seine weiche Stimme füllte den Raum aus. »In Windherd. Der Großteil der Flotte der Hundertinseln hat sich zurückgezogen, um näher an der Insel Schiffshulme zu sein, damit sie Bernshulme jetzt, wo wir ihre Flotte derart geschwächt haben, vor feindlichen Überfällen schützen können. Allerdings gibt es immer noch viele Patrouillen, und es sind einige große Schiffe auf See, die auf der Suche nach uns sind.«
»Also ist es wichtig, dass wir ihnen hier nicht in die Falle gehen«, meinte Joron. »Coult, ich möchte, dass Ihr die Blutskeer und die Schnabelwyrms Freude nehmt und Euch auf den Weg dorthin macht.« Er zeigte auf eine Insel. »Das ist eine weitere ihrer Inseln zur Lagerung von Waren und sie sollte nicht besser bewaffnet sein als dieser Ort hier.« Er schaute auf und Coult nickte. »Geht jetzt. Je weniger Zeit wir hier verbringen, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns hier festsetzen.«
»Und wenn ich unterwegs Schiffe von den Hundertinseln sehe, Deckwahrer Twiner?«
»Wenn sie klein sind, und Ihr sie erwischen könnt, versenkt sie. Aber schnappt Euch vorher ihre Offiziere und verhört sie. Seid auf der Hut; man könnte Euch in eine Falle locken.«
»Selbstverständlich werde ich auf der Hut sein.«
»Natürlich«, antwortete Joron. Dann wandte er sich der nächsten Schiffsfrau zu. »Brekir, nehmt die Knurrzahn, dazu Schiffsfrau Tussan und die Skeariths Schnabel, und macht Euch auf den Weg dorthin«, sagte er und tippte auf die Karte. »Taffinbur. Wir haben erfahren, dass es dort eine Art Nachrichtenstation gibt. Ich möchte, dass sie zerstört wird, und wenn Ihr die Nachrichten von dort an Euch bringen könnt und jemanden auftreibt, der die geheimen Codes versteht, dann wäre das umso besser.«
»Aye, das werde ich tun.«
»Gut. Ich nehme die Gezeitenkind und fahre in Begleitung von Schiffsfrau Chiver mit der Letztes Licht zurück zu den Hageren Inseln, um mit Zehnbern Aileen zu sprechen und herauszufinden, was sie mit uns vorhat. Wir haben genug Verwüstung angerichtet und die Hundertinseln auf Dutzende Arten geschwächt. Sie muss inzwischen bereit sein, Bernshulme anzugreifen.« Die anderen reagierten mit Lächeln und Nicken auf seine Worte. »Dann los, ich will nicht, dass wir hier überrumpelt werden.« Er wandte sich an Brekir. »Mit Euch möchte ich noch für einen Moment allein sprechen«, ließ er sie wissen.
Sie nickte und lächelte. Es war ihm eine liebe Gewohnheit geworden, sich nach einem Treffen noch mit ihr zu unterhalten, wenn er es irgendwie einrichten konnte. Sie warteten, bis die anderen Schiffsfrauen die Kabine verlassen hatten. Dann trat Brekir einen Schritt näher; er roch ihr persönliches Parfüm, eine Mischung aus über lange Zeit hinweg salzdurchtränkten Kleidern und dem erdigen Geruch des Gossels, den sie in ihrer Kabine verbrannte, um die Schmerzen langer Jahre auf See zu vertreiben und die Pein all der vielen Wunden und Gebrechen zu lindern, die ihr das eingebracht hatte.
»Es ist möglich, dass Meas gar nicht in Bernshulme ist, Joron«, gab Brekir zu bedenken.
»Sie muss dort sein«, widersprach er.
»Es ist jetzt ein Jahr her, Joron. Und niemand hat auch nur ein Sterbenswörtchen von ihr gehört.« Sie legte ihm sanft die Hand auf den Arm. »Vielleicht ist es ja an der Zeit, dass Ihr damit aufhört, Euch Deckwahrer zu nennen, und dass Ihr stattdessen den Zweispitz nehmt und …«
»Nein«, unterbrach er sie, und er wusste, dass dieses eine Wort schroffer herausgekommen war, als Brekir es verdiente. »Wenn alle Mittel und Wege erschöpft sind, wenn jede Insel durchsucht ist und wir nichts gefunden haben, dann werde ich mich vielleicht Schiffsfrau nennen. Aber sie ist die Glückliche Meas, Brekir.« Flehte er sie an, kam daher der spezielle Tonfall, den seine Worte angenommen hatten, das Stocken seiner Stimme? »Sie ist es, von der die Prophezeiung vom Gezeitenkind kündet. Sie wird die Menschen in Frieden zusammenführen. Sie kann nicht tot sein. Das ist einfach unmöglich. Und wenn ich den Zweispitz aufsetzen würde, welche Botschaft würde das der Besatzung übermitteln, allen unseren Schiffen? Dass ich die Hoffnung aufgegeben habe.«
Brekir nickte. Nahm ihre Hand von seinem Arm. »Es ist eine einsame Angelegenheit, das Kommando zu führen, Joron Twiner.«
»Aye, nun gut, das bestreite ich nicht.« Hinter Brekir stand der große Schreibtisch der Kabine, so bequem und behaglich, wie Joron sich jetzt gerade eben nicht fühlte. Und hinter dem Schreibtisch stand Meas’ Stuhl, und an der Rückenlehne des Stuhls hing ihr Zweispitz, das Symbol für die Befehlsgewalt einer Schiffsfrau.
»Tja«, begann Brekir und trat einen Schritt zurück, »vergesst nicht, Joron Twiner, dass Ihr Freunde unter jenen habt, die Ihr befehligt.«
»Aye.« Er lachte. »Und Rivalen.«
»Die hat man immer.«
»Und noch Schlimmeres.«
»Und das ist zum Teil auch der Grund, warum ich Euch noch einmal bitten möchte, den Zweispitz aufzusetzen, Joron.«
»Der Zweispitz einer Schiffsfrau wird mich in den Augen von Chiver und Sarring nicht zum rechtmäßigeren Kommandanten machen, Brekir.«
»Das mag sein«, räumte sie ein, »sie sind durch und durch von der Flotte geprägt und werden es nie wirklich hinnehmen, dass jemand aus den Reihen der Bernbann den Befehl über sie hat, da habt Ihr recht. Aber einfach nur diesen Hut zu tragen, macht es schwerer, Eure Autorität zu untergraben.«
»Vielleicht bei den Offizieren«, entgegnete er. »Aber bei den Deckkindern?« Er sah Brekir in die Augen. »Nein. Ich habe ein Gelübde abgelegt. Sie werden mich niemals respektieren, wenn ich mein Wort nicht halte. Sie werden mich als glücklos betrachten, und die Deckkinder zu verlieren, ist gleichbedeutend mit dem Verlust unserer Flotte, Brekir. Sollen sich Chiver und Sarring ruhig beschweren; solange ich die Deckkinder auf meiner Seite habe, können sie nichts ausrichten.«
Sie nickte. »Wie schwer es doch ist, ein Knochenschiff zu befehligen, all diese Pflichten und Loyalitäten unter einen Hut zu bringen, damit das Ding fliegt«, meinte Brekir. »Ich glaube, dass das nur wenigen klar ist. Und noch weniger wissen, wie schwer es ist, eine ganze Flotte davon zu befehligen.« Jetzt war es an Joron zu nicken. »Nur damit Ihr es wisst, sie haben vor, Euch beim nächsten Treffen der Schiffsfrauen herauszufordern und zur Rede zu stellen.«
Etwas in ihm wurde ganz still; wie kaltes, unbewegtes Wasser. Er hatte immer gewusst, dass genau das kommen würde. »Ein Duell?«
»Nein, sie könnten sich unmöglich mit Euch duellieren. Es wäre unter ihrer Würde, mit einer einbeinigen Schiffsfrau zu kämpfen, die noch dazu ein Mann ist. Nein, sie werden damit argumentieren, dass wir einen vergeblichen Kampf führen.«
Joron drehte sich um und setzte sich auf den Stuhl hinter dem Schreibtisch, der so gemütlich an seinem Platz stand, dann bedeutete er Brekir, ihm gegenüber Platz zu nehmen, was sie auch tat. Sie faltete ihre große, langgliedrige Gestalt nachdenklich zusammen, ihre Haut noch dunkler als seine, ein Gesicht, dem die Natur einen ständigen Ausdruck des Kummers verliehen hatte.
»Vielleicht haben sie recht, Brekir. Meas hatte zweifellos einen Plan, wie sie dem Krieg ein Ende bereiten wollte. Ich verfüge über nichts dergleichen. Manchmal frage ich mich, ob es wohl das ist, was mich dazu treibt, sie zu suchen, und nicht meine Loyalität.« Er nahm eine Flasche Anhir aus der Schreibtischschublade, befüllte zwei Becher und reichte einen davon Brekir.
»Zweifelt nicht an Euch«, entgegnete sie. »Ihr habt uns die ganze Zeit bisher gute Dienste erwiesen. Sie werden sich dafür aussprechen, ein eigenes Bernreich zu gründen, und sie werden sagen, wir hätten genug Schiffe dafür.«
Joron wandte sich ab, während er an dem Anhir nippte, damit die zerstörte Haut unter seinem Schal verborgen blieb, den er als Maske benutzte. Die Flüssigkeit verstärkte das ständige Brennen in seiner wunden Kehle. Er zog den weichen schwarzen Stoff wieder zurecht und wandte sich erneut Brekir zu.
»Gut, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, den Krieg zu beenden. Ich kann mir kaum etwas vorstellen, das die Hundertinseln und die Hageren schneller zusammenbringen würde, als jemand, der ihnen ihr Land raubt, um ein neues Bernreich zu gründen.«
Brekir beugte sich vor. »Nur um in diesem Punkt einmal den Anwalt der Hexe zu geben, Joron«, begann sie. »Wir könnten uns gegen sie behaupten, wir haben in Euch eine mächtige Waffe.«
Das kalte Meer in ihm gefror. Seine Worte kamen so kalt und scharf heraus wie die von Eis ummantelten Inseln, die ein Knochenschiff von der Schnauze bis zum Heck aufzuschlitzen vermochten.
»Darüber reden wir nicht.«
»Ich finde, wir müssen darüber reden, Joron, schließlich vermögt Ihr, die Keysh…«
Er schnitt ihr das Wort ab, seine Stimme leise, aber streng, und sein Tonfall duldete keinen Widerspruch. »Und sobald ich handle, sobald ich einen Meeresdrachen erwecke, ist Meas tot, das wisst Ihr. Sie haben sie in ihrer Gewalt, weil sie glauben, sie selbst sei dazu in der Lage. Sobald sie wissen, dass sie es nicht kann, haben sie keinen Grund mehr, sie am Leben zu lassen.«
»Die Keyshan erheben sich so oder so, Joron. Es werden ständig kleinere gesichtet, fünfzehn nach der letzten Zählung.«
»Wenn ich eine weitere Insel zerbrechen lasse und auch nur ein einziger Mensch entkommt, um die Kunde davon weiterzutragen, Brekir, ist sie tot. Das werde ich nicht tun.«
Brekir nickte und nippte an ihrem Getränk. »Ich wusste, dass Ihr das sagen würdet, und Ihr habt natürlich recht, aber es könnte eines Tages dazu kommen, Joron, dass Ihr eine Wahl treffen müsst. Unsere Flotte oder Meas.« Er nahm einen Schluck und Brekir beugte sich vor. »Nur ein freundschaftlicher Rat«, setzte sie hinzu.
»Aus Eurem Mund immer willkommen, Brekir.«
»Chiver ist von beiden die stärkere Persönlichkeit. Ihr solltet ihm von Cwell einen nächtlichen Besuch abstatten lassen. Dann sind all Eure Probleme Vergangenheit, und Ihr könntet entweder seinen Deckwahrer befördern, der dann in Eurer Schuld steht, oder Ihr könntet Eure eigene Schiffsfrau bestimmen. Ohne Chivers Unterstützung wird Sarring es nicht wagen, die Stimme gegen Euch zu erheben, und höchstwahrscheinlich wird sich Sarring dann mit all ihren Informationen über uns heimlich wieder zu den Hundertinseln absetzen, weil sie hofft, dass ihr dort Gnade gewährt wird.«
»Ich bin kein Mörder, Brekir.«
Sie antwortete nicht, sondern blickte nur über seine Schulter hinweg aus den großen Fenstern im Ruderbereich des Schiffes. Joron drehte sich um und tat es ihr gleich. Er sah die Leichen, die von den Galgen baumelten, die über den Docks verstreut liegenden Toten.
»Sie sind der Feind«, erklärte er, »und sie würden mit uns das Gleiche machen.«
»Stimmt«, antwortete sie.
»Missbilligt Ihr es?« Während er sprach, sah er, wie das erste seiner schwarzen Schiffe aus dem Hafen zu gleiten begann, Coults Schlaue Schwester. Hinter ihm machten sich auch die anderen bereit. Rauch stieg aus dem kleinen Hafen auf.
»Ich verstehe es«, antwortete sie.
»Verstehen ist noch keine Billigung.« Er wandte sich wieder ihr zu. »Wir dürfen unsere Feinde nicht lebend hinter uns zurücklassen.«
Brekir stand auf. »Ich sollte jetzt auf die Knurrzahn zurückkehren. Wie Ihr schon sagtet, es gibt Patrouillen, die nach uns suchen, und es wäre nicht gut, ihnen hier ins offene Messer zu laufen.«
»Ja.«
Sie wandte sich zum Gehen, doch sie hielt in der Tür noch einmal inne.
»Die Deckkinder lieben die Zerstörung, die wir hinter uns zurücklassen, Joron. Aber … ich weiß, dass ich meinen Dienst nicht so dicht an Meas’ Seite geleistet habe wie Ihr, trotzdem frage ich mich gelegentlich, ob denn sie selbst die blutige Schneise gutheißen würde, die wir da durch die See schneiden.«
»Meas war hart und unbarmherzig, Brekir«, versetzte er, und seine eigene Stimme war erfüllt von der gleichen Härte.
»Sie hat Euch am Leben gelassen«, gab Brekir zu bedenken, dann drehte sie sich um, verschwand in die Dunkelheit des Unterdecks und ließ ihn mit allerlei unerwünschten Gedanken allein.
Er wollte Brekir hinterherlaufen, wollte schreien und brüllen, ihr sagen, dass sie falschlag. Wo war ihre Pflichttreue geblieben, dass sie sein Handeln derart infrage stellte? Er bemerkte, dass er sich unwillkürlich von seinem Sitz erhoben hatte. Der vertraute Schmerz an seinem Beinstumpf, als er sein Gewicht darauf verlagerte, ließ ihn innehalten. Er dachte daran, wie Meas ihm vor so langer Zeit gesagt hatte, dass es Recht und Aufgabe des Deckwahrers sei, seine Schiffsfrau infrage zu stellen. Sie dazu zu bewegen, ihr Handeln zu überdenken. Und auch wenn sie die Schiffsfrau ihres eigenen Schiffes war, der Knurrzahn, wusste er doch, dass Brekir nun in dieser Flotte ihm gegenüber diese Rolle einnahm. Er setzte sich wieder. Drehte seinen Stuhl so, dass er durch die großen Fenster auf die kleine Stadt blickte. Auf die baumelnden Leiber. Auf die Leichen. Auf das Feuer, das sich weiter ausbreitete.
Das hier war sein Werk. Er war dafür verantwortlich und würde nicht davor weglaufen. Brekir hatte recht, es gab unter seinen Deckkindern solche, die sich an der Zerstörung weideten, solche, die die Dinge unweigerlich zu weit trieben. Er glaubte nicht, dass er selbst etwas Vergleichbares tat. Ein Jahr war vergangen und er hatte absolut nichts von Meas gehört. Er glaubte, dass sie irgendwo in Bernshulme sein musste. Um seine Schiffsfrau zurückzubekommen, brauchte er die Flotte der Hageren Inseln, damit sie gemeinsam Bernshulme angriffen. Und bevor sie gemeinsam angreifen konnten, musste die Flotte der Hundertinseln geschwächt sein. Und genau das hatte er vor, damit war er gerade beschäftigt. Wenn er ihren Schiffen auf See begegnete, zerstörte er sie. Wenn er ihre Schiffe nicht zerstören konnte, zerstörte er ihre Ladung. Wenn er ihre Ladung nicht zerstören konnte, tötete er ihre Offiziere. Und wenn er keine Offiziere töten konnte, raubte er ihnen ihre Deckkinder.
Was immer es brauchte.
Was immer erforderlich war.
Das hier war Krieg.
Es gab keine Gnade, keine Barmherzigkeit. Und er erwartete seinerseits nichts anderes. Er vergalt nur auf die gleiche Weise, wie seine Feinde es ihm gegenüber vergelten würden. Und wenn das nun mal nicht das war, was sein Vater ihm einst für sein Leben versprochen hatte, wenn es nicht die glorreiche Geschichte war, ein Teil der Flotte zu sein, von stolzen Knochenschiffen und ehrenwerten Schiffsfrauen, nun gut, dann lag das eben daran, dass das Leben nicht aus Geschichten bestand. Das Leben war schmerzhaft, es war hart und es war grausam und voller Verluste. Und wenn das hier nicht der Frieden war, den Meas gewollt hatte, für den sie gekämpft hatte, nun gut, dann lag das eben daran, dass es ohne Krieg keinen Frieden gab. Er sah zu, wie die Toten an den Galgen im Wind hin und her baumelten. Hörte noch einmal die Stimme jener einen Frau, des jungen Deckwahrers.
Ihr und Eure Deckkinder seid nichts als mordende Tiere. Und ich gehöre zur Flotte.
»Vielleicht sind wir ja alle Tiere, hm?«, murmelte er vor sich hin. Dann griff er nach der Anhir-Flasche und schenkte sich ein weiteres Glas ein. Hob erst den Schal und dann das Glas und spürte das vertraute Brennen des starken Alkohols tief in der Kehle.
Das Brennen des Alkohols, den er unter Meas hinter sich gelassen hatte. Nun wurde er ihm von Tag zu Tag wieder vertrauter.
»Ich werde dich finden, Meas«, sagte er leise und sprach dabei allein zu den Knochen der Gezeitenkind. »Ich muss dich finden, denn ich befürchte, dass ich mit jedem Tag ohne dich weiter von dem Kurs abkomme, auf den du mich einst gebracht hast.«
4
Wieder auf See
Er stand im Ruderbereich der Gezeitenkind, einem vertrauten Ort, ein vertrautes Gefühl unter seinem einen Fuß, während das Schiff über das Wasser glitt. Und doch unterschied sich alles von dem, wie es einst gewesen war – das war, so vermutete er, nun einmal die Natur des Lebens. Er befehligte jetzt dieses Schiff, und neben ihm standen seine Leute: Farys, sein Deckhalter, und neben ihr seine Stellvertreterin und die Anführerin seiner Seewacht, Jennil. Gavith, einst ein Schiffsjunge, der den Kopf eingezogen hatte, wann immer Meas den Blick auf ihn gerichtet hatte, war jetzt Bogensetzer auf dem Hauptdeck. Einige Persönlichkeiten aus der Zeit von Meas’ Kommando hatten noch immer ihre Posten inne und standen unerschütterlich dort, wie nicht von der Stelle zu bewegen. Barlay am Steuerruder, der Ernste Muffaz als Deckmutter; zwei verlässliche Säulen, die ihn hier verankerten, die ihn wissen ließen, dass es immer noch dasselbe Schiff war, das er vor vielen Jahren bestiegen hatte, im Schlepptau der Glücklichen Meas, als Meas’ Jahre der Schmach und Schande begonnen hatten. Und manchmal warf Muffaz einen raschen Blick zu Farys hinüber, sah sie an wie der stolze Vater, den sie nie gehabt hatte. Manchmal schaute Farys zu Gavith hin und starrte ihn auf eine Weise an, die Joron klarmachte, dass er die junge Frau besser im Auge behalten sollte. Aber er hatte bisher weder den richtigen Zeitpunkt noch die richtige Art und Weise gefunden, um mit ihr darüber zu sprechen. Er würde den Ernsten Muffaz bitten, mit ihr zu reden, denn die beiden standen einander doch sehr nahe.
Mevans war immer noch Hutwart und Proviantmeister und verweigerte in dieser Position jede Form einer Beförderung, schaffte es aber irgendwie, in alle Einzelheiten des Schiffsbetriebs eingebunden zu werden. Fogle war Jorons Seehüterin geblieben, auch wenn sie das, wie er fürchtete, nicht mehr allzu lange sein würde. Bei seinen letzten Gesprächen mit der Frau hatte er ihre Fahne gerochen und er konnte keine betrunkene Seehüterin gebrauchen.
Absurd, dass so etwas ausgerechnet von ihm kam.
Aelerin, der Kursleger, und der Gullaime fehlten an Deck, und vielleicht war es ja ihre Abwesenheit, die ihn mit Melancholie erfüllte. Die kriegerische Aufmachung der Gezeitenkind war lange schon abgelegt und Windherd lag einen Monat weit hinter ihnen. Die Schreckensbogen waren fest vertäut, der Sand weggefegt, die Ketten aus der Takelage gelöst und die Totenschädel von der Knochenreling entfernt worden. Im Zentrum des Decks arbeiteten die neuen Gullaime, ein Ring aus weiß gewandeten Windflüsterern, die mit ihrem sanften Gesang den Wind dazu brachten, das Schiff vorwärtszutreiben. Joron schonte sie nach Möglichkeit, ließ sie nie zu hart arbeiten und trieb sie nicht an die Schmerzgrenze, aber er und sie hatten kaum etwas gemein und waren sich fremd geblieben. Madorra hatte sie ausgewählt –, Madorra, der zugleich Jorons Freund – den ersten Gullaime, dem er je begegnet war – so eifersüchtig bewachte. Und obwohl Joron dem Windbeschnittenen das Versprechen abgenommen hatte, niemals von der Prophezeiung zu reden – der Weissagung, dass der Gullaime der Gezeitenkind der Windseher sei, dazu bestimmt, alle Gullaime aus der Knechtschaft der Menschen zu befreien –, glaubte er nicht, dass dieses Versprechen auch gehalten worden war. Das verriet Joron die Art, wie sich diese neuen Gullaime in seiner Gegenwart benahmen. Sie waren allzu still, begegneten ihm nicht mit Misstrauen, sondern ehrerbietig. Denn für sie war er der Rufer, und das bedeutete, dass er zur Mythologie des Windsehers gehörte; ob er dabei dessen Erfüllung war oder dem Untergang geweiht, wusste er nicht, und keiner würde es ihm sagen.
Aber die Gullaime gehorchten ihm, jedenfalls in den meisten Punkten.
»Farys«, sagte er.
»Aye, D’wahrer?«
»Ich gehe nach unten, Ihr kennt unseren Kurs.«
»Aye, D’wahrer«, antwortete sie, und er ließ sie im Ruderbereich zurück, im Wissen, dass sie sich um das Schiff kümmern würde und dass es niemanden auf der Welt gab, der es mit größerer Sorgfalt zu steuern vermochte.
Und so begab er sich unter Deck, hinaus aus der Kälte, die ihm trotz des um sein Gesicht gewickelten Schals in Wagen und Nase schnitt, und hinein in die feuchtere Kühle des Unterdecks, wo ihm die glühenden Augen der Flautenlichter den Weg wiesen, bis er an der Kabine des Gullaime angelangt war. An der Tür stand Madorra, ganz in Weiß gekleidet, den Blick seines einen Auges eindringlich auf ihn gerichtet.
»Madorra«, grüßte Joron und war sich dabei wie immer des heiseren Kratzens in seiner Kehle bewusst, das seine Singstimme ruiniert hatte. »Ich möchte mit dem Gullaime sprechen.«
»Beschäftigt«, antwortete Madorra, dann zischte er. »Zu beschäftigt für Euch. Beschäftigt.«
»Ich befehlige dieses Schiff, Madorra, und niemand hier ist zu beschäftigt für mich.« Er machte Anstalten, an dem Windbeschnittenen vorbeizugehen – einem jener Gullaime, die den Wind nicht zu beherrschen vermochten und die daheim auf den Hundertinseln gegenüber ihresgleichen sowohl als Entführer als auch als Wächter fungierten –, aber der rührte sich nicht von der Stelle. »Gullaime«, rief Joron, »ich möchte mit dir sprechen!«
Wieder zischte Madorra ihn an, doch die Stimme des Gullaime war lauter als er.
»Kommen, Joron Twiner, kommen herein.«
Joron wartete einen Moment lang und musterte den Windbeschnittenen. Er bemerkte, dass seine weiße Robe um eine rund um den Kragen aufgenähte Girlande aus Muscheln erweitert worden war. Es entging ihm nicht, dass es Guffin-Muscheln waren, berüchtigt dafür, dass die in den perlmuttartigen weißen Windungen der Schalen sitzenden Weichtiere zwar eine Delikatesse für die Gullaime, für Menschen jedoch giftig waren.
»Also?«, wandte sich Joron an Madorra. Der Windbeschnittene blinzelte mit seinem einen heilen Auge und trat beiseite. »Danke«, sagte Joron, öffnete die Tür und trat hindurch, von der klammen Kälte hinein in den warmen Raum, in dem schwer der Duft des Gullaime lastete, ein Geruch von heißem Sand und Salz. Sie hatten jetzt zwölf Gullaime an Bord – die fünf, die sich gegenwärtig auf Deck befanden, dazu seinen Gullaime sowie Madorra und fünf weitere hier drinnen. Er kannte die Namen der zehn neuen Gullaime nicht, und sie trauten sich auch nicht, mit ihm zu reden oder ihm gegenüberzutreten.
Sie sangen beständig, und auch wenn sie dem Gullaime überallhin folgten und immer in seiner Nähe waren, schienen sie doch nur Madorra zu gehorchen und nicht dem Gullaime, der mitten in ihrem Kreis saß und bekümmert zu Joron aufsah.
»Weggehen«, forderte er sie mit trauriger Stimme auf. Einst war er ein wahrer Wirbelwind aus Ärger und Zorn gewesen, aber heute wirkte er nur müde. Als die Gullaime um ihn herum keinerlei Anstalten machten, sich von der Stelle zu bewegen, sondern nur mit ihrem leisen, klagenden Lied fortfuhren, kehrte ein wenig vom alten Feuer des Gullaime zurück. »Weggehen!«, blaffte er die ihm nächste der Kreaturen an, und sie zogen sich alle gleichzeitig zur Tür zurück, wenngleich doch ohne den Raum zu verlassen.
»Er hat euch zum Gehen aufgefordert«, richtete Joron das Wort an die Gruppe von Gullaime, und sie gurrten und schnalzten mit den Zungen, ohne ihm jedoch auch nur im Geringsten zu gehorchen.
»Werden nicht gehen«, erklärte der Gullaime. »Werden nicht.« Er ließ sich in seinem Nest nieder. Seine Robe, einst zerrissen, verdreckt und zerlumpt, war jetzt die Schönste auf dem ganzen Schiff. Sie war aus vielfarbigem Stoff genäht und Muscheln sowie allerhand anderer Tand wie Federn und glitzernde Gegenstände, Geschenke von seinesgleichen oder den Frauen und Männern der Besatzung klimperten darin. Joron überkam unweigerlich das Gefühl, dass dieses Gewand für den Gullaime ebenso ein Gefängnis war wie das Kommando über die Gezeitenkind für Joron selbst; dass der Windflüsterer darin gefangen war, außerstande, sich anderen mitzuteilen, außerstande, daraus zu fliehen.
»Schiffsfrau gefunden?«, fragte er.
»Nein, sie ist nicht dort gewesen, und niemand hat etwas über sie gewusst.« Er schüttelte den Kopf. »Wenn du möchtest, dass die anderen Gullaime aus deiner Kabine entfernt werden, kann ich das veranlassen.«
Der Gullaime schüttelte den Kopf. »Nein, nein, nein. Madorra nicht weggehen. Madorra kämpfen, Madorra töten. Nicht tun, nicht tun.« Er klang so, als stehe er am Rande der Panik.
Joron nickte. »Es hat einmal eine Zeit gegeben, da hätte es dich nicht gekümmert, wenn er uns getötet hätte«, bemerkte Joron.
Der Gullaime röhrte leise, ein trauriges Lachen für jene, die sein Verhalten zu deuten wussten. »Jetzt auch nicht viel kümmern. Um Joron Twiner kümmern.« Er drehte seinen maskierten Kopf in Jorons Richtung. »Joron Twiner krank«, fügte er leise hinzu. »Nicht machen Joron Twiner Leben schwer.«
»Mein Leben ist bereits schwer, und ich glaube nicht, dass es viel einfacher werden wird, Gullaime.«
Der nickte traurig. »Nicht wollen«, beteuerte er.
»Nein«, sagte Joron. »Nun gut, ich wollte nur mal bei dir vorbeischauen. Ich muss jetzt die Hexenhand und Aelerin aufsuchen. Wenn du irgendetwas brauchst, dann lass mich rufen.«
»Rufen«, echote der Gullaime, und Joron drängte sich durch die kleine Schar weiß gekleideter Windflüsterer zur Tür hinaus, nur um im Vorbeigehen von Madorra angezischt zu werden.
Joron schenkte ihm keine Beachtung – die Windbeschnittenen galten als etwas, das außerhalb der Befehlsgewalt des Schiffes stand, mithin war Madorras unverschämtes Benehmen für Jorons Kommandoposition keine größere Bedrohung, als wenn ein Kivelly nach ihm schnappen oder ein Langdresch ihn beißen würde. Trotzdem wurmte es Joron, als er sich nun tiefer in die Katakomben des Schiffes begab, hin zum Hexenbug, wohin die Kranken und Verletzten gebracht wurden und wo Garriya, die Hexenhand, jetzt auf ihn wartete. Heute lag dort niemand, denn es hatte bei ihrem Überfall keine Verwundeten gegeben. So war es oft. Zum Teil war das ihrem Auftauchen mit überwältigender Wucht zu verdanken, mehr aber noch seinem Ruf als der Schwarze Pirat, der niemanden am Leben ließ, sodass der einzige Beweis dafür, dass er da gewesen war, die baumelnden Leichen und brennenden Städte waren.
Es war natürlich eine Übertreibung, und er verstand, dass sie notwendig war – dass dieser Ruf langfristig das Leben seiner Leute rettete, und Joron hoffte, dass er ihn auch eines Tages zu Meas führen würde. Doch deswegen gefiel ihm die Sache nicht besser.
Im Hexenbug saß Garriya auf einem Hocker, für sie gab es keine Hängematte. Neben ihr waren die Werkzeuge ihres Gewerbes ausgebreitet. Man könnte sie ebenso gut für einen Folterknecht halten wie für eine Heilerin, ging es ihm durch den Kopf. Die alte Frau war eine Ansammlung von Widersprüchen, sehr penibel, wenn es darum ging, sich die Hände zu waschen, aber nie wusch sie irgendeinen anderen Teil ihres Körpers. Sie stellte sich die meiste Zeit dumm, konnte aber längst niemanden mehr zum Narren halten. Hinter diesen wachen Augen war eine mächtige Intelligenz am Werk.
»Rufer«, begrüßte sie ihn. »Wie läuft’s so?«
»Ich höre immer mehr Berichte über Keyshan, die auf sämtlichen Meeren auftauchen, und doch habe ich keinen von ihnen herbeigesungen.«
Sie kicherte und strich mit der Hand über ihre Werkzeuge, als frage sie sich, welches davon wohl den größten Schmerz bereiten mochte.
»Glaubst du, du wärst alles auf der Welt?«
»Nein, aber wir haben einen dieser Meeresdrachen gerufen, wir …«
»Den ersten hast du nicht erweckt, Rufer«, unterbrach sie ihn, dann rollte sie ihr Werkzeug zusammen und stand auf. Sie bahnte sich einen Weg zu den Regalen und stopfte die Rolle hinter ein Seil, um dann ein Tuch und eine Flasche hervorzuholen.
»Nun ja, nein …«
»Du kannst eine Sache ein wenig beschleunigen«, erklärte sie, »aber du kannst etwas nicht aufhalten, sobald es begonnen hat.«
»Wie meint Ihr das?«
»Nimm deinen Schal ab und setz dich auf den Hocker. Schauen wir mal, wie es uns heute geht.«
Er tat wie geheißen und die Luft auf seiner Haut statt der Wärme seines vom Stoff aufgefangenen Atems war ein eigenartiges Gefühl. Garriya trat vor ihn, hässlich, alt und mit schmutzstarrender Haut.
»Hat irgendjemand auf dieser Insel gewusst, wo sie ist?« Er schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht«, fuhr sie fort, »warum sollten sie auch jemand so Wichtiges so weit hier herausschicken.« Er stand im Begriff zu antworten, aber sie hob seinen Kopf an, indem sie ihm die Hand unters Kinn legte und es hochdrückte, was ihn wirkungsvoll am Sprechen hinderte. »Die wunden Stellen haben sich nicht verschlimmert«, erklärte sie. »Schwindelattacken?« Er schüttelte den Kopf. »Übelkeit? Verlust des Zeitgefühls?« Er schüttelte den Kopf. »Hast du irgendwelche Entscheidungen getroffen, die du jetzt bereust?«
»Viele.«
Sie lächelte, während sie ihr Tuch mit Flüssigkeit aus der Flasche tränkte. »Irgendwelche Entscheidungen getroffen, die dir später unverständlich erschienen?«
»Nicht in letzter Zeit.«
»Gut. Jetzt tut es gleich weh.« Sie tupfte die Flüssigkeit auf seine Haut, und er zischte; es fühlte sich an, als würde seine Haut Feuer fangen, aber wenn es nötig war, um die Keyshanfäule unter Kontrolle zu halten, dann musste es eben so sein.
»Wie geht es Coxward?«, erkundigte er sich während einer seiner kurzen Atempausen.
»Ich konnte ihn nicht mehr hierbehalten«, antwortete sie. »Jetzt ist er im Schiffsgefängnis eingesperrt.« Ein weiteres Tupfen. Feuer rann über seine Haut. »Bis Ihr mal in seinem Zustand seid, dauert es jedoch noch lange. Er leidet schon seit vielen Jahren unter der Fäule.«
»Ich hätte ihn gut gebrauchen können, niemand kennt ein Schiff so gut wie er«, erklärte Joron. »Könnt Ihr ihn nicht gesund machen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Sobald die Fäule einmal das Gehirn erreicht hat, kann nur die Mutter sie heilen, und ich bin nicht sie.« Tupfen. Schmerz. »Es wäre gnädiger, ihn gehen zu lassen, Rufer«, fügte sie mit leiser Stimme hinzu. Schmerz. »Für ihn gibt es nichts mehr auf dieser Welt.«
»Er ist von Anfang an bei uns gewesen.« Ihm versagte die Stimme. »Ich will keinen Mann verlieren, der …«
»Manchmal geht es nicht um dich«, gab sie zu bedenken. Tupfen. Schmerz. »Weißt du, Rufer, Leben ist nun mal Verlust, und dir ist viel genommen worden: Dinyl, dein Bein, dein Lied und deine Schiffsfrau. Und wenn du glaubst, deinen Schmerz mit Blut verdünnen zu können, so befindest du dich im Irrtum. All das Blut gibt ihm nur zusätzliche Nahrung.«
»Es ist keine Rache, Garriya.« Er schob ihre Hand weg, und ein Hauch der Flüssigkeit in ihrer Flasche wehte zu ihm herüber und trieb ihm die Tränen in die Augen. »Sie befindet sich in Bernshulme, davon bin ich überzeugt. Und ich brauche die Schiffe der Hageren Inseln, um die Hauptstadt anzugreifen, aber sie wollen sie mir nicht zur Verfügung stellen, solange die Marine der Hundertinseln noch so stark ist.« Er griff nach dem Schal und wickelte ihn sich erneut ums Gesicht. »Also schwäche ich sie.«
»Und dich selbst.«
»Wir haben niemanden verloren.«
»Noch nicht.«
»Wir haben niemanden verloren, alte Frau.« Er stand auf.
Sie starrte ihn an. »Geh mal deinen Knochenmeister im Schiffsgefängnis besuchen.«