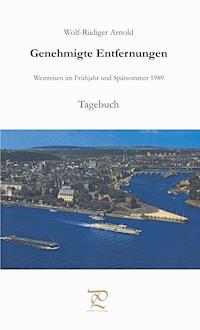6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinen vierzehn Geschichten, die zwischen den Jahren 1979 und 2004 handeln, berichtet Wolf-Rüdiger Arnold über vorwiegend ältere Außenseiter, skurrile Typen, aber auch Personen von 'Entwicklungsgeschichten'.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Wolf-Rüdiger Arnold
Im Spiegel oder Variationen
Erzählungen
Bibliografische Information durch Die Deutsche Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Copyright (2006) Engelsdorfer Verlag
pernobilis edition
Alle Rechte beim Autor
Illustrationen: Heidrun Sommer
eISBN: 978-3-86901-308-4
Inhalt
Variationen
Eine Liebesgeschichte (2004)
Kindsängste (2004)
Die Krankheit (1999/04)
Fatal (1999)
Herr Biemer (1997)
Unterwegs
Gartenparty (1988/92)
Verfahrener Sonntag (1994)
Der Unfall (1995)
Aussichten
Das Ende der Kindheit (1991/92)
Was ich einmal werden wollte (1997)
Im Spiegel (1979/83/89/92)
Klassentreffen (2000)
Tante Rosel
Tante Rosel (2004 und früher)
Blumen für Betty (1988)
Variationen
Eine Liebesgeschichte
Gestern wurde ich 40. Vor sechs Wochen hat mich meine Frau, mit der ich nie verheiratet war, verlassen. Fünfzehn Jahre haben wir zusammengelebt. Früher war ich sehr eifersüchtig. Dazu hatte ich allen Grund. Das glaubte ich zumindest. Ramona hatte es sich nie austreiben lassen, mit Männern zu spielen. Wie ein Angler seine Köder, warf sie dabei ihre Blicke aus, ermutigte sie offenbar die Begierigen, suchte sie Gleichgültige scharf zu machen. Aber ich weiß heute durch sie selbst, nachdem es aus ist zwischen uns, sie ließ es nie zum Äußersten kommen. Ihr Schoß blieb ihnen allen und jenen verschlossen, die allein schon glaubten, aus ihrem Vornamen auf eine bereitwillige Muschi schließen zu dürfen. Ihr Name war es auch, der mich dann zu Anfang unserer Beziehung verrückt gemacht hatte. Hörte ich diesen Namen, flüsterte ich ihn mir selbst zu, hatte ich das Bild vor mir, ihrer schweren Brüste, der gar nicht übermäßig langen, aber wohlgeformten Beine, die ich mir nur vorstellte mit diesem Ding, in das es mich täglich einzudringen verlangte. Das ist nun vorbei. Ramona ist ausgezogen, weil sie nicht mehr mit einem frustrierten, langarbeitslosen Ingenieur der Polygrafie zusammenleben wollte, dessen Langweiligkeit sie umbrächte. Ich habe nicht um sie gekämpft, sie ziehen lassen. Ich war wie paralysiert, gehindert durch Ungläubigkeit, Stolz und Resignation. Die früheren Eifersuchtsszenen sind mir verwundert eingefallen. Damals, als Tassen und anderes Geschirr geflogen war, schien mir unsere Verbindung sehr viel weniger stabil. Nun bin ich vierzig geworden und fühle mich elend. Das ist keine Katerstimmung. Die Flasche Rotwein, die ich gestern allein getrunken habe, hat an diesem Elend keinen Anteil. Ich bin es gewohnt, einiges zu trinken, ohne betrunken zu sein. Mir ist sterbenselend. Ich vermute, ich werde sterben. Bald sterben. Ich tue mir nicht leid, und es wird niemanden berühren. Es ist keine Krankheit, jedenfalls ist die mir nicht bekannt, die mich umbringen wird. Es ist dieses Gefühl, und es sind körperliche und seelische Schwäche, die mir diese Gewissheit geben. Längst habe ich aufgehört, einigermaßen attraktiv zu sein. Zu fett, nahezu glatzköpfig sind die Äußerlichkeiten, die meinen Marktwert reduzieren; zu fettes und zu süßes Blut vermindern zusätzlich die Chancen. Der Lack ist runter. Geblieben sind meine großen dunklen Augen, diejenigen eines treuen Hundes, wie mich meine Frau gern aufgezogen hat. Nun hat mich Ramona allein zurückgelassen in der Zweizimmerwohnung. Ich hasse sie inzwischen, so wie ich ihren Namen zu hassen beginne, an den ich nun nur mit Verachtung für das Ding denken kann, das uns Männern den Kopf verdreht, dieser faltige, verfilzte Abgrund, dem wir in Sucht verfallen sind. Die ersten Tage, Wochen habe ich gut überstanden, weil es auch ganz schön sein kann, allein zu sein, an Rücksichtslosigkeiten nicht erinnert zu werden, Rücksichtnahme nicht einklagen zu müssen. Ich traue mir nicht einmal mehr zu, Auto zu fahren. Schon einige Male habe ich mich dabei ertappt, nicht bei der Sache zu sein, unkonzentriert, mechanisch alle Handlungen hinter dem Steuer ablaufen zu lassen, die ein Film auf der Frontscheibe zu erfordern scheint. Bringt mich mein Körper nicht um, könnte es mein altes Auto sein. Nun laufe ich ziemlich ziellos durch die Großstadt, nehme mit dumpfem Kopf alles wie durch Nebelwände wahr, und glaube dennoch fest daran, dass ich sterben werde. Wozu auch leben? Niemand braucht mich, keiner wird mich vermissen. Ich habe keine nahen Verwandten und nur flüchtige Bekannte. Meine Tage vergehen, so wie die Nächte vergehen, eigentlich zäh, aber genau besehen recht flüchtig, zurück bleiben nicht einmal Erinnerungen. So sehr es mich drängte, ich habe es aufgegeben, lustvoll Hand an mein Geschlechtsteil zu legen, anfangs, weil ich mich zu verletzt gefühlt hatte und nicht kindisch sein wollte, inzwischen sogar schon entwöhnt. Das ist ein Zustand, der mich verwundert, nachdem ich bis vor Kurzem so geil war, jeden zweiten Gedanken auf den intimen Verkehr mit einem Weib zu verschwenden. Dabei habe ich nicht nur an Ramona gedacht. Auch wenn ich bei ihr lag, hatte ich Fantasien, die sich nicht unbedingt mit Ramona beschäftigten. Ich habe sie sogar angestachelt, ebenfalls in Gedanken fremd zu gehen. Ob uns das beide erregte, weiß ich nicht. Inzwischen vermute ich, dass mir wenig über ihr Gefühlsleben bekannt wurde und ich mich über das Wenige sogar täusche. Vielleicht war alles bei ihr Spiel, nebensächliche Ablenkung vom Eigentlichen. Dieses Eigentliche bleibt ihre Karriere. Meine Frau war kalt und einzig von Mode besessen, Mode, die sie entwarf, produzieren ließ und an Frau oder Mann zu bringen gedachte. Das gelang ihr mäßig. Der Mangel an eigentlichem Erfolg hatte sie nicht mutlos gemacht, fraß aber ihre sämtlichen Energien. Ich konnte ihr keine Unterstützung sein. Früher hat mich das weniger beschäftigt, zu sehr war ich mit meinem eigenen Missgeschick befasst. Nun fühle ich mich nur noch leer. Man sagt wohl dazu, ausgebrannt. Aber ich frage mich, für wen, außer für Ramona, habe ich gebrannt? Die Auslagen in den Schaufenstern nehme ich wahr, ohne zu wissen, was ich gesehen habe, durch die Kaufhäuser laufe ich gelangweilt, gehetzt und muss sofort wieder nach draußen, weil ich befürchte, zu ersticken. Ein verrückter Gedanke lässt mich Ablenkung in Gesichtern suchen, aber ich, der ich mich selbst unansehnlich finde, kann nur Hässliches entdecken. Wie viel Hässliches auf der Welt doch herumläuft! Was hat sich dieser Schöpfer bloß dabei gedacht? – Die Arroganz tut mir gut. Ich muss daran denken, als Pubertierender habe ich jedem Mädchen wie ein Verdurstender nachgestarrt, mich mit Blicken in den Gesichtern festgesaugt, aufgeführt wie ein läufiger Hund, dem Erziehung und Zivilisation zumindest beibringen konnten, diese Mädchen und jungen Frauen nicht anzuspringen. Meine Mutter gab mir manchen heimlichen Rippenstoß, wenn ich an Orten, wo wir zu warten gezwungen waren, z.B. versteckt hinter Menschen in der überfüllten Straßenbahn, das Starren nicht aufgab. Wie ein Hündchen, das man an der Leine zerrt, habe ich gehorcht, mich nicht geschämt und im nächsten Moment widersetzlich erwiesen. Die Blicke sind raffinierter geworden im Verlaufe der Jahre mit Ramona, und es war mir unangenehm, wenn sie mich dabei erwischte. Ich habe von ihren Künsten nicht lernen können, durfte nur aus den Reaktionen der Männer schlussfolgern, dass sie wieder einmal erfolgreich ihre Fäden gesponnen hatte. Aber was wusste ich, wie sie sich als Modeschöpferin verhielt? Ich glaube ihr heute, dass sie alles und jeden unter beruflichen Aspekten taxierte. Wäre sie Mutter geworden, wäre sie vielleicht mehr als das gelegentliche Weibchen gewesen, das sie im Bett war, das wahrscheinlich kein Nachklingen kannte, so nüchtern wie sie handeln konnte, wenn ich noch angenehm ermattet neben ihr lag. Vielleicht hatte sie niemals oder selten eine Befriedigung, obwohl mir stets sehr daran gelegen war, und sie mir versicherte, es sei schön, sehr schön gewesen. Vielleicht war unser ganzes Zusammenleben Täuschung und Lüge. Vielleicht gibt es so etwas wie Liebe und Erfüllung gar nicht? Ich bin überzeugt, es ist so und erinnere mich der flüchtigen Bekanntschaft eines Lehrers, der nicht an die Liebe glaubte und nur eines im Sinne hatte, seinen Trieb mit den zumeist jüngeren Frauen auszuleben, die ihm gefielen, ihn geil machten. Nicht gerade groß, eher zierlich, mit einem ebenmäßigen, unschuldig wirkenden Gesicht, hellblonde, dichte Locken, hatte er offenbar das Geschick, das Glück, jede herumzubekommen, die es ihm angetan hatte. Dass er im Suff endete, ist eine andere Geschichte und hat damit wahrscheinlich nichts zu tun. Jedenfalls habe ich manchmal mit ihm gestritten, die Liebe verteidigt, mit der ich noch gar keine Erfahrung hatte. Ich hatte es nicht wahrhaben wollen, dass in unserer Zeit wie selbstverständlich einmal wieder der Geschlechtsverkehr herabgewürdigt ist zur ganz gewöhnlichen lustvollen Handlung, zu der sich zwei oder auch mehrere Menschen unkompliziert zusammenfinden, sich danach trennen und zur Tagesordnung übergehen, um sich gegebenenfalls nicht wieder zu treffen. Ich gebe aber zu, den Kerl, das Bürschchen von Lehrer, auch beneidet zu haben. An seinen Erlebnissen konnte ich mich also überhaupt nicht messen lassen. Seinerzeit begann ich mich für Ramona zu interessieren und hätte sowieso keine Blicke für eine andere gehabt. Die quälende Suche schien beendet mit dem einzig begehrenswerten Ziel. Welch schöne Zeit der Verblendung ... und Verblödung, füge ich heute an. Dass wir nur dazu da sein sollen, das Zwischenglied für die Fortsetzung eines sinnlosen Lebens abzugeben. Wozu? Ich will aber nicht als Mittel zum Zweck ausgenutzt, ausgebeutet werden. Jetzt will ich Spaß haben. Have fun! Möglichst so lange das noch geht. Und das dürfte nicht mehr lange sein. Mit diesem Ende ist dann wahrscheinlich doch alles zu Ende. Etwas anderes zu hoffen, zu denken, hieße, sich für zu bedeutend ansehen. Wir sind zu viele, und alle sind ziemlich gleich, im Grunde nur die ewige Wiederholung einer nicht besonders geglückten Schöpfung oder Evolution. Wen scheren die Nuancen, so lange noch jedermann zu ersetzen ist? Dabei fängt die Täuschung, dieser Betrug jedes Mal neu und mit jedem früh an, indem man mit all diesen Hoffnungen und Erwartungen ausgestattet ins Leben tritt, in seiner dummen Unschuld und Unbefangenheit gern annimmt, nun erst mit uns beginnt das Wichtigste eigentlich, nun geht die Weltgeschichte einem ihrer Höhepunkte zu, jetzt gelingt es, das Unvollkommene besser zu machen, Geschichte zu vollenden. Alles großer Quatsch! Vergeudete Illusionen und Kraft. Besser ist es wohl, einfach nur zu leben. Notfalls auch in den Tag hinein, wenn alle Wege versperrt scheinen. Meine unschuldig gierigen Blicke von damals aus der Pubertät fielen mir sicher nicht zufällig wieder ein. Wiederholte ich sie heute, so denke ich, bekäme ich möglicherweise einen Fixpunkt in dieser Nebelwelt. Ich bekäme zumindest Ablenkung und Zerstreuung. Also setze ich mich in ein Café, das sich in diesen Sommertagen bis auf die Straße erstreckt. Der Straßenrand erscheint mir besonders günstig, den Flanierenden entgegenzublicken, so lüstern die Objekte zu taxieren, dass es fast schon Straffälliges hat. Aber es bleiben nur Momente, die bestenfalls jene Frauen, die mich überhaupt bemerken, für Sekunden aus der Fassung bringen könnten, denn ich schaue ihnen zwar ungehemmt auf den Busen und ins Gesicht, verkneife es mir jedoch, meinen Kopf zu drehen, ihnen wie vor fünfundzwanzig und noch zwanzig Jahren nachzuschauen. Sicher hält man mich verrückt, für einen kranken Lüstling, sofern ich überhaupt beachtet werde. Um diese Tageszeit, es sind die Stunden nach dem Frühstück, vor dem Mittag, ist das Café leer und die Straßenstühle sind mäßig besetzt. Ich habe glücklicherweise einen Tisch für mich allein, bin also nicht unmittelbarer Beobachtung ausgesetzt. Das wäre für meine Dummheiten nicht gut. Und gar zu mutig bin ich ohnehin nicht. Aber ich lege es an, eine Erektion zu bekommen. Davon wird man nichts merken. Am Nachbartisch sitzt eine junge Frau mit einem Kleinkind im Sportwagen. Ist am Straßenrand nichts Interessantes in Sicht, weil nur Paare, ältere Frauen oder Männer flanieren, beziehungsweise ihren Geschäften nachgehen, mich Mode noch nie beschäftigt hat, wechselt mein Blick entspannt zu diesem Tisch hinüber. Die junge Mutter ist ausgesprochen hässlich, sie ist, wie wir gern sagen potthässlich, etwas pummelig, mit einem breiten Mund, dicken Lippen, ein richtiges Froschmaul. Hingegen das Kind, wahrscheinlich ein Mädchen, höchstens ein Jahr alt, wirkt auf mich als so liebliche und dabei lebhafte Erscheinung, dass ich gern dorthin blicke und vergessen kann, weshalb ich hier sitze. Mit großen dunklen Augen mustert es seine Umgebung, als verstünde das kleine Mädchen sogar, was es sieht und will sich alles gut einprägen. Ich bin fasziniert und schließlich angeekelt, als seine Mutter den Löffel, von dem sie gerade noch ihr Eis gegessen hat, dem Kindchen an den Mund führt, um es die Spuren ablecken zu lassen. Es empört mich. Aber was soll ich machen? Und überhaupt was gehen mich fremde Kinder an, auch wenn sie wie kleine Engel auf mich wirken? Also schaue ich weiter auf die Straße, erfreue mich einigermaßen an Gesichtern, Busen und Beinen. Aber dann erschrecke ich wirklich. Die Potthässliche steht plötzlich neben mir. Ich weiß nicht, ob ihr all meine frechen, aufdringlichen Blicke entgangen waren, die anderen Frauen galten und diejenigen leichter Verachtung, die ich zu ihr geschickt habe. Nun fragt sie mich freundlich und mit angenehmer Stimme, ob ich einige Augenblicke auf Ramona aufpassen könne. Keine Viertelstunde, sagt sie, während es mir schon fast schwarz vor Augen zu werden beginnt, so heftig bin ich erschrocken, als sie den Namen dieses lieblichen Kindes verraten hat, das mich bereits so interessiert und ausschließlich mustert, wie es bisher alles um sich mit Blicken aufgesogen hatte. Mit Widerspruch offenbar nicht rechnend, wird mir der Kinderwagen hingeschoben, und die Mutter entfernt sich, schaut sich noch einmal um, winkt dem Töchterchen zu. Ich stelle fest, die Potthässliche hat bis über die Knie entblößte ziemlich aufregende Beine und wundere mich nun sehr, wieso sie mir vertraut. Ob es meine Hundeaugen sind, meine übrige Unattraktivität ist, die mich eher harmlos aussehen, als auf den Don Juan tippen lassen, der ich zu sein mir vorgenommen habe? Für Momente komme ich mir nun, bei aller Lieblichkeit, die unmittelbar in meine Gegenwart eingedrungen ist, mich trösten könnte, nur noch besonders lächerlich und schrecklich gebunden vor, so als erlaube sich jemand einen Spaß mit mir und meiner Dummheit und so als sei mir ein leibliches Kind, von dessen Existenz ich bisher keine Ahnung hatte, ein Kind, das nicht sein kann, untergeschoben worden. Wenn die Mutter nur die vermeintliche Mutter wäre oder als leibliche Mutter das Kind los sei wollte und es bei mir in guten Händen oder in guter Verantwortung glaubte, also nicht wieder zurück käme? Ich komme mir hilflos vor, wie bestraft und lasse mir, während ich an die Hässliche denke, eine jener mütterlichen Weisheiten einfallen, der zufolge an jedem Menschen etwas Schönes sei. Man müsse nur aufmerksam hinsehen. Was meine Mutter in ihrer unschuldigen Schwärmerei aber meistens meinte, waren die Augen alter, verblühter Männer. – Ich weiß nicht wie viel Zeit verstrich. Das Leben im Straßencafe scheint erstorben. Die stramme Kellnerin lässt sich selten hier draußen sehen. Sie hat das eintönige Geschehen von der Tür aus im Blick. Auf einmal tritt eine junge Frau in das Revier. Ich muss ihr Gesicht nicht näher mustern, so frappierend wirkt sie mit ihrer Figur auf mich. Ein Model könnte keine geeigneteren Maße haben. Beine, Hüfte, Busen, alles stimmt. Zielstrebig geht die Schönheit auf den Nachbartisch zu, setzt sich auf den Stuhl, auf dem vor Minuten noch die Potthässliche saß. Mir liegt es auf der Zunge, ihr ein Besetzt! Der Platz ist besetzt, zuzurufen, bevor mir einfällt, wie voreilig ungeschickt das wäre. Schließlich stehen am Tisch vier Stühle, und es ist weder sicher, dass die Mutter des Kleinkindes ihren alten Platz beanspruchen wird, noch überhaupt beabsichtigt, sich wieder zu setzen. Nachdem die Kellnerin trägen Schrittes mit dem Bestellzettel in der Hand sich entfernt, bauen sich wunderbarerweise bereits Blickkontakte auf. Und zwar zwischen uns Dreien! Das Kleinkind schaut. Die Dame am Nebentisch mit ihren unbeschreiblich blauen Augen, einem Blau, wie ich es noch niemals sah, und in das ich hineinzustürzen drohe, ungehemmt und wie in einen Bergsee, mustert uns beide. Ich kann keinen Spott entdecken, wenn unsere Nachbarin ihre Aufmerksamkeit zwischen mir und Ramona teilt, sondern eher mütterliche, zumindest Regungen von Sympathie. Als sie ihren Kaffee bekommt, sich eine Zigarette angezündet hat, sagt sie leise, aber deutlich: Ein schönes Kind. Sie haben ein sehr schönes Kind. Geistesgegenwärtig nehme ich mich zusammen und widerspreche nicht. Noch nicht. Ich schaue nun sogar zärtlich zu Ramona herunter. Ein Wort ergibt bald das andere. Schließlich biete ich an, den Tisch wechseln zu dürfen. Man muss nicht so schreien, sage ich, nehme mein Weinglas, an dem ich über eine Stunde sitze, und schiebe Ramona zurück an jene Stelle, an der sie zuvor gestanden hatte, als ihre Mutter noch hier gewesen war. Ungefragt bekennt die Schönheit, heute ihren freien Tag zu haben, den sie richtig entspannt genießen wolle und weiß mir schließlich zu entlocken, dass ich schon länger arbeitslos bin, also ständig frei habe und kaum noch Hoffnung, erst recht nicht, in meinen Beruf zurückzukehren, den ich als Narr für schöne Bücher, exquisite Buchexemplare sogar sehr geliebt hätte. Vorbei. Alles vorbei. Wir schauen uns an, sehen uns ab und zu länger in die Augen, als das nötig wäre für ein gewöhnliches Gespräch. Dann fragt die Dame, ob sie mir eine Freude machen könne, mich in die Oper einzuladen. Sie habe zwei Karten für heute Abend, und eine ihrer Freundinnen, für die eine Karte gedacht sei, habe absagen müssen. Aber vielleicht sei ihr Angebot auch eine Zumutung, da ich lieber mit meiner Frau gehen würde, und dann sowieso, auch wenn man noch eine Karte dazu kaufte, wahrscheinlich niemand da wäre, um auf das Kind aufzupassen. Sie seufzt, und mir ist dabei zumute, als würde sie selbst lieber auf die Oper verzichten, könne sie nur mit uns tauschen. Da erst mache ich mein Geständnis, stellte es als Missverständnis dar, meiner Schwerfälligkeit geschuldet. Das ist kein Augenblick zu spät. Denn nun kommt Ramonas Mutter, zeigt sich keineswegs verwundert über meine Tischnachbarin, bedankt sich freundlich und mit angenehm anzuhörender Stimme. Wir schauen ihr und dem Sportwagen nach, als sie sich in den spärlich fließenden Strom der Passanten reiht. Mein Angebot steht, sagt die Schöne leise, als handele es sich um ein Geheimnis. Ich liebe Bücher, ohne eigentlich ein Leser zu sein, kann mir heutzutage in meiner Lage kein exquisites Buch mehr leisten, und ich war noch nie in einer Oper. Eine Opernkarte wäre also das Allerletzte, was ich mir kaufen würde. Dennoch sage ich spontan zu und erkläre, eine dritte Karte brauchen wir nicht. Ich bin Single. Seit kurzem solo, füge ich hinzu, weil mir dieser Ausdruck besser gefällt, und weil ich mit dieser Ergänzung zu erkennen geben möchte, dass man mir gewisse Erfahrungen zutrauen kann. Wir treffen uns am Eingang, eine Viertel Stunde vor Beginn, sagt die schöne Frau, die ich für höchstens 25 halte, die also mindestens 15 Jahre jünger ist, als ich selbst bin. Mit dieser Erkenntnis wird mir klar, es handelt sich bei der Einladung um eine Laune, eine Geste der Sympathie, des Mitgefühls mit einem armen Schlucker. Es wird bei diesem Opernbesuch bleiben. Das Leben. Voilá! Zugreifen. Egal wie das ausgeht. Und wenn ich im Schutz der Dunkelheit meine Nachbarin in der Oper nur anstarre, mich an ihrer Hingabe erfreue, als gälte die Verzückung nicht der Musik und dem Geschehen auf der Bühne, sondern mir. Wenn sie dann meine Blicke spürt, ihr Gesicht mir sacht zuwendet, muss ich nicht beschämt wegschauen, sondern kann meine Aufdringlichkeit kaschieren, als das Verlangen nach einer Bündnispartnerin meiner Begeisterung, mit der sich einig zu wissen, den Musikgenuss nur erhöhen kann. Es kam so, und es kam auch anders. Verdis Aida bietet zugegebenermaßen eine gewisse Ablenkung, zumal man genötigt wird, die Übersetzung zu lesen, des italienisch Gesungenen, die über dem Bühnengeschehen auf einem Lichtband erscheint. Ich würde mich als Trottel outen, starrte ich meine Nachbarin ständig an. Schließlich bin ich vierzig Jahre. Da hat man eine gewisse Reife und Abgeklärtheit zu haben. Und die Musik ist ja nicht ohne, besonders wenn Bekanntes, Eingängiges erklingt, zu dem nun noch die entsprechenden Bilder einer Handlung geliefert werden. - Nach der Aufführung ist die Nacht noch nicht hereingebrochen. Es dämmert stark, der Himmel hat eine rötliche Färbung angenommen, die Luft ist lau und süßlich. In einer gewissen Beschwingtheit, einem Übermut, ungeübt, wie das bei einem ist, der sich 15 Jahre von dem verabschiedet hatte, wie man sich unter jungen Leuten ausdrückt, sage ich, ich möchte mich sehr, sehr für den schönen Abend bedanken und revanchieren. Es sprudelt aus mir heraus, gibt meiner Schönen, die zu den bergseeblauen Augen ein blaues Kleid mit betörend tiefem Ausschnitt trägt, nicht die Gelegenheit, zu antworten. Die Revanche stelle ich mir vor bei einer sehr, sehr guten Flasche Rotwein, die ich noch habe, schon länger habe und eigentlich gestern zu meinem Geburtstag trinken wollte. Aber nun war alles anders gekommen, sage ich. Machen Sie mir die Freude, meinen Geburtstag mit mir nachzufeiern, suche ich möglicher Unentschlossenheit entgegenzuwirken und bin überrascht, wie gering der Widerstand ist, den ich zu überwinden habe. Wieder wird mir fast schwarz vor Augen vor dem Unfassbaren. An diesem Abend, in dieser Nacht kommt es zu keinerlei Intimitäten. Wir reden nur, reden und reden, trinken zwischendurch von dem teuren, guten Wein, den ich eigentlich mit Ramona trinken wollte. Ich bin beseligt und weiß, dieser kleine Rausch hat wenig mit diesem Rotwein zu tun. Ich breite mein ganzes, einfaches, langweiliges Leben, auch das Leben mit Ramona, vor ihr aus, habe in ihr eine gute Zuhörerin, die mich aus diesen bezaubernden Augen ansieht, bald wie ein Kind, bald wie eine unschuldige Verführerin. Wieder spüre ich das Platonische in mir regen, so stark, so gesteigert, wie ich es in den frühen Jahren nie empfunden hatte, damals als ich mich mit dem jungen versauten Lehrer über die Liebe stritt. – Kunststudentin, sagt sie, sei sie. Eine ziemlich späte, lacht sie ein weiches Lachen. Daneben verdiene sie sich ihr Brot durch Arbeiten für gestresste Geschäftsleute, Manager, Unternehmer, jedenfalls zahlungskräftige Erfolgsmenschen. Die Nacht ist nur noch kurz, als mich die Schöne bittet, ihr ein Taxi zu rufen. Ich wage nicht ein Wiedersehen anzusprechen. Schließlich haben wir uns wohl alles erzählt. Und bei ihrem Aussehen und Auftreten wird sie es nicht nötig haben, sich noch einmal mit mir zu treffen. Für sie war es nur eine ganz kleine Abwechslung in ihrem interessanten Leben, und ich sollte mich zufrieden geben, nicht als Langweiler empfunden worden zu sein. Trotzdem schade! – Bevor sie geht, ich sie zum schweren Abschied nach unten bringen kann, fasst die arbeitsame Kunststudentin mit zwei Händen meine Rechte. Das nächste Mal, wenn ich Zeit habe, besuchen Sie mich, sagt sie. Wahrscheinlich schaue ich sie nun doch etwas zu begriffsstutzig an, allzu belämmert, wie wir sagen, so dass sie rasch erklärt: Sie sind ein solcher Ruhepol. Man muss sich einfach wohlfühlen. Ich werde Sie anrufen, verspricht sie, bevor sie ins Taxi steigt. Ich warte, winke verhalten mit den Fingern, bis das Auto hinter der Straßenecke verschwunden ist. Die kurze Nacht lässt den Morgen dämmern. Wieder allein, vor ein paar willkommenen Stündchen Schlaf, lasse ich den ganzen langen verflossenen Tag an mir vorbeiziehen. Der Abschied beschäftigt mich besonders. Ich kann wohl gut zuhören, denke ich, versuche mich genau zu erinnern, worüber wir gesprochen haben, vor allem, was mir über meine Besucherin bekannt wurde. Es kommt nicht viel zusammen. Sie hat einiges und begeistert über bildende Kunst geredet, und ich habe ihr einige meiner exquisiten Bücher vorlegen können, die sie offenbar bewunderte. Von ihren Eltern hatte sie liebevoll gesprochen, die irgendwo auf dem Lande leben. Ein Mann spiele in ihrem Leben keine Rolle. Zur Zeit wohl jedenfalls nicht. Wahrscheinlich ist sie frigide und hat einen Vaterkomplex, denke ich böse und empfinde die Erkenntnis nicht gerade als schmeichelhaft für mich. Aber es sei wie es sei. Ich will das Beste daraus machen und zweifle nicht daran, dass sie mich anrufen wird. Der Anruf kommt schon eine reichliche Woche später. Zum ersten Male mache ich mir länger Gedanken, wie ich mich anziehen soll für diesen Besuch bei ihr. Ich stehe vor dem Spiegel, bin gezwungen mich in der von mir empfundenen Unansehnlichkeit zu mustern, lache schließlich leise und wie ein Irrer, denke, es ist tatsächlich nicht mehr weit hin mit dir, bevor mich schließlich die Aufregung über die Erwartungen gefangen nimmt. - Die Schöne wohnt in einer exklusiven Gegend. Das habe ich vorher schon an Hand des Stadtplanes herausgefunden, bin dann aber doch überrascht wie exquisit das Haus, die Häuser ringsum sind. Sicher wohnen kaum mehr als vier Familien in jeweils einem der Gebäude am Stadtrand. Es sind nur zwei Treppen ins Obergeschoss, doch mein Herz klopft für Augenblicke wie nach einem Langlauf. Das geht vorüber, als mir die Tür geöffnet wird. Es ist verrückt, aber meine Schöne trägt Shorts, dazu eine luftige bunte Bluse. Wenn sie sich bückte, schießt es mir durch den Kopf, würden Beine bis zum Ansatz ihres Pos zu sehen sein. Was für eine Aussicht! Aber auch der enttäuschende Gedanke kommt mir sofort, sie nimmt dich als Mann nicht ernst. Andererseits bewundere ich ihr Körperbewusstsein, die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich akzeptiert. Gott, sie kann das! In ihrer Harmlosigkeit wird es ihr also nicht in den Sinn kommen, ich könnte verführt werden. Wahrscheinlich sind Männer über vierzig für sie steinalt und natürliche Eunuchen. Aber damit hat sie sich verrechnet! Ich spüre wie das Platonische immer mehr ins Begehrliche überzugehen beginnt. Noch muss ich mich nicht zusammennehmen, aber als wir am gedeckten Tisch sitzen, die spartanische Einrichtung mich zu ernüchtern beginnt, was meine hohe Meinung über den Geschmack der Kunststudentin anbelangt, der gegenüber ich mich für schrecklich zurückgeblieben halten müsste, spüre ich aus einem Trotz heraus, langsam das Tier in mir wachsen. Ich fühle mich nun zwar ein bisschen verliebt und möchte auf einmal doch Sex haben. So versuche ich das krampfhaft zu analysieren, indem mir Verrücktem wieder der junge Lehrer von damals einfällt, und ich nicht weiß, ob ich froh sein soll, dass trotz des Triebes auch Liebe im Spiel scheint. Wir reden wie zu unserer ersten Begegnung. Dennoch ist es irgendwie anders. Eine Spannung hat sich bei mir aufgebaut, die mich unkonzentriert sein lässt und noch nervöser macht, weil ich das Gefühl bekomme, meine Gastgeberin müsste das spüren, lässt sich nichts anmerken, weil sie sich selbst vollkommen in Gewalt hat. Wir trinken. Sie bedient mich mit Häppchen. Wenn sie sich dabei über den Tisch mir entgegenbeugt, zwingt es mich, ihr in den Ausschnitt zu sehen. Ihre Brust offenbart sich für Momente mir fast völlig. Zu kaum einer anderen Überlegung fähig, rätsle ich begierig, ob die straffen, runden Halbkügelchen Natur, wieso die Zitzen, die sich nur Sekundenbruchteile zeigen, versteift sind. Ich fiebre fast vor Wahnsinn. Alle romantischen Vorstellungen gehen flöten. Schließlich beschäftigt mich nur noch, wie ich sie ins Bett bekommen könnte. Diesem Gedanken räume ich absichtlich so viel in meinem wirren Kopf ein, um Skrupel gar nicht aufkommen zu lassen. Sie ist schön, sie ist jung, sie ist verführerisch. Ich will sie ficken. Egal, was danach kommt. Nur einmal diese Schönheit durchziehen, denke ich absichtlich vulgär, weil ich nun doch gegen eine Stimme ankämpfen muss, die mir stärker einreden will, du hast doch gar keine Chance. Nicht die geringste. Ist Ihnen nicht gut? fragt meine Gastgeberin. Ich verschlucke mich fast, schüttle heftig den Kopf, bevor es aus mir herausschießt, ich möchte mit Ihnen schlafen. Das ist es! - Mein Herzschlag droht auszusetzen. Rasch kann ich noch sagen, und jetzt schicken Sie mich fort. Jage mich davon! Ich schließe die Augen, um mich zu sammeln, nun tatsächlich wie ein Geschwächter. Als ich sie gleich darauf wieder öffne, steht die Schöne neben mir, beugt sich über mich, so dass ich gezwungen bin, in ihren Ausschnitt zu sehen, ihn zu atmen. Komm, sagt sie leise, so leise, dass ich die Aufforderung mehr erahne, als sie zu hören. Komm, wiederholt sie, indem sie vorangeht in das Zimmer ihrer Wohnung, das meinen Blicken bisher verborgen geblieben war. Trotz meiner Erregung, der Aufgewühltheit bin ich imstande, zu staunen. Enttäuschten mich das Spartanische und Möbel, die ich einem Kaufhauskonzern namens Ikea zuordnen würde, empfängt mich das Schlafzimmer mit einer Eleganz der Schränke, des breiten bedeckten Bettes, der Schränkchen, Kommoden und Üppigkeit, von guten Kopien moderner Maler und alter Meister. Wäre das französische Bett nicht vorhanden, könnte man glauben, sich in einem Salon zu befinden. Ich fasse mich schnell wieder, bin nur überrascht, als sie mir eine Tapetentür öffnet, die nicht gleich als solche auszumachen war, und mich dahinter schickt. Ich stehe in einem Kabuff mit WC, Waschgelegenheit und Spiegel, praktisch für jemanden, der nachts des öfteren raus muss, denke ich. Wahrscheinlich wurde das Schlafzimmer vom Vormieter übernommen. Günstig sicherlich. Ich weiß, was ich zu tun habe, wobei mich kurioserweise eine Kindheitserinnerung überfällt. Bevor wir aus dem Haus gingen, nervte meine Mutter mich stets, geh noch mal aufs Klo. Die Erinnerung dämpft meine Erregung, und für Momente zweifle ich, denke sogar daran, das Abenteuer zu beenden, mich mit Anstand aus der Affäre zu ziehen, alles für einen Spaß zu erklären, mich zu verabschieden. Der Moment geht vorüber. Im Bett kommt mein Glied ins Zittern, schlägt wie eine Wünschelrute durch die sanften Berührungen, und ich kann den Erguss nicht verhindern. Es ist, als sei es das erste Mal! Ich schäme mich meiner Schwäche. Macht nichts, sagte sie, die völlig nackt und deren feine, glatte Haut überall gebräunt ist. Sie spricht leise raunend und wie ich finde mit gewisser Zärtlichkeit. Oder halte ich Nachsicht für Zärtlichkeit? Macht absolut nichts. Es wird wieder werden, sucht sie mich zu beruhigen. Sie wird Recht bekommen. Wir vereinbaren, dass sie mich anrufen wird, sobald es ihre Zeit erlaubt. Ich sollte nicht ungeduldig sein. Aber sie habe neben dem Studium sehr viel zu tun. Wieder spricht sie dabei auch von ihren Eltern auf dem Lande, die sie noch mit unterstütze. Brave Tochter, denke ich und fühle mich längst nicht mehr so alt, um fast ihr Vater sein zu können. Auf dem Handy anrufen sollte ich sie lieber nicht. Meistens sei es sowieso ausgeschaltet, und nur die kühle fremde Stimme der Mailbox würde meinen Anruf entgegennehmen. Hab also Geduld, sagt sie, streichelt mein Gesicht, und ich habe Mühe, meine Hundeaugen nicht spielen zu lassen. - Im Bett werde ich immer besser. Sie macht es mir nicht schwer, versteht es, feinfühlig, wie ich finde, auf mich einzugehen, verhält sich nicht wie ein Brett, nicht wie eine Matratze, um einen Ausdruck des versauten Lehrers anzuführen. Sie weiß den Akt mit zu steuern, so dass mir ein vorzeitiges Kommen nie wieder passiert. Allerdings muss ich mich tatsächlich sehr in Geduld üben. Es vergehen mitunter 14 Tage oder drei Wochen, bevor mich ihre Telefonstimme in Aufregung versetzt. Ich bin verliebt und bin süchtig. - An den Tod denke ich nicht mehr. Aber kann man das von sich behaupten, wenn man den Tod wirklich vergessen hat? Jedenfalls hat sich mein Leben verändert. Oft, viel zu oft, bewegen sich meine Gedanken nur um uns beide. Immer wieder stelle ich mir das Gesicht mit den hellblauen Augen, den winzigen Grübchen beim Lachen vor. Die Vorstellung ihres nackten Körpers macht mich rasend. Ich hätte eine solche Abhängigkeit nie für möglich gehalten. Nicht jede unserer Begegnungen landet im Bett. Und manchmal denke ich, sie hält dich hin, du wirst auch gerade dann gern eingeladen oder sie kommt gerade dann zu dir, wenn sie ihre Tage hat. Es ist sicher Quatsch, das anzunehmen. Und wäre es so, könnte es sogar ein Liebesbeweis sein. Aber wenn wir uns länger nicht gesehen haben, verspüre ich Eifersucht und Misstrauen, gegen das ich tapfer anzukämpfen suche. Schlimmer ist schon, dass ich mich kaum zu etwas Gescheitem aufraffen kann, höchstens versuche, mich abzulenken, indem ich mich tagsüber wieder auf der Straße herumtreibe, bis in die Nachtstunden die Fernbedienung des Fernsehers traktiere. Wie schön war unser erster Tag, jener befürchtete Abend in der Oper. Inzwischen gehen wir nur noch ganz selten aus. Sie sei zu erschöpft, bekomme ich zu hören, der ich mich früher in meinem anderen Leben als Ausgehmuffel bezeichnen lassen musste. Die Opernkarten waren wohl eine einmalige Gelegenheit. Oder bin ich ihr für die Oper nicht der richtige Partner mit Verständnis? Geht sie nun mit einer ihrer Freundinnen, von denen ich nie eine gesehen habe? Ich weiß, sie mag solche Musik. Nicht ausschließlich. Vielleicht schämt sie sich mit mir? Mich beschäftigte schon der absurde Gedanke, das Opernhaus nach der Vorstellung einer Opernaufführung aufzusuchen, von der ich weiß, sie mag gerade dieses Werk besonders, um heimliche Beobachtungen anzustellen. So weit ist es mit mir gekommen! Schlimmer. Manchmal kann ich nicht anders, es treibt mich in ihre trostlos einsame Wohngegend. Wie die Katze um den heißen Brei schleiche ich mit Schamgefühlen dort herum, ständig gewärtig, man verdächtigt mich irgendwelcher dunkler Absichten. Es ist ein hässlicher Zustand. Aber warum werde ich so oft hingehalten? Ich habe nicht den Mut, meiner Liebsten Vorwürfe zu machen. Sie könnte empfindlich und übelnehmerisch reagieren und Schluss machen wollen, denn ich weiß ja eigentlich noch immer nicht, ob ich ihr mehr bedeute. als dieser Wohlfühlruhepol, als jemand, den sie gelegentlich benötigt, etwa so wie man sich ab und zu einen Restaurantbesuch gönnt. Das Schlimme ist auch, ich könnte sie nicht einmal dorthin oder sonst wohin einladen, um mich mit ihr zu zeigen, weil ich nach wie vor der arme Schlucker bin, dem man noch dazu das Arbeitslosengeld gekürzt hat, der jetzt über nicht mehr Geld als ein Sozialhilfeempfänger verfügt. Eine beschissene Situation. Die gelegentlichen Aushilfen in verschiedenen Jobs, auf die ich früher nur mild herabgesehen hätte, die ich heute machen darf, erlauben nur eine lächerliche finanzielle Aufbesserung. Soll ich mich von einer Studentin, noch dazu blutjungen Frau aushalten lassen? Eine schreckliche Vorstellung! Lässt sie mich allerdings wieder zu sich, ist alles vergessen. Ich könnte mich sogar glücklich fühlen. Die liebenswürdige Wesensart hat sehr Beruhigendes, Einlullendes. Wir haben uns nicht ein einziges Mal gezankt. Ich glaube, sie hat ein Gespür dafür, etwas von einem witternden Wild, Unangenehmes nicht zu berühren, mir trübe Gedanken zu vertreiben, Grübeln in ihrer Gegenwart nicht zuzulassen, ohne dass ich sie deshalb für oberflächlich halten muss. Wie sie das anstellt, ist ein, ist ihr Geheimnis. Einmal, als ich im Bett auf sie wartete, während sie sich noch im Kabuff aufhielt, suchte ich mich abzulenken, meine Erregung zu begrenzen. Weder Chagalls schwebende Engelmenschen, noch andere Bilder boten inzwischen genügend Ablenkungen. Da vergriff ich mich halb mechanisch, halb neugierig, im Liegen gut zu erreichen, an einem Schub ihrer kleinen Barockkommode. Es war ein Schlüsselchen umzudrehen. Ich erwartete nichts Besonderes. Jedenfalls waren meine Gedanken nicht bei der Sache, bei dieser Sache. So brauchte ich auch einige Momente, um zu begreifen, was sich entdecken ließ, feine Wäsche, zarte, farbige Unterwäsche, nicht unbedingt ordentlich zusammengelegt, und obenauf Schächtelchen mit Präservativen, lose verteilt. Ich erschrak, nachdem ich mich gefasst hatte und drückte hastig den Schub zu. Wie ein kleiner Junge kam ich mir vor, der unvermutet die Weihnachtsgeschenke entdeckte, die seine lieben Eltern vor ihm versteckt hatten, bevor ich mir einige dumme Gedanken machte. Schließlich tröstete ich mich, sie wird so etwas für alle Fälle vorrätig haben, für jene aus vergangenen Beziehungen. Sie hat vergessen, was dort liegt. Ich will auch jetzt nicht in ihrer Vergangenheit herumkramen, nicht daran rühren, wenn sie es nicht will. Stellt der Verzicht der Kondome nicht ein großen Vertrauensbeweis ihrer Liebe dar? tröstete ich mich und konnte dabei sogar mein schlechtes Gewissen wieder vergessen, als meine Schöne aus dem Kabuff zu mir kam. Nicht völlig nackt, sondern in verräterisch durchsichtiges Zeug gekleidet, das ihre Brüste, ihre Scham bei jedem ihrer Schrittchen mal verdeckte, mal freigab und so meine Erregung kochen ließ. – Daran muss ich denken, während ich mich wie ein Verdurstender nach ihr sehne und mir allerlei zusammenspinne. Inzwischen ist es Herbst geworden, ein milder, der übergangslos aus dem Sommer hervorwuchs. Nur die Tage sind elend kurz geworden. Ich streune noch immer gelegentlich vor ihrem Haus herum, immer bemüht, von niemandem entdeckt zu werden, und fühle mich elend und verlassen dabei. Aus dem Weltall weht es mich kalt an. Um meine Erniedrigung weniger zu spüren, versuche ich mein Elend zu analysieren und komme darauf, die Gefühle ins Allgemeine zu transponieren: Eine gottlose Welt, eine, in der wir mutterseelenallein sind, ist eine sehr gnadenlose, aber keine gefühllose Welt. Sie ist nur umso vieles gnadenloser. - Aber könnte nicht die Anwesenheit von Gefühlen als Gottesbeweis gelten? suche ich die Gespenster zu vertreiben. Plötzlich fährt ein Auto vor. Schnell ziehe ich mich hinter den dicken Stamm einer Platane zurück. Das Taxi entlässt einen Mann, ein Männchen, etwa um die 50, wie ich in der Dämmerung zu erkennen glaube. Im Lampenlicht sehe ich den feinen Zwirn, wie wir sagen. Meine Spannung wächst, als das Männchen, in der Hand so etwas wie ein Diplomatenköfferchen, auf das Haus meiner Schönen zugeht, die Tür zum Grundstück sich sofort öffnet, der Mann dann ohne Zögern im Haus verschwindet. Überall hinter den Fenstern ist es dunkel. Schwer zu bestimmen, ob die Bewohner noch mit Licht sparen, bevor es richtig dunkel wird, oder ob sich niemand in den Wohnungen befindet. Warum erhellt sich kurze Zeit darauf ausgerechnet das stets gardinenverhüllte Fenster des Salons? Das Licht flammte hell auf, um sofort durch den Dimmer in eine, wie wir sagen, Muschepupubeleuchtung überzugehen. Mein Herz schlägt wie rasend. Was soll ich tun? Ich zittere am ganzen Körper. Soll ich alle Vorsätze, an meinem Glück nicht zu rühren, es zu genießen, so lange das möglich ist, über Bord werfen, hinübergehen und Sturm klingeln? Nein, ich bleibe stehen. An den Baumstamm gelehnt, warte ich. – Und dann auf einmal spüre ich, ich habe, wie ein kleiner Junge, eingenässt. Mir ist zum Heulen zumute. Aber da, ich weiß nicht, habe ich alle Vorsicht vergessend, von Vorübergehenden entdeckt und beargwöhnt zu werden, mich eine halbe Stunde, eine Stunde oder mehr als eine Stunde nicht von der Stelle bewegt, fährt wieder ein Wagen vor, und das Männchen verlasst mit schnellen Schritten das Vorgärtchen, steigt ins Auto. Ich bemerke nicht einmal das Davonfahren, starre weiter nach oben. Dort geht das Licht nicht aus. Auch im Untergeschoss erhellt sich ein Küchenfenster. Ich könnte die älteren Leute hantieren sehen. Aber ich will nicht. Wenn dieser Mensch im feinen Zwirn ein Arzt war? Vielleicht ist sie krank? Soll ich doch läuten? Ich müsste mich verraten, und ich habe eine nasse Hose. – Ich hasse das Leben, hasse mein Leben!
Kindsängste
Das Alter verringert die Ängste um das Unbekannte, Krankheiten, Tod eingeschlossen; bleiben die vor dem Unmittelbaren, Tod nicht ausgeschlossen. Und doch wurzelt einiges Andere so tief, dass man als alter Mensch selbst durch Einsicht in das Läppische, Einleuchtendes in mögliche Ursachen, erschreckt, verwundert, verärgert, sich schlecht abfinden will mit diesem offenbar nur scheinbar Banalen, etwa so wie jener Karl Kassek, ein Rentner im 63. Lebensjahr, der sein gesamtes Arbeitsleben in nicht mehr als vier Büros verbracht hatte, Jahre verwitwet, allein zurechtkommen muss, jedenfalls im Alltag, wobei der Wechsel der Arbeitsstätten und Wohnungen stets Zwängen unterworfen gewesen war. Seine beiden Kinder, Tochter und Sohn, inzwischen länger stadtflüchtig geworden, verließen ihren Vater, da die Stadt mehr und mehr zunehmend hoffnungslos verkam, die ihrer Kindheit rundum Obhut gegeben hatte, nun vor allem zum Aufenthaltsort geworden war für Rentner, Pensionäre, Behinderte, Sozialhilfeempfänger jeder Couleur, und Arbeitslose, die aus mancherlei, schon verdächtigen Gründen, die Stellung hielten. Die Rede sei aber nicht von einem pfahlwurzelnden Respekt Kassek, Karls vor jenen Menschen, die eine bevorzugte Stellung in der Gesellschaft einnehmen, indem sie mindestens Aufmerksamkeit zu erregen wussten oder auch bloß, dank beruflicher, behördlicher, gar politischer Befugnisse, um einiges aus der Masse hervorragen. So sehr ihn die Devotionen kränken, von denen Herr K.K. stets überfallen wird, die ihn hemmen, als ob sich ein geworfenes Netz um ihn zusammenzöge, er um die Ursache weiß, vorsichtiger gesagt, zu wissen glaubt, nämlich Erziehung durch eine, den unbegabt Fleißigen zu Höherem anstachelnde, stets hierarchisch denkende, zu beeindruckende Mutter, soll davon weniger die Rede sein. Auch nicht von den Beklemmungen im freiwilligen oder aufgenötigten Umgang mit Uniformträgern, die ihn lähmten oder Herrn K.K. Gewalt und Kontrolle über sich verlieren, ihn schnell zum Stotterer und Zitterer werden ließen, wobei die Vergangenheitsform Berechtigung hat, da seit dem Ableben der beiden Diktaturen, denen K.K. sich zu entziehen nicht imstande gewesen war, zuerst objektiv, später subjektiv und schließlich wiederum weitgehend aus Gründen, die weniger in seiner Macht standen, merkliche Besserung eingetreten war, verdächtigt allerdings zuerst von ihm selbst, so sehr fühlte Karl Kassek sich dabei in seiner Mentalität mit der eines trockenen Alkoholikers verwandt.
Was ihm wirklichen Kummer bereitete war nicht das Alleinsein schlechthin. Damit kam er dank eines ordentlich organisierten Tagesablaufes von an sich eintöniger Regelmäßigkeit gut zurecht. Es war das Alleingelassensein, das ihm zu schaffen machte in gewissen Situationen, die eben diese Ordnung bedrohten, wie diese lächerlichen Vorkommnisse beispielsweise, wenn es in dem großen unübersichtlichen Mietshaus, mit ständig wechselnden Mietern, in dem K.K. seit inzwischen knapp sieben Jahren wohnt, lärmt, plötzlich Stimmen laut werden, die auf Streitigkeiten tippen lassen, solche, bei denen man obendrein Tätlichkeiten vermuten konnte, weil Poltern und Schreie zu ihm nach oben in den IV. Stock dringen, Lauschen hinter der Tür kaum Aufklärung bringt, denn Kassek hört keine Stimme heraus, die er zuordnen könnte; zu oft wechseln die Mieter, die auf eine preisgünstige Wohnung hofften, enttäuscht wurden, durch hohe Abrechnungen oder sich verschuldeten, kurzentschlossen ihre Siebensachen packten, wozu meist eine Stunde und ein Kleinwagen für den Abtransport genügten, wenn sie auf Nimmerwiedersehen verschwanden, das Gefühl hinterließen, in einem heruntergekommenen Haus zu wohnen, dessen Wohnungen inzwischen vorzugsweise an Sozialabsteiger vermietet werden. Krach und laute Stimmen konnten Kassek ebenso glauben machen, es sei ein Einbrecher ertappt oder ein Eindringling gestellt worden. Dem Fantasiebegabten, einst weder von Vater noch Mutter je völlig erkannt, geschweige gefördert, schießen noch andere Möglichkeiten durch den Kopf, während sein altes Herz vorübergehend ins Trommeln gerät. Er macht Sprünge wie eh und je, dieser Muskelklumpen in seiner Brust, bevor sich Karl Kassek Entwarnung geben kann. Falscher Alarm, wie so oft, wie immer wieder in diesen Zeiten. Aber wusste man denn, was sich Bedrohliches hinter den Wohnungstüren abspielte? Nicht, dass sich der Rentner um seine weitgehend unbekannten Mitbewohner sorgte, sollte es unter ihnen zu Mord und Totschlag kommen. Was gingen ihn schließlich wildfremde Leute an, mit denen er noch nicht einmal einen Gruß gewechselt hatte? Das war das wahrhaft Gute an der Anonymität, eigentlich nicht belästigt zu werden, sich nicht zu belasten. Die wenigen Altmieter bildeten den Draht für K.K. zu seiner unmittelbaren Umwelt, von der er oft weniger wusste, manches Ereignis viel später erfuhr, als von Begebenheiten in der großen weiten Welt, die erdumrundend fast zur gleichen Stunde in seinem Wohnzimmer als News eintrafen, ihn kaum mehr beunruhigten. Von Unglücken, Verbrechen, politischen Morden und anderen Katastrophen, verursacht durch Mensch oder Natur, ist nahezu allabendlich zumindest in schmerzloser Kurzfassung die Rede. Aber es könnte hier Unachtsamkeiten geben, die einen Wohnungsbrand auslösten. Selbstmörder könnten in vermuteter Unwissenheit sich gasvergiften wollen, dabei durch das Erdgas zwar nicht umbringen, aber das Haus in die Luft jagen. Mörder, eifersüchtige Liebhaber, vom Verlassen bedrohte Lebenspartner könnten Brände legen aus Rache oder unter Alkoholeinfluss, Einbrecher könnten zu Brandstiftern werden aus Verärgerung oder zur Vertuschung ihrer Untat. K.K. lebte zuweilen in Aufregung, so gern er sich in seiner Wohnung verschanzte, sich dem beglückenden Gefühl von Geborgenheit überließ. Leider war dieses Glücksgefühl immer nur von kurzer Dauer, letztlich tröstlich durch die Einsicht, dass es sich dabei ohnehin um eine wesentliche Eigenschaft von Glücksempfindungen handelt, flüchtig zu sein. Karl Kassek war kein gleichgültiger, kein Mensch, der sich mit der naiven Bezeichnung böse charakterisieren ließ, um diesen möglichen Anschein gleich wegzuwischen, obwohl man sich selbst sein Bild machen kann, denn Kassek war ebenso wenig Dulder des Bösen, wie er zum Erdulder taugte. Er billigte sie nicht, sondern ließ die schlimmen Nachrichten möglichst nicht an sich herankommen, denen man ohnehin ohnmächtig ausgeliefert war. Der Rentner übersah zwar die ausgestreckte Hand des Bettlers am Straßenrand, weil er sich scheute vor jeglichen Aufdringlichkeiten, bediente aber gern Spendenkonten bei aktuellen Nöten in der weiten Welt, zur Beruhigung seines Gewissens, zur Besänftigung der Götter, zur Auffrischung seines Glücksgefühls. Ihm ging es gut. Eigentlich so gut wie noch niemals. Die Hungerjahre seiner Kindheit waren dabei ebenso wenig vergessen wie die frühen Jahre der Ehe mit den Sorgen, als die Kinder noch klein waren, das Geld knapp blieb. Das gegenwärtige Lebensgefühl ließ sich wunderbar in diesen Erinnerungen spiegeln, zu denen die trüben Erfahrungen von beengtem Wohnraum gehörten. Diese mit dem Vierpersonenhaushalt der Familie K.K, sowie die der noch früheren, als Karl ein Kind war und sie ebenfalls zu viert auf 54 qm hausten, von Exmittierung bedroht wurden, während der Vater, ein ehemaliger Nazi, für Jahre einsaß. Fremde, strenge Männer in Uniform waren gekommen, um den Vater wegzuführen, die Wohnung zu durchsuchen, als der kleine Karl inmitten der Unordnung still und bewegungslos auf dem Fußboden über seinem Spielzeug saß, nichts begriff. Sie hätten die Miete, die etwa 1/10 heutiger Mieten betrug, auch ohne den Ernährer bezahlen können, weil die Mutter sofort eine Hilfsarbeit fand; die angedrohte Zwangszuweisung in eine erbärmlichere Unterkunft gehörte zur Strafe, war Teil politischer Bestrafung. Der rührigen Mutter sei es zu danken gewesen, dass es bei der Bedrohung geblieben war. Karl mochte es sich nicht ausmalen, wie die Mutter es angestellt hatte, das Schlimme abzuwenden. Damals konnte er es sich nicht vorstellen, jemals diese Wohnung zu verlassen, in der er dann ein Vierteljahrhundert zubringen sollte. Das lag sehr weit zurück, und keine Sehnsucht brachte ihn wieder dahin, obwohl er weder der ärmlichen Kindheit, noch der bescheidenen seiner jüngeren Jahre mit Bitterkeit gedachte. Eher überwog die Wehmut über die Vergänglichkeit, während Karl Kassek es nur als einen Ausdruck höherer Gerechtigkeit empfand, dass es ihm nun im Alter so gut ging, denn um das tägliche Brot musste er sich keine Gedanken machen. Ein finanzielles Polster war wie ein sanftes Ruhekissen, das ihm sicher nur weggezogen werden konnte, wenn sich diesbezüglich der Allgemeinheit schlaflose Nächte bemächtigen würden.