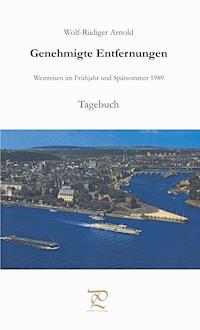7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Handlung spielt in Mitteldeutschland in der ‚Vorwendezeit’. Geschildert wird eine leicht verrückte Gegenwart des mäßig erfolgreichen Malers Johannes Gerber, dem sein Jugendfreund Joachim Deixel erscheint. Die ‚Erscheinung’ bemüht sich, ungerufen und unvermutet auftretend, den inzwischen Fünfzigjährigen anzustacheln, sich aus seinem Trott, einer Lethargie, zu befreien. Diese Inaktivität ist sowohl charakterlich, als auch gesellschaftlich bedingt. Letzteres sollte nicht überbewertet werden, da die nun einsetzenden Ereignisse vergleichsweise harmloser, eben leicht verrückter Art, sind. Nicht immer tritt der Jugendfreund direkt auf, aber stets ist er hinter einer plötzlich durcheinander geratenen Wirklichkeit zu vermuten. Durch die Erscheinung angeregt, erinnert der Ich-Erzähler gemeinsame Vergangenheit, beginnend mit der Schulzeit in den fünfziger Jahren über Stationen des umtriebigen Deixel, der sich in den verschiedensten Berufen als Lehrer, Aushilfskellner, Wirtschaftler, Maler, Schauspieler, (Fernseh-)Autor) ausprobierte, bis zu seinem wahrscheinlichen Ende als Selbstmörder, Anfang der Achtziger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Wolf-Rüdiger Arnold
STACHEL IM FLEISCH
Ein KÜNSTLERROMAN
Engelsdorfer Verlag2008
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Copyright (2008) Engelsdorfer Verlag
Coverabbildung: Ausschnitt aus Francisco Goyas Schlussbild der „Caprichos“ (1789)
Alle Rechte beim Autor
www.pernobilisedition.de
eISBN: 978-3-86901-310-7
Inhalt
Titelseite
Impressum
Vorbemerkung
Erster Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Zweiter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Dritter Teil
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Vorbemerkung
Nachfolgende Geschichte ist sowohl die Geschichte Joachim Deixels, aufgeschrieben von seinem jüngeren Freund Johannes Gerber, als auch dessen, zumindest in Teilen. Sie wurde begonnen vor dem gesellschaftlichen Umbruch in dem östlichen Landesteil. Etwa ab 1988, so ist zu erfahren, hatte man dort klammheimlich die Zensur abgeschafft. Einiges mehr schien nun möglich. Nach den gesellschaftlichen Veränderungen, schon Ende 1989, erst recht nach der Vereinigung des östlichen Teiles mit dem westlichen, hat man diese Geschichte nicht mehr hören wollen. Ich setze wenig Hoffnungen darauf, dass man ihr heute wieder mehr Aufmerksamkeit schenken möchte, fühle mich aber dem Andenken der beiden Protagonisten verpflichtet, mit denen ich bekannt war, indem ich mich um eine Veröffentlichung sorgte. Vielleicht gibt es Leser, die wissen wollen, wie es damals auch war, als es hier eine Diktatur gab, die zweite, in einem Jahrhundert. Horrorgeschichten darf man nicht erwarten. Die Aufzeichnungen stammen von einem Menschen, dem es an Mut, rebellischem Charakter und eigentlich den rechten Antrieben fehlte.
Die gesellschaftlichen Zustände verändern sich. Das Verständnis für menschliches Verhalten bleibt, weil nun einmal allen bisherigen Erfahrungen zufolge, den Grundzügen menschlichen Verhaltens etwas Unabänderliches anhaftet. Ich habe am Text wenig verändert, nicht viel mehr als einige Worte. Die behutsame Vorgehensweise glaubte ich nicht nur den beiden Künstlern schuldig zu sein, sondern gleichermaßen einem Zeitdokument.
Der Herausgeber Leipzig, im Jahre 2008
Erster Teil
I.
Da war dieser Sommertag, der den Juni halbierte. Die flirrende Hitze. Mein Leichtsinn, das schützende Dach schwerbelaubter Bäume zu verlassen, mich dumpfer Glut auszusetzen, die den Kopf benebelte. Als ob ich es darauf angelegt hätte in Euphorie zu geraten, mich in einen Rausch zu versetzen, der den Blick verschleiert, das Herz sonderbar klopfen lässt, lustvoll und beängstigend, wie manchmal beim Beischlaf, wo zu spüren ist, dass höchste Wonnen klopf – klopf – klopf – klopf mit purem Leben, präzise, Verlust an Lebenszeit bezahlt werden. Ich war in Gedanken, in angenehmen, die mich die zahlreichen Spaziergänger ringsum vergessen ließen. Ich träumte Simples, ohne das einfache Bild später zu einem gemalten Bild machen zu wollen. Ich träumte, ich läge an der See, am Meer, hörte dumpfen, ewigen Wellenschlag, wildes Vogelkreischen, und mein Traum war so intensiv, dass ich glaubte, den kühlen Wind zu verspüren, der eine bloße Brust streichelte. Diese Wohltat machte sehnsuchtsvoll und genügsam in dieser Sehnsucht; paradoxe, betrügerische Erfahrung, die man vielleicht erst zwischen vierzig und fünfzig macht. Dann kam die Brücke über den stinkenden Fluss, der noch angeschwollen war von tagelangen Regenfällen, nun faul und träge in seiner Schwärze zu liegen schien. Ich bin ein ängstlicher Mensch, und ich fürchte mich auch über Brücken zu gehen. Zwar sage ich mir, was mir die Vernunft sagt, das Bauwerk ist so berechnet und konstruiert, mit xfacher Sicherheit ausgelegt, das es nicht einstürzen kann, aber meine Fantasie lässt mich nicht im Stich, wenn ich mir ausmale, dass unter der graublauen Farbe das Eisen angenagt und zerfressen wird, an irgend einer Schwachstelle wird es angenagt und zerfressen … Die Menschen, gutgläubig und in Massen vereint, verlässt ein Vertrauen in Konstruktion und Tragfähigkeit nicht. Es scheint, als ob sie sich als Herde besonders wohl und sicher fühlen über die Brücke zu gehen. Hinüber. Herüber. Und die Schritte pochen und pochen. Nicht im Gleichschritt klopft es da, was Brücken zum Verhängnis werden kann. Immerhin. Schon höre ich es knirschen …
Ich war nicht erschrocken, beim Anblick dieses Gesichtes, seines schiefen Angesichts mit den unverkennbar dunkelroten Haaren. Es tauchte auf aus der Menge, verschwand in der Menge. Ich hatte es lächeln gesehen, und ich war träge verwundert, etwa wie man in einem Traum träge verwundert etwas registriert, was Träumen gehorcht, doch außerhalb des Traumes keinen Bestand haben dürfte.
Dann sah ich den lächerlichen älteren Mann mit Glatze und Haarkranz, einen Kinderwagen schiebend, auf das Dreijährige einredend, geschwätzig, infantil, und erlebte wie dieser Kinderwagen plötzlich scharf rechts an das Brückengeländer gefahren wurde. In die Schere war ein Halbwüchsiger auf einem Fahrrad geraten, der verlor an Balance, rang nach Gleichgewicht, indem er sich ans Geländer klammerte, gewann endlich Boden unter den Turnschuhen.
„Hier ist Fußweg! Hier ist Fußweg!“ keifte der Alte, und es klang, als schüttle er den Jungen.
Die Verteidigung des Jungen war schwach, obwohl er jetzt auf festen Füßen stand. Aber der zornige Alte wusste zu belehren, dass die uferseitig eingerammten, senkrechten Trägerstützen, die sich mitten in den Weg stellten, den Fußweg markierten.
„Hier ist Fußweg! Hier ist Fußweg!“ wiederholte der Belehrer, und jetzt schüttelte er den Beschränkten sogar.
Ich glaube, ich sah nicht recht, denn nun stürzten sich Leute, Passanten, friedliche Fußgänger, auf die handgreiflichen Diskutanten, um selbst tätlich zu disputieren. Da hörte ich es krachen und knirschen. Der hölzerne Bodenbelag, der den früheren brüchig gewordenen Beton ersetzte, gab nach. Ich wollte fliehen, fühlte mich gelähmt, immer noch wie in einem Traum, einem, in dem Flucht manchmal unmöglich wird, wenn uns das Unglück auf den Fersen sitzt. Sah ich Fäuste sich ballen? Ich weiß das nicht genau. Mich erschütterte, wie sich Friedlichkeit schlagartig verwandeln kann. Ich sah Drückeberger, die bloß von weitem ein Auge riskierten, das blaue Auge fürchteten. Ich sah Mütter ihre Kinder wegzerren, hörte sie aufgeregt oder brutal auf die Kleinen einwirken.
Der Anblick einer aufregend Geschminkten.
Mit hochhackigen Schuhen, die ihren Beinen attraktive Muskeln formten, rief sie ihrem eigensinnigen Jungen zu: „Ich werde dir den Arsch verdreschen, wenn du nicht hörst.“
Das Söhnchen hörte nicht. Und während sie sich mit ausholender Hand bückte, bot sie selbst einen Hintern dar, der mich nicht weggucken ließ. Ich weiß nicht, was ich gerade dachte, da fühlte ich mich weggezogen, weggeführt ans sichere Ufer. Gerade in dem Augenblick, als Menschen ins Wasser fielen, in die schwärzliche Brühe, den chemiegeschwängerten Fluss. Da wusste ich erneut das Gesicht mit der blitzenden Brille neben mir. Der Schreck blieb aus, obgleich ich mich nicht bloß an jemanden erinnert fühlte, den ich zuzeiten meinen Freund nannte, der mein Freund nicht mehr sein kann, sosehr ich das auch wünschte oder nicht wünschte, weil es ihn nicht mehr gibt, geben dürfte, weil er gestorben ist – und ich war selbst bei seiner Totenfeier.
Joachim Deixel. Dieser, meinem ehemaligen Freund ähnliche Mensch hatte mich nicht gerettet, auch wenn er Miene machte, als hätte ich ihm Rettung zu verdanken, bevor sich Fliehende zwischen uns schoben. Die Ähnlichkeit war frappierend. Die gleichen Gesten, die Mimik im Schiefgesicht, sogar der festliche Anzug kam mir bekannt vor. Mein unsicherer, sich und anderen Sicherheit vorgaukelnde Joachim trug jenen Anzug zu allen Festlichkeiten und solchen Gelegenheiten, die seiner Auffassung zufolge festlich zu sein hatten. Ich habe ihm die blaugraue Maskerade zum 1. Mai gegönnt, schließlich hat dieser Frühlingstag noch Tradition, die nicht gleich tot zu marschieren ist, aber, dass er die Wahlen zur Volkskammer oder die Kommunalwahlen so zu ehren sich bemühte, vergrößerte meine Pein, ließ mir bewusst werden, dass ich äußerlich noch so schäbig vor die Wahlurne treten konnte – es machte das schäbige Gefühl in meinem Inneren nicht wett. Nun also ein Sonntagsspaziergänger, der einem Joachim Deixel, wenn nicht aufs Haar glich, so doch zum Verwechseln ähnelte. Ich wollte mich nicht beirren lassen. Ich wollte an einen Doppelgänger glauben, einen harmlosen Sonntagsspaziergänger. Ich glaubte fest daran. Aber dann winkte mir der Fremde zu. Zwar vergewisserte ich mich, indem ich mich umdrehte, musterte, was mir den Rücken stärken könnte, doch ich musste meine Zweifel alsbald fahren lassen, denn das Winken galt tatsächlich mir.
„Kennst du mich nicht mehr?“ musste ich mich nun auf einige Schritte Entfernung fragen lassen, und ich weiß nicht, welcher Teufel mich ritt, dass ich, immer noch traumträge, mich auf das Spiel einließ, mitspielte, ohne den Verwunderten zu mimen, sondern fast schon beleidigt fragte: „Hören Sie, was soll das? – Was treiben Sie? Sind Sie es … bist du es? Sind Sie sein Bruder? Sein Zwillingsbruder. Ich wusste nicht, dass Joachim einen Zwillingsbruder …“
Der Fremde oder der, den ich für einen Zwilling hielt, lachte auf. Wer Zwillinge je hat lachen hören, weiß, dass sie im Gleichton zu lachen verstehen, und dieses Gelächter erinnerte mich stark an meines verstorbenen Freundes Lachen, so dass immerhin auszuschließen war, dass sich ein Fremder Scherze mit mir erlaubte. Das beruhigte mich nicht. Das ließ mich verstärkt die Hitze fühlen. Das ließ mich sogar an einen Sonnenstich denken, denn immerhin brachte ich so viel Ordnung in meine Gedanken, um mir klar werden zu lassen, Joachim Deixel hat keinen Zwillingsbruder gehabt, hat vielleicht väterlicherseits einen Halbbruder haben können … Aber diese Ähnlichkeit! Ich dachte, es wird höchste Zeit, dass du wieder in den Schatten kommst. Suche eine Bank auf. Atme einige Male tief durch. Ich riet mir auch, die Augen zu schließen, so das Bild loszuwerden. Verwarf jedoch den Rat als kindische Vogel-Strauß-Politik.
„Erkennst du mich nicht mehr?“, wollte die Phantasmagorie erneut wissen, und da ich mich sicherlich wie der ungläubige Thomas anstellte, dem der Herr erlaubte, die Finger in die Wundmalezu legen, schob sich ein Ärmel unter meinen Arm, so dass ich Fleisch zu fühlen glaubte, jedenfalls einen Körper, Körperliches. Im guten Anzug allerdings. Nur jetzt nicht aufschreien, dachte ich. Oder zusammensacken. Jetzt tun, als sei überhaupt nichts.
„Ich bin schon ein ganzes Weilchen hinter dir her“, hörte ich es an meiner Seite schwatzen. „Dass du mich nicht früher entdeckt hast? Lieber Himmel, deine Augen … Wo hast du nur deine Augen? Das ist nicht gut, für einen Maler, einen Künstler …“
„Was?“ knurrte ich gegen meinen Willen, weil ich mich herausgelockt fühlte.
„Nun eben“, wich der an meiner Seite aus, den ich schon nicht mehr der Fremde zu nennen gewillt bin.
Stattdessen musste ich mir anhören, dass er den Auftrag hätte, seine, das heißt meine, das heißt seine und meine Angelegenheiten zu ordnen, dass man nicht einfach mir nichts dir nichts aufgeben, im Stich lassen könne, was der Lösung harre, dass es, um allgemein zu sprechen, auf die richtige Mischung von Freiheit und Bindung ankäme und ungebundene Freiheit zu nichts, oder wie in seinem Falle, zu einem bösen Ende führe.
Aha! dachte ich, also spricht da doch jemand zu dir, der ein Ende erlebt, durchgemacht hat … Ich spürte erneut die Verwirrung, weil man sicher sein Ende gerade noch erleben kann, bevor es einem entgleitet, während meines Wissens zuverlässig noch niemand vom durchgestandenen Finale seiner irdischen Tage berichten konnte.
„Beinahe“, erklärte mir unbeirrt die Schimäre, „hätte ich keine Chance mehr bekommen. Wir hätten uns nicht sehen und sprechen dürfen.“
„Wem habe ich zu danken?“ fragte ich, halb mitspielend, zur anderen Hälfte entsetzt beobachtend.
Freilich die Hitze … Meine überreizten Nerven … Glücklicherweise befanden sich jetzt auf dem überschatteten Waldweg kaum Spaziergänger. Dennoch war ich besorgt, in Selbstgespräche verstrickt, beobachtet zu werden. Deshalb versuchte ich ganz besonders leise auszusprechen, was mich augenblicklich bewegte.
Ich sagte: „Es ist nicht gut, wenn die Toten auferstehen. Es bedeutet verdammt nichts Gutes … Bist du gekommen, mich zu mahnen oder zu holen?“ und musste mir, obwohl ich nur gemurmelt hatte, sagen lassen, dass ich unbesorgt sein könne, weil ich durch ihn nicht etwa zum Tode, sondern zum Leben geführt werden würde.
„Du wirst erst richtig aufleben“, wurde mir unter Deixelschem Lachen versprochen.
Aber so schnell ließ ich mich nicht beruhigen und forschte mein Gewissen aus. Hatte ich nicht Schuld auf mich geladen, zumindest indem ich damals alle Warnungen in den Wind schlug, ihm nicht glauben konnte, dass er, den ich mal meinen Freund, mal meinen Exfreund nannte, mit sich Schluss zu machen gedenke? Ich musste an meinen armen Vater denken, den ich geliebt und gefürchtet habe, der mir wegstarb, als ich noch ein halbes Kind war, der mir fehlte und den ich sehr betrauerte. Und mir fiel ein, dass ich irgendwann damit fertig geworden war und allein zurechtkam. Aber da träumte ich nachts manchmal, mein Vater sei zurückgekehrt. Und ich wachte auf, wie Kinder aus Albträumen aufwachen, um erleichtert mich zurechtzufinden und festzustellen, dass die Toten tot waren. Damals klammerte ich mich an den, der mir ein väterlicher Freund sein sollte, obwohl er bloß drei Jahre älter war. Aber dem väterlichen Freund schien die aufgenötigte Rolle nicht zu gefallen. Und so trat die erste Entfremdung zwischen uns ein, denen weitere im Wechsel mit zeitweiligen Annäherungen folgen sollten.
„Ich war enttäuscht von dir. Wir hatten uns entfremdet“, ließ ich meine lahmen Lippen murmelnd verkünden. „Und dann bist du doch freiwillig gestorben. – Du bist doch gestorben? Ich habe dich liegen sehen. Aufgedunsen und grün im Gesicht. Grünlich bis schwärzlich … Sogar den roten Streifen um den Hals, sogar an den erinnere ich mich deutlich. Das war keine Täuschung! Damals nicht. – Was ist es heute?“
Ich gebe zu, meine Stimme endete flehentlich; ich hoffte, klammerte mich gewissermaßen mit meiner Stimme an die Hoffnung, erlöst zu werden.
Da bekam ich aber nur zur Antwort: „Du sollst dich nicht wundern und sollst nicht grübeln, lieber Freund. Nimm die Dinge wie sie sind. Und wenn es dich beruhigt, was du für ein Strangulationsmerkmal halten wolltest – ist das.“
Mit flinken Fingern zog sich der, von dem ich noch immer nicht weiß, wie ich ihn benennen soll, seinen Krawattenknoten auf, öffnete das Hemd, so dass der Hals sichtbar wurde, von dem ich eben noch behauptete, er habe vor sieben Jahren am Strick gehangen. Ein Halskettchen aus Rotgold wurde sichtbar.
„Nein!“ rief ich. „Nein, nein, nein!“, wehrte ich mich, und mir fiel ein, ihm entgegen zu schleudern, ich wüsste doch genau, dass sein Grab nicht etwa bloß durch schwere Steine beschwert, verschlossen und verrammelt wäre, sondern, dass seine Witwe gründlicher habe verfahren lassen, mit dem, was von Joachim Deixel übrig geblieben war. Sei er nicht verbrannt worden? Liege seine Asche nicht auf dem Friedhof dicht an dicht bei den anderen Anonymen?
Aber auf meine Verzweiflung antwortete mir zuerst bloß Deixelsches Lachen, jenes charakteristische, aufreizende, das mir schon immer den Nerv tötete. Und dann schweifte der Lacher ab, ohne restlos ernsthaft zu werden, glaubte er mir einen Exkurs in Geschichte geben zu sollen. Von jenem Dshugaschwili war die Rede, der sich Stalin nannte und als Stalin weltberühmt, als Gründer des Stalinismus berüchtigt wurde. Ob man den mit Erfolg aus dem Mausoleum verbannt und eingeäschert habe? Wenn das eine Frage gewesen sein sollte, so blieb ich dem Frager die Antwort schuldig, war mir aber nun im klaren und felsenfest davon überzeugt, dass ich es, wenn nicht mit einer Materialisierung meiner, das heißt einer kranken Fantasie, tatsächlich, auferstanden oder nicht, mit Joachim Deixel zu tun hatte. Nur mein ehemaliger Freund Joachim konnte auf dieses Beispiel verfallen, nur ihm war zuzutrauen, dass er mir gegenüber zu diesem Argument griff. Und so gebe ich mich, einstweilen jedenfalls, geschlagen. Ich bringe die Dinge nicht durcheinander, wenn ich mir vornehme, nun nur von Joachim Deixel sprechen, selbst wenn es sich bloß um das Paradox einer inkarnierten Geisteinbildung handeln sollte. Irgendwie muss ich Ordnung in meinen Kopf kriegen. Dieser Entschluss, gefasst und festgemacht mit maßgeblicher Hilfe eines Beispiels, das, wie angedeutet, etwas von einer Vereinbarung hat, half mir, vermittelte mir genügend Einfühlungsvermögen, so dass ich mich freier bewegen konnte, wieder frei über meine Sprache verfügte.
„Zum Teufel endlich, was willst du?“ konnte ich meine Neugier nicht länger bezwingen.
Und er, scheinbar Mischung aus Schalk und gekränkter Leberwurst, fragte zurück: „Geht man so mit einem Freund um, den man länger nicht gesehen hat?“
Da hatte er auf seine Art recht, obwohl ich durchaus sparsamer mit diesem Begriff umging, gerade im Zusammenhang mit einem so zweifelhaften Freund wie Joachim Deixel. Ich hätte ihm auch passend antworten können, verkniff mir aber, dass schließlich er es war, der sich vor sieben Jahren aus dem Staub gemacht hatte, während ich ihm eben noch vorhielt, vor sieben Jahren zu Asche geworden zu sein.
Ganz ohne Vorhaltung kam ich auch jetzt nicht aus: „Eine Karte hättest du wenigstens schreiben können. Damit ich vorbereitet war.“
Aber da sah er mich von der Seite an, bemerkte, witzig zu sein, stünde mir wenig an, lenkte fair oder unfair, jedenfalls keineswegs geschickt, eher plump (auch das konnte Joachim Deixels Art sein!) das Gespräch auf seine, zumindest ehemalige Passion und meinen Beruf.
Er begann, sich einbeziehend, mich nicht ausschließend, mit der Feststellung: „Wir als Maler …“ und wollte wissen, was für Pläne mich derzeit bewegten, ob ich noch immer den Durchbruch nicht geschafft hätte und ob ich Hoffnung sähe oder mich von der Hoffnungslosigkeit unterkriegen lasse, so wie er, vor sieben Jahren.
Da ich weder gern von meinen Plänen sprach, inzwischen durch fehlende, zumindest mangelnde Anerkennung nicht bloß skeptisch, sondern wie viele Künstler, abergläubisch geworden war, noch eigentlich von seinen Plänen etwas wissen wollte, verstummte ich, ohne restlos verschwiegen zu bleiben. Das Abenteuer auf der Brücke hatte mich noch gefangen gehalten; ich hoffte es ausbeuten zu können, ohne dass ich mich gegenwärtig darüber ausließ. Aber wie früher, brauchte ich auch jetzt bloß meinem Freund ein Zipfelchen zu zeigen und gleich brannte er lichterloh, war er Feuer und Flamme, machte er meine zu seinen Gedanken, versuchte er meine Idee zu seinem Plan zu machen. Ich hatte es in der Vergangenheit nicht leicht mit ihm und seinen unzähligen Plänen, weil sie zumeist das blieben, was sie waren. So sehr sich mein dilettierender Freund auch begeisterte, in Einzelheiten verlor, oftmals glaubte, mich bis ins Kleinste einweihen zu müssen, so selten wurde wirklich etwas unter seiner Hand fertig. Das war sein Los als Künstler. Solches Verhalten korrespondierte mit seinem Schicksal als Lebenskünstler. Kein Wunder, dass mir auch das eine Warnung war. Tatsächlich fühlte ich mich seit längerem in einer Krise stecken, gab den Versuch nicht auf, aus der Klemme zu kommen, und wusste dennoch, dass ich meiner Begabung nicht genügend trauen konnte. Mangelnde Imagination und Intelligenz machten mir Kummer. Ich hatte Angst, als Schwindler entlarvt zu werden, denn was ich malte, kroch eher aus dem Bauch, konnte also weniger auf die Beteiligung meines Verstandes rechnen; zum Durchdenken fehlte mir der lange Atem, zur Verinnerlichung bereits die Geduld. Wie oft hatte ich ein Bild blind begonnen, irgendwo in einer der vier Ecken oder kühn in der Mitte, gequält oder bangen Herzens mich überraschen lassen, was sich aus blindem oder kühnem Griff entwickelte? Wie oft hatte ich meinen Kopf zusammennehmen müssen, um schließlich meine eigene Malerei zu deuten? Sicher, manchmal wusste ich schon, was ich wollte, aber war ich oder bin ich denn genügend begabt, um für mehr als ein akzeptabler Handwerker gelten zu können? Doch sollte ich mir von Joachim Deixel vorschreiben lassen, wie ich, wenn überhaupt, das Abenteuer auf und nahe der Brücke künstlerisch zu verarbeiten hätte? Ihm war nämlich eingefallen, dass ich jenen unaufmerksamen, unauffälligen, in seine Zeitung vertieften Spaziergänger zum Mittelpunkt machen sollte, der offenbar rings um sich nichts wahrnahm, demzufolge für ihn nur existierte, was in der Zeitung stand, was er aus der Presse bezog. Solche Deutung, eine solche Darstellung schien mir zu plump und zu sehr Erscheinung am Rande, so dass es mir nicht einfallen wollte, einen Mann, der, wie ich mich gut erinnere, noch dazu in eine Rennzeitung vertieft war, in einen Bildmittelpunkt zu rücken. Wir hörten in der Ferne die Wettbegeisterten Reiter und Pferde durch ihre Schreie antreiben, als ich ruhig und leidenschaftslos mit Joachim Deixel debattierte, da mir die Brücke eher Symbol für mein eigenes Leben schien. War mein Leben nicht brüchig geworden? so fragte ich weniger ihn als mich. Habe ich anderseits nicht geglaubt, nur noch Wege gehen zu können, die nicht über brüchige Brücken führen? vertiefte ich die Frage. Was geschieht aber, wenn von einer gebrochenen Brücke die Menschen ins Wasser fallen, mit mir? Werde ich versuchen, vom Ufer bloß zuzuschauen oder mich wegführen lassen? Was ist, wenn die schlimmen Tagträume Wirklichkeit werden? Ich weiß nicht, ob die Fragerei meinen ehemaligen, nun offenbar wiedergewonnen Freund von meiner Seite trieb. Irgendwo, vermutlich an einer Gabelung, habe ich ihn verloren. Sicher kann ich nicht von Verlust sprechen, jedenfalls nicht vom endgültigen, denn ich weiß, glaube zu wissen, dass er mir bevor er verschwand in die abschiednehmende Hand versprach, er werde mich wiedersehen, gelegentlich zum gemeinsamen Spaziergang abholen. Ganz wie früher. Aber bereits als ich dachte oder sagte oder zu sagen gedachte: Abholen musst du mich schon. Du musst mich aufsuchen … denn ich weiß ja nicht wo ich dich finden kann, da war Joachim Deixel verschwunden, hatte er sich aufgelöst oder was weiß ich wirklich …
II.
Man hat mir nach der Scheidung die große Wohnung gelassen. Es ist keine Atelierwohnung, aber ich habe Anspruch auf einen geeigneten Raum, den ich mir zum Atelier machte. Es ist kühler geworden, längere Regenzeit erfrischte, frischte auch das Grün in der Natur auf. Das Naturgrün lässt meine Herzschmerzen zeitweise vergessen. Ich habe eben doch die Empfindungen eines echten Malers, den Farbe erfreuen kann. Gesichte hatte ich seitdem nicht mehr. Allmählich glaube ich nun wieder an Einbildung, halte ich es für möglich, dass meine Fantasie mir Bilder vorgaukelte, die sie mir in Öl oder Tempera vorenthält. Ich bin also keineswegs beruhigt, sondern ertappe mich oftmals dabei, die weiße oder bereits nicht mehr so tadellose Leinwand anzustarren. Auch fühle ich meinen Blick zum Fenster gelenkt, wo ich, nahe der Staffelei, vor allem den blanken oder je nachdem wolkenangereicherten Himmel sehe, und ich würde mich nicht wundern, Joachim Deixel übers Dach kommen oder meinetwegen auch auf einen Besen vorbeifliegen zu sehen, sosehr provoziere ich das Verrückte. Ich will herausgerissen werden, und vielleicht denke ich deshalb so oft an meinen verstorbenen Freund.
Kinder, so sagt man, so sage ich, indem ich meiner Beobachtung vertraue, die man gemeinhin niedlich oder hübsch nennen kann, sind als Erwachsene weniger ansehnlich, und gar nicht so selten wird aus einem hässlichen Entlein ein schöner junger Schwan. Joachim Deixel soll als Kind hässlich gewesen sein. Sein Gesicht war grob, der kleine Mund schief, und als sein fuchsrotes Haar noch nicht wuchern durfte, waren die spitzen Ohren deutlich erkennbar. Das Kind blieb lange klein, gnomenhaft, weil die Beine sich ewig nicht strecken wollten. Das war früh sein Kummer, das bedrückte ihn später. Das machte ihn wendig, so als hätte er sich stets durch Gewandtheit bemerkbar machen müssen, um zuerst gegen die größeren Flegel, später gegen jene anzukommen, die etwas erreicht hatten. Über seinen Charakter muss ich länger nachdenken. Ich glaube aber, dass sich in dem Kerlchen Mut und Hinterlist paarten. Wenn es nicht imponierte, dass er mutig war, ließ er nicht selten seinen Kopf hinterlistig arbeiten, um sich Geltung zu verschaffen. Aber ich werde darauf zurückkommen müssen.
Unsere Bekanntschaft geht auf die Schulzeit zurück. Joachim war drei Klassen weiter, ohne dass er mir mein Zurückbleiben ankreidete. Dennoch wurde durch den zeitlichen Abstand unserer Jahre bereits unsere ungleiche Freundschaft begründet. Joachim war sicher ein besserer Schüler als ich, ohne eigentlich ein guter Schüler gewesen zu sein.
Ich suchte meine Minderwertigkeitsgefühle früh durch Nützlichkeit zu kompensieren. Das ist ein Charakterzug, der mir heute noch eignet. Es war mir durch Zufall gelungen, zu jenen bevorzugten Schülern zu gehören, die während der großen Pausen die Lehrmittel auszugeben und wieder entgegenzunehmen hatten. Ich durfte also Landkarten, ausgestopfte Vögel und Säuger, Präparate in Spiritus und anderes mehr denen anvertrauen, die sie in ihre Klassenräume brachten, durfte die Ausgabe in ein Buch eintragen, mir bestätigen lassen und sorgte auch mit dafür, dass wieder ausgestrichen wurde, was die Lehrmittelbeauftragten zurückbrachten. In einer solchen großen Pause, in der ich beschäftigt war und in meiner Tätigkeit aufging, stürzte Joachim Deixel schutzsuchend ins Lehrmittelzimmer, eine aufgebrachte Horde hinter sich herziehend, die dann freilich vor der Tür stoppte, kaum in den Raum drängte; in Respekt verharrte, vor dem angehäuften, materialisierten Wissen, von der Tür aus drohte, sich an dem Rotschopf zu vergreifen, sobald er das exterritoriale Gebiet verlasse. Mir ist unbekannt geblieben, wodurch Joachim Deixel seine Mitschüler zu reizen gewusst hatte. Ich war schwach, fühlte mich als Schwächling und ertappte meinen späteren Freund bei einer Schwäche. Das kettete mich an ihn, den Außenseiter. Ich war lange Zeit sein einziger Freund, und als das begann, was ich damals heißen Herzens unsere Freundschaft nannte, war ich knapp zwölf Jahre alt und Joachim das letzte Jahr in der Schule.
Er soll nur ein halb und halb gewolltes Kind gewesen sein. Der Vater hätte sich mit dem Gedanken an Nachwuchs rasch vertraut machen können, die Mutter, die damals noch eine werdende Mutter war, soll versucht haben, sich der Frucht zu entledigen. Das Früchtchen selbst hat mir gegenüber kolportiert, dass er durch ihre Stürze von der Kellertreppe auf den glitschigen Steinboden unschädlich gemacht werden sollte, dass er Resistenz gegen Gifte bewiesen hätte und dass sogar die aufgesuchte Kurpfuscherin sich geweigert habe, die Abortion vorzunehmen. Der bevorstehende Krieg, der später der zweite Weltkrieg genannt wurde, konnte es nicht sein, der Mathilde Deixel abhielt, das künftige Kind zu mögen, denn der Krieg, der nur für Weitblickende in Sicht war, ließ immerhin noch zwei Jahre nach der Geburt auf sich warten. Die vordem mageren Jahre hatten sich auch ein bisschen Fett und Speck angefressen, sie und die, denen die neue Zeit anvertraut war, versprachen nunmehr bloß noch fette Jahre, so dass ausgeschlossen werden kann, die Entscheidung, das Kind nicht zu wollen, wäre eine politische Entscheidung gewesen. Die Deixels waren eher unpolitisch. Mutter Deixel neigte zur Melancholie, war auch später, als ich sie kennen gelernt hatte, gern melancholischen Stimmungen unterworfen. Die Schwermut hatte viel mit Unzufriedenheit zu tun, und die Unzufriedenheit wurde durch eine konkrete Ungenügsamkeit gespeist. Der Deixel, den sie geheiratet hatte, war bei der Polizei, war einfacher Polizist. Bernhard Deixel hatte sich Chancen ausgerechnet, Mathilde Deixel unterstützte ihn eifrig beim Rechnen. Aber er bemühte sich vergeblich um einen Aufstieg. Es blieb beim hermetischen Innendienst, obwohl Gefängnisarbeit sich deprimierend auf Bernhard auswirkte. Dass seine Frau ihm deswegen zusetzte, vermehrte seine seelischen Wunden. Sein Schlaf soll jahrelang schreckhaft gewesen sein. Im untätigen Wachsein, mit dem er viel von seiner Freizeit verbrachte, ließ er die unterbeschäftigten Fingergelenke nervös knacken. Er war bemüht, seine Arbeit ordentlich zu versehen, so dass ihm weder von den Eingeschlossenen, noch von den Ausgeschlossenen Übles nachgeredet werden konnte. Ein Gefängnis war kein Konzentrationslager. Es wurde auch nicht verlangt, dass Bernhard Deixel der Partei angehörte. Erst nach dem Krieg sollte dann eine andere Partei heftig und erfolgreich um ihn werben. Wiederum eine Staatspartei. Es ist möglich, dass über Bernhards Arbeit die Nase gerümpft wurde; er selbst empfand sich als Schmutzarbeiter, bis er darauf kam, sich einen Untergrundarbeiter zu nennen. Aber das bedeutete nur für die Familie Deixel etwas. Sein Untertauchen sollte bewirken, dass er nicht zum Frontdienst eingezogen wurde. Diese Rechnung ging auf. Und so hielt sich Joachim Deixels Vater vorerst tapfer dort, wo ihn nun einmal das Schicksal hingestellt hatte. Seine Nachsicht, Gutmütigkeit und Verträglichkeit blieben weder der Anstaltsleitung, noch den Insassen verborgen, dennoch kam er damit einigermaßen gut zurecht, so dass man auch nach Kriegsende glaubte, nicht auf ihn verzichten zu können. Nun begann sein Aufstieg. Er war aufgestiegen, um unter Anleitung Nachwuchs anzuleiten. Junge Kommunisten. Also, zum Kommunismus bekehrte junge Menschen, die mit der Vergangenheit gebrochen oder nie etwas im Sinn gehabt hatten. So ein Aufstieg hatte Bernhard Deixel nicht vorgeschwebt. Da schlich er bald noch immer fingerknöchelknackend wie ein Gespenst umher, empfand wohl ein bisschen Freude beim Anblick seines hässlichen Kindes, das ihn neugierig auszusaugen versuchte: „Vater, erzähl Gefängnisgeschichten.“ Mit großen Augen und offenem Munde hörte der Junge dem gequälten Vater zu, denn jedes Mal ließ sich der alte Deixel herumkriegen von Betrügern, Dieben und sogar Mördern zu erzählen, klammerte auch die ‚Politischen’ nicht aus, obwohl er, was ihre ‚Verbrechen’ anbelangte, eher ratlos war. Da gab es welche, die der alten Ordnung gedient hatten, in ihr hochgekommen, als Nazis abgestempelt waren, und ‚ihren Paragraphen’ besaßen, und solche, die der neuen Ordnung nicht dienen wollten, sich ihr nicht fügten, und die hatten selbstverständlich auch ‚ihren Paragraphen’. Aber der Deixelsche Nachwuchs wollte, dass sein Erzeuger, die Betrüger, Diebe, Mörder und Politischen beobachtete, nicht nur offen, sondern durch den Spion, und seine Beobachtungen schilderte. Er war erschreckend unersättlich, etwas über Verbrecher zu erfahren, als wären Verbrecher keine oder grundsätzlich andere Menschen. Dem Vater soll es vor dem Elfjährigen gegraust haben, und dennoch war er zu schwach gewesen, ihm die Auskünfte auf pingelige Fragen zu verweigern. Bernhard Deixel lebte auf, als man ihn endlich bei der Polizei entließ, ihn fortschickte, weil der Nachwuchs, den er mit auszubilden geholfen hatte, ihn inzwischen entbehrlich gemacht hatte. Bernhard Deixel kam in einem großen Betrieb unter, einer Aluminiumgießerei, in der er für wenig Geld Hilfsarbeiten verrichtete. Mathilde verkraftete den Abstieg noch weniger als das Warten auf den Aufstieg. Während früher die vollbusig Stramme, ihre Melancholie vergessend oder besiegend, sich oft aufraffen konnte, Lieder, Arien mit hohem und hörenswertem Sopran zu singen, verkam nun ihre gute Stimme mehr und mehr zum Instrument für Misstöne und Gezeter. Später liebte Mathilde sich in ihrem Sohn, das heißt, sie liebte ihn abgöttisch. Sie verzieh dem zu Wut und Jähzorn, zu Quälerei und Schabernack neigenden kleinen Scheusal alles, verkrachte sich mit ihrem Mann, der weniger duldsam und doch von Natur aus mehr zum Dulder bestimmt, sich wehrte und zumeist dennoch unterlag. Ich male mir nicht aus, was der Kleine unternahm, allein um seine Eltern zu peinigen, mir genügt es zu wissen, dass er Vater Bernhard bereits quälte, wenn er unnachgiebig forderte: „Vater, erzähl Gefängnisgeschichten.“ Früh meldete sich Mathildes Mutterinstinkt. Von ihr selbst habe ich die Erzählung. Und wenn sie berichtete, war sie noch immer voller Mit und Schuldgefühl, als habe sie unvermindert Anlass, sich mitschuldig zu fühlen. Das Baby, der kleine Wurm, wäre der ungeschickten Mutter fast verhungert, weil die Harmlose sich einbildete, ein hungriger Säugling würde seinen Hunger durch Schreien verkünden. Die entsetzte Fürsorgerin unterstellte der Rabenmutter böse, heimtückische Absicht und schickte sich an, alles zu unternehmen, damit Mathilde das Kind weggenommen würde. Aber da fand die Arglose zu jenem Instinkt, der sie zur wahren Mutter machte und konnte durch eigene Schreie und Tränen überzeugen, so dass ihr Joachim gelassen wurde, auch wenn die Fürsorgerin nun täglich nach dem Jungen schaute. Später, inzwischen kugelrund genudelt durch Liebe und künstliche Babynahrung, soll Joachim beim Wickeln einmal vom Küchentisch gekullert sein. Mutter Mathildes Sopran hatte sich in eine Sirene verwandelt. Sie umklammerte das gefallene Kind, drückte das Herzenssöhnchen an ihren dicken Busen und wollte es lange nicht hergeben. Der besorgte Vater Bernhard war kopfschüttelnd, knöchelknackend mit langen Schritten auf und abgewandert, hatte durch Gehen seine Sorge zu bekämpfen versucht. Glücklicherweise schien nichts passiert.
Aber seit dieser Zeit soll Joachim Deixel das schiefe Lächeln haben, jenen Gesichtszug, in dem sich für die schuldbewusste Mathilde Misstrauen und Zweifel ausdrückten, denn sie hielt ihren Sohn, so heiß sie sich auch bemühte, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, für einen Sohn, der einer Mutterliebe misstraute, stets an ihr zweifelte. Zweimal soll das Kleinkind noch in Gefahr gewesen sein, in der es um sein Leben ging. Trotz Impfung, erkrankte der Dreijährige an der recht bösen epidemischen oder brandigen Mandel oder Rachenbräune, Diphtherie genannt. Sein pfeifender Atem war faul geworden, das Stimmchen fehlte, nur die weit aufgerissenen Augen klagten. Die verzweifelte Mutter konnte den Kampf des Kleinen nicht mit ansehen, stahl das Kind aus ärztlicher Obhut, brachte es zu einer wunderlichen Alten, die in dem Ruf stand, Wunder vollbringen zu können, weil sie es angeblich mit allerlei guten oder bösen Geistern trieb. Ob dabei vom Teufel die Rede war, ist mir nicht bekannt, denn nicht alles was mir mein Freund Joachim anvertraute, konnte ich glauben, und sicher schmückte der Sohn aus, was ihm die redselige Mutter später von seiner Wunderheilung anvertraute. Der Arzt habe freilich die rasche Wendung zum Guten mit verspätet wirksam gewordenem Impfschutz erklärt. Seinen Beistand riefen die Deixels gar nicht erst an, da sie noch immer ärztlicher Kunst wenig Vertrauen schenkten, als der Fünfjährige, nervös herumtollend auf seinen kurzen Beinen, in ein Auto gerannt war, nicht nur bewusstlos, sondern bereits tot schien, wie der einfältige Nachbar schreiend verkündete, als er das Joachimchen auf starken Armen hereintrug, vorbei an den sprachlosen Eltern aufs Sofa bettete. Statt des Arztes wurde also gleich das alte Weib geholt, das seinen Hokuspokus trieb, Kräuter im Zimmer verbrannte, dem Scheintoten den Qualm unter die Nase trieb, Sprüche oder zumindest Worte, die sich wie Sprüche anhörten, ins Ohr flüsterte, bis das Kind schließlich aufwachte und sich sogar um ein Lächeln bemühte, das freilich, wie jedes Lächeln von ihm, schief ausfiel. Gottlob, war nichts von inneren Verletzungen festzustellen, sosehr Vater Deixel, der sich etwas auf erste Hilfe verstand, tastete, des Verunglückten Gliedmaßen bewegte und an seinem Achimchen horchte. Wiederum schien Wunderbares sich vollzogen zu haben. Dennoch versagten später die Wunder an der wunderlichen Alten. Wie eine Hexe war sie verbrannt worden. Ihr Hokuspokus hatte sie nicht vor dem Lager bewahrt, in das sie als Volksschädling kam. Zu geschwächt, um durch fleißige Arbeit dort wieder gut zu machen, holte sie Tod oder Teufel, bevor ihr Körper wahrscheinlich im Gasofen landete. Den Deixels waren die Umstände ihres plötzlichen Verschwindens nicht einerlei, zumal gemunkelt wurde, der gutmütige Vater Bernhard sei an der Sache nicht gänzlich unschuldig. Aber warum hätten die Deixels so undankbar sein sollen, die hilfsbereite Alte, die ihrem Söhnchen zweimal das Leben zurückgab, zu verraten? Hatten sie Angst um ihre eigene Haut? Waren sie nicht bibelfest genug, so dass ihnen entfallen war, selbst Christus hat sich nicht retten können, obwohl er doch aufgefordert worden war: „Bist du Gottes Sohn so hilf dir selbst“? Oder waren die Deixels so gläubig gewesen, dass sie fest daran glaubten, auch in bewegter Zeit, wie beispielsweise anno ’42, würde schon nichts Unrechtes geschehen? Jedenfalls trug Vater Deixel schwer an den heimlichen Vorwürfen und Anschuldigungen, soll sogar das Söhnchen eingeweiht haben, indem er dem nun fast Siebenjährigen von seinen Sorgen aufbürdete und ihm seine Unschuld beteuerte. Aber das ist schon wieder die Version meines ehemaligen Freundes, und ich glaube ihm vor allem, dass Joachim der armen, alten Frau, die sein Leben gerettet hatte oder auch bloß in dem stillen Ruf stand, es gerettet zu haben, keine Träne nachweinte.
Das ist wohl alles, was ich über den kleinen Joachim weiß. Mein Wissen ist lückenhaft, und mir ist auch klar, dass mir nur bekannt gemacht wurde, was Joachim Deixel wichtig schien, um interessant zu erscheinen. Bedenke ich meine Kenntnisse, so wird mir bewusst, dass Mystisches im Spiel ist. Sicher will ich vor allem das sehen, um diesem albernen Erlebnis auf die Spur zu kommen.
Aber nun höre ich Klingeln. Ich höre manchmal Klingeln, und ich weiß, das ist nicht die Glocke hinter der Wohnungstür oder das Telefon. Ich habe herausgefunden, dass meine Nerven oder das Ohr sich selbst um diesen anhaltenden Ton bemühen, wahrscheinlich um mir eine Freude zu machen, denn bei mir läutet kaum jemand. Bis in den fünften Stock kommt nicht einmal ein Mitbewohner, um sich etwas auszuborgen, höchstens manchmal die Hausmeisterin, wahrscheinlich um nachzusehen, ob ich noch lebe, ob es mich noch gibt, ob ich noch allein lebe oder ob es jemanden gibt, der meine Einsamkeit und die große Wohnung mit mir teilt.
III.
Diesmal wusste ich gleich Bescheid. Diesmal wusste ich, dass meine Sinne mich nicht in freundlicher Absicht trügen. Ich habe bereits jetzt am zeitigen Nachmittag zwei Gläser Rotwein zu mir genommen. Das machte mich locker, lässt mich entspannt zur Tür gehen. Er steht draußen. Er lächelt. Das schiefe Lächeln grinst er, das keinesfalls abstoßend wirkt, und um dessen Wirkung er sich wohl bewusst ist von jeher. Ich halte mich an der Tür fest, weil es sonst nichts gibt, wo ich Halt fände. Der Rotwein kann es doch nicht sein!
„Na, es wird Zeit“, lässt er mir keinen Moment, mich noch weiter zu wundern, und spottet: „Konntest dich wohl wieder mal von deiner Arbeit nicht losreißen? – Immer noch so strebsam? Ich dachte schon, ich müsste andere Wege finden, um zu dir zu kommen.“
Er tritt ein, fühlt sich durch mein hartnäckiges AnderTürVerharren nicht behindert am Weitergehen, mustert die kahlen Wände des Korridors, die deshalb schmucklos sind, weil ich mich nicht entschließen kann, aus meinem Korridor eine Galerie zu machen, Bilder von fremder Hand oder gar von mir gemalte, auszustellen. Ich will nicht zufällige Besucher durch eine solche Präsentation daran erinnern, dass ich Maler bin und möchte mich selbst nicht beständig mahnen und herausfordern lassen. Wovon ich mir Beruhigung verspreche und was mich beunruhigen soll, das hängt in meinem Atelier. Hier bin ich stets Maler oder Zeichner, Grafiker oder Holzschneider, auch wenn meine Hand beurlaubt ist.
„Also, doch. Immer noch ehrgeizig“, glaubt mein Besucher feststellen zu sollen, nachdem er sich umgesehen hat, Skizzen und Bilder flüchtig betrachtete, seine Betrachtung mit einem schiefen Lächeln abschloss, dem ich zusätzlich das Adjektiv grimmig nicht verweigern würde. Rücklings setzt er sich auf einen Stuhl. In seinem Blick eine Stadtlandschaft: grautonige Häuser mit vielen Fenstern. Ich weiß nicht, ob er sieht, worauf seine Augen ruhen oder ob er ihnen bloß einen ruhigen Punkt gönnt, aber mit einem Male erkenne ich die Mängel meines Bildes deutlicher. Ich sehe die Unentschiedenheit, verstehe, dass ich, zerrissen wie ich bin, mich nicht zu entscheiden vermocht hatte, ob ich den Verfall dokumentieren oder in den alten, zerfallenden Häusern Atmosphäre suchen sollte. Da ich wie jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, dass Kunst zwar vieldeutig sein kann, zu sein hat, sich aber besser eindeutiger Mittel bedient, erkenne ich in dem, was ich vor mir sehe, was ich mir möglicherweise zusammen mit meinem Besucher ansehe, schrecklichen Eklektizismus. Das Urteil, die stumme Selbstkritik, frisst hart an mir.
Um mich abzulenken, um ihm Ablenkung zu bieten, frage ich höflich: „Was darf ich anbieten? Kaffee, Tee oder Rotwein? Möchtest du ein Glas Rotwein?“
Aber er antwortet: „Das ist nicht relevant.“
Ich weiß mit einer solchen Antwort nicht viel anzufangen, zumal ich mich gut erinnere, dass meinem Freund Joachim, als wir noch freundschaftlich miteinander verkehrten, die Entscheidung problemlos geworden wäre, vermute geistige Abwesenheit oder eine mir nicht unbekannte Arroganz.
„Also, Rotwein“, entscheide ich für ihn und hole die angebrochene Flasche und zwei frische Gläser.
Ich schenke ein, möchte ihm sein Glas in die Hand geben, aber er möchte mich offenbar missverstehen und mir nicht sofort zuprosten, sondern bedeutet mir, sein Glas abzustellen. Sicher ist zu wichtig, was er mir zu sagen hat.
„Ich habe vor, meine Bilder in Augenschein zu nehmen“, spannt er mich nicht lange auf die Folter und quält mich dennoch, als er fortfährt: „Zusammen mit dir, möchte ich vor allem mein letztes Bild hervorkramen. Du weißt doch, jenes auf das ich alle Hoffnungen setzte …“
Ich nicke, denn ich weiß nur zu gut. Und wenn ich ihn für einen Maler halten könnte, einen aus wirklicher Berufung, würde ich annehmen, dass Joachim Deixel zerbrochen ist auch an diesem, seinem letzten Bild. Ich kenne Entwürfe, Skizzen, bereits kolorierte Details. Er hatte sich daran gemacht, Schlüsselszenen aus seinem Leben auf respektabler Leinwand von etwa zwei mal drei Meter zu vereinen, Symbolik nicht scheuend, die Schlüssellochperspektive bevorzugend, die bekanntlich ihren Ausschnitt klein genug wählt, um Mehr oder Missdeutungen zuzulassen, dennoch darauf vertrauend, dass das unfertige, ungerahmte Bild dadurch seine Einfassung erhält, dass alles, was verschleiert, verklärt und rätselhaft sich darstellt, inmitten eines riesigen Gefängnishofes spielt. So weit ich, was ausgeführt und angedeutet worden war, richtig erinnere, war den Eltern Deixels ein Plätzchen zugedacht, Vater Bernhard sogar ein zentrales, etwas jämmerlich verloren, inmitten des kalten Gefängnishofes, während Mutter Mathilde peripher eine Gefängnistür aufmacht oder zumacht, denn ob es sich um eineÖffnung oder Schließung handelt, bleibt dem Betrachter verborgen, und Joachim wusste ein Geheimnis daraus zu machen, das er möglicherweise nicht einmal sich selbst gelüftet hat. Vor dem Tor, das allegorisch ausgemalt, ohne schon Malerei in Farbe zu sein, ebenso ein Höllentor darstellen könnte, versammelten sich Frauen, die, so vermutete ich, nicht nur ihre Vorbilder in den Frauen hatten, die in Joachim Deixels Leben eine größere oder kleinere Rolle zu spielen wussten. Keine war auf dem Bild mit leeren Händen gekommen, jede, der etwa fünf weiblichen Gestalten trug an einem Symbol. Dass um den Hof, in ihn hineinspielend, gewissermaßen apokalyptische Szenen aufgebaut waren, in denen weder Gemetzel, noch Getümmel, noch die bekannten Reiter fehlen, erwähne ich nur am Rande. Zu viel Anleihen schienen mir da gemacht, zu wenig schien mir bewusstes Zitat zu sein, um Halbfertiges als etwas Vollkommenes ausgeben zu können. Der Maler hatte sich ebenfalls verewigt: winzig schaute er aus einem vergitterten Fenster, dennoch gut erkennbar am feuerroten Haar und an den spitzen Ohren, sicher beides übertrieben, so wie das verzerrte Gesicht. Damals suchte ich mich auf dem Bild vergebens, damals konnte ich mir nicht verkneifen, nach meinem Platz auf dem Bild zu fragen. Und ich weiß wie heute, dass ich meine Frage in einen Scherz kleidete. Scherzhaft wurde mir geantwortet. Jawohl, er müsse noch gründlich darüber nachdenken, wo zum Teufel er mich und in welcher Gestalt placieren solle. Für sein Nachdenken nahm er sich Zeit. Ich fühlte mich vergessen und suchte erfolgreich ins Vergessen abzudrängen, was mich kränkte. Jetzt aber steht mir vor Augen, was ich vor sieben Jahren zu sehen bekam, was mir durch Pläne bekannt wurde und siebenjährigen Schlaf hielt, und ich bin unsicher, ob ich durch Augenschein meinem inneren Blick nachhelfen soll. Ich weiß, das schändliche Gefühl, ich würde kneifen, wenn ich mich verweigerte, wird mich nicht loslassen, aber jetzt ist auch etwas von der Kränkung wieder auferstanden. Also wehre ich erneut ab.
„Könntest du nicht erst mal mit dir ins Reine kommen, bevor du mich mit hineinziehst?“
Aber da hat der, der einmal mein Freund gewesen ist, von dem ich nicht weiß, was ich jetzt von ihm zu halten habe, schnell die rätselhafte Antwort zur Hand: „Mit dir möchte ich ins Reine kommen.“
Versonnen denke ich dem Spruch nach, und dennoch entgeht meinem fixierten Blick nicht, dass sein Weinglas, indem er es eher spielerisch mit der Hand berührt, wie von plötzlichem Lichteinfall, rot zu glühen scheint. Es ist als habe sich Rotwein in Rubin verwandelt und der Rubin in Feuer. Ich weiß nicht, ob ich meinen Blick noch immer versonnen nennen darf. Ich würde mich eher als fasziniert bezeichnen. Es sind die Farbspiele, die der augenscheinlich in Flammen sich verzehrende Wein im Glas zaubert und deren Faszination ich mich unterwerfe. Möglicherweise träume ich nur. Schon vorstellbar, dass ich mir auch seine Erklärung herbei träume: Es wäre ihre Art, zu genießen. Ich stürze meinen Wein hinunter. Leicht verwirrt, verkneife ich mir doch den Spott, obihm, dem Ärmsten, denn überhaupt etwas geblieben sei, von den Genüssen des Lebens, und kann mich selbst nicht dem Vergnügen entziehen, das ein derart brennendes Weinglas mir bietet.
„Man sollte Maler sein“, versuche ich dennoch einen Scherz und reiche ihm ungewollt damit einen kleinen Finger, denn nun schmeichelt er mir, fühle ich mich durch ihn geschmeichelt.
Es war als habe er mich auf meinen Gedankengängen ertappt, als sei der Beobachter genau im Bilde, denn nun schlägt er Mitbestimmung vor; ich sollte selbst mitbestimmen, welchen Platz auf seinem noch unvollständigen Gemälde ich einnehmen könnte. Darüber hinaus wäre zu beraten, ob ich in halber oder ganzer Figur oder vielleicht sogar verdeckt, versteckt, ins Abseits verbannt, seinen Entwurf bereichern könnte. Mein Zögern hilft mir nicht. Auch das Geständnis, mich fast sieben Jahre nicht um seine Frau gekümmert zu haben, bringt meinen Gast nicht von seinem Entschluss ab, mich sofort dorthin mitzunehmen, wo sich seine Bilder befinden. Im Übrigen ist er gut informiert über das, was ich als den künstlerischen Nachlass Joachim Deixels bezeichnen würde. Er hält mir vor, ohne dass ich darin einen Vorwurf erblicken kann, einige von seinen Bildern und Bildchen verkauft zu haben, und weiß (woher auch immer), ich hatte mich um den Verkauf bemüht, um seiner Gattin zu Geld zu verhelfen. Also hätte ich mich doch gekümmert und einiges getan. Da ich es nicht auf mir sitzen lassen kann, möglicherweise für einen guten Kerl gehalten zu werden, denn sein Lob spricht dafür, dass er mich für selbstlos hält, murmle ich von Schuld, an der auch ich mich beteiligt hätte, von Schuldgefühlen, doch darauf weiß er mir nur wieder mit einem Spruch zu antworten.
„Wer prüft schon den Antrieb bei guten Taten? Die Himmel wären leergefegt.“
Psychologische Erkenntnis? Erkenntnis eines Jemands, der sich auch mit Seelenkunde befasst hat, wie er sich mit vielem befasste, oder Weisheit am eigenen Leib erfahren? Ich unterlasse es, ihn danach zu fragen, frage nicht danach, so brennend es mich interessiert, ob er sich in Himmel oder Hölle einigermaßen, vielleicht gleichermaßen auskennt, lasse es also nicht darauf ankommen, dass er mir von himmlischen Erfahrungen oder höllischen Erkenntnissen etwas berichtet, sondern zeige ihm meine Aufbruchsstimmung an.
„In Gottes Namen denn“, suche ich mich quasi rückzuversichern; doch so sehr ich auch beobachten will, er sich meiner Beobachtung ausliefert, ich kann keine besondere Regung an ihm entdecken.
Wir brechen auf. Wir haben eine Busfahrt vor uns. Ich vermeide es unterwegs, zu sprechen, kann nicht verhindern, dass sich mein wiedergewonnener Freund an meiner Seite nicht sprachlos verhält. Davon ist seine Rede, dass einer mit fünfzig oder um die fünfzig herum sich noch einmal einen ordentlichen Ruck geben, zum Aufbruch bereit sein, notfalls Brücken hinter sich abbrechen sollte. In diesem Alter brauchte er das Risiko nicht mehr zu verachten, will mein Begleiter mich belehren, denn nun sei er alt genug, um gewissermaßen ein Leben schon hinter sich gebracht zu haben, wobei er mit etwas Glück bereits auf die übernächste Generation schauen, der nächsten Generation das eigentliche Feld überlassen könne, um sich dem Außergewöhnlichen, dem Besonderen zu widmen, um also dem künftigen Leben unbesorgter etwas abzujagen. Während ich überredet werden soll und mich dennoch stur gebe, muss ich zwangsläufig an Joachim Deixel denken, insbesondere an sein Ende, seinen Abschied aus der Welt, denn als er sich abschiedslos und dennoch nicht ohne Vorwarnung aufmachte, sein Leben zu beenden, da war er ja in dem Alter, bei großzügiger Rechnung, von dem fortwährend die Rede ist. Mir wird heiß beim Gedanken, er könnte wollen, sein Beispiel mache bei mir Schule, und ich hätte nicht die Nerven zu widerstehen. Aber ohne dass ich den Mund aufmachen muss, versteht er sich auch diesmal aufs Gedankenlesen und versichert mir hoch und heilig, es mit meiner Erneuerung ernst zu meinen. Ich lasse mich beruhigen und werde dennoch leicht aufgeregt, als wir beide die Straße betreten, in der Joachim Deixel vor sieben Jahren noch zu Hause war, in der seine Witwe oder verlassene Ehefrau noch wohnt oder wohnen könnte. Ich versuche dabei vergeblich mich durch Veränderungen ablenken zu lassen. Vielleicht hat sich kaum etwas verändert; Häuser altern gewöhnlich weniger schnell als Menschen, das ist ein Vorzug ihrer steinernen Maske. Aber ich erschrecke, als Frau Johanna öffnet, nachdem ich vergeblich darauf wartete, dass er die Tür aufschließt. Die Frau, die ich nie meine Freundin nannte, mit der ich stets per Sie verkehrte, bei der es mir niemals in den Sinn kam, einen anderen Verkehr zu wünschen, als den zwischen zufällig miteinander bekannt Gewordenen, die in ihrer Bekanntschaft keine besondere oder pikante Note finden können, diese Frau steht vor mir hagerer, magerer als ich sie in Erinnerung habe. Außerdem ist an ihr nicht vorbeigegangen, was an uns allen nicht vorbeizieht, ohne uns seine Kerben einzumeißeln. Aber ich werde freundlich empfangen. Das macht es mir leichter.
„Ist das eine Überraschung“, sagt sie, die Überraschungssekunde auskostend, bevor sie mir einladend weit die Tür öffnet.
Im langen Korridor schnuppere ich; meine Nase ist ein noch besseres Erinnerungsorgan als mein geübtes Auge. Die Zeit scheint hier stehengeblieben. Immer noch hängt Zigarettenrauch dünn in der Luft, leichter Geruch abgestandenen Rauches liegt über allem. Die Bastlampe spendet ihr erbärmliches Licht, das ein Betrachten der kleinen Ölbildchen am Ende des Ganges seit eh und je erschwerte. Sie hätten die geheimnisvolle Beleuchtung nicht nötig. Es sind Landschaften von Joachim Deixels Hand, kunstgewerblich gefertigt, mit winzigen, aber wohl auch glücklichen und fröhlichen Menschen darinnen. Jetzt erinnere ich mich meines Begleiters, dem eigentlich ich Begleiter bin, und mir fällt auf, dass sich die beiden, Joachim und Johanna, wie Luft behandeln, dass sie einander nicht zu erkennen scheinen und auch keine Anstalten machen, das ändern zu wollen. Ich weiß nicht, ob ich vermitteln soll. Mir fällt aber rechtzeitig ein, es ist nicht gut, sich in Ehegeschichten zu mischen, trotzdem werde ich den Verdacht nicht los, dass sie ihn weniger als Luftikus behandelt, also mit Missachtung, wie er es ihrer Meinung manches Mal verdiente, sondern ihn tatsächlich nicht bemerkt.
Ich sollte mich selber interviewen, dennoch frage ich sie: „Es geht Ihnen doch gut?“
„Mir geht es gut“, lässt sie mich wissen und verrät noch mehr: „Seitdem Joachim nicht mehr da ist, geht es mir viel besser. Vor allem – ich bin schuldenfrei. Mit 500 Mark mache ich keine großen Sprünge, aber ich komme zurecht.“
Sie sieht mich an, spöttisch den Mund gespitzt, als erwarte sie meinen Kommentar, und ich, der ich diese Aussage kommentarlos hinzunehmen gewillt bin, sehe mich hilflos um. Aber mir wird kein Beistand zuteil, denn der, den das alles eigentlich angehen müsste, zeigt sich unbeeindruckt, steht vorm Spiegel und bürstet sein rotes Haar. So vorm Spiegel stehend, das rote Haar bürstend, ist mir mein Freund Joachim in guter Erinnerung geblieben, denn so war stets sein Abschied eingeleitet worden, wenn wir uns zum gemeinsamen Spaziergang aufmachten und Frau Hanna es nicht lassen konnte, vor unserem Weggang zu sticheln, Spott zu provozieren, so daß beide sich aufführten, wie sich Eheleute am besten nicht vor Dritten geben sollten.
„Komm zur Sache“, sagt Joachim gegen sein Spiegelbild, von Kamm und Bürste nicht lassend, und ich weiß, dass ich gemeint bin.
Im Moment bekommt er auch Unterstützung von Frau Johanna, indem sie vermutet: „Sie sind doch nicht gekommen, sich nach meinem Befinden zu erkundigen?“ .
„Das stimmt wohl“, stelle ich fest, und da ich zögere, wird mir souffliert: „Ich bin gekommen, weil ich mir noch mal seine Bilder ansehen will. Besonders das letzte, große, unvollendete.“
Gehorsam spreche ich nach und habe nicht einmal den Ehrgeiz, die Diktion zu verändern. Danach hätte ich sicher zu eigener Sprache gefunden, aber Frau Johanna ist ohne Souffleur in Fahrt gekommen. Sie erinnert mich daran, dass von ihres Mannes künstlerischer Hand sich in ihrem Besitz nur noch einiges Wenige befände, Unverkäufliches und einige Erinnerungsstücke, die ihren Platz im Korridor und im Wohnzimmer hätten.
„Ach ja und das große Bild, der Schinken“, sagt sie, wobei ihr Gesichtsausdruck unterstreicht, was sie von Joachim Deixels letztem Versuch hält.
Mein rascher Blick forscht vergeblich, ob ihn das kränkt. Noch immer nehmen die Ehepartner offensichtlich nicht voneinander Notiz. Joachim geht uns beiden voran ins Wohnzimmer. Ich werde aufgefordert, zu folgen. Aber da ich mich nicht entschließen kann, unhöflich zu sein und Frau Johanna stehen zu lassen, muss ich schon warten, bis sie mich weiter bittet. Damit lässt sie sich Zeit. Erst einmal schwelgt sie in Erinnerungen und Klagen. Sie erinnert sich und klagt ihn an, verrät mir, was ich schon weiß, dass sie es schwer mit ihrem Gatten hatte, ihn verlassen, sich scheiden lassen wollte, weil sie es satt hatte, an seine Pläne zu glauben, seine Sorglosigkeit und die Schulden hasste, so nicht mehr leben konnte.
„Und dann“, bekennt sie mit siebenjähriger Enttäuschung, „anstatt um unsere Ehe zu kämpfen, verlässt er mich …“
Sie schweigt. Ich schweige und sinne dem Nachhall hinterher, der mir Verwundern und Entrüstung ausdrückt. Dann entschließt sich Frau Johanna mit mir ins Wohnzimmer zu gehen. Hier erwischen wir Joachim beim Schnüffeln oder Stöbern, ohne dass ihn die Hausfrau deswegen zur Rede stellt. Aber mir entgeht nicht, wie er, scheinbar beiläufig, Wohnzimmerschranktüren öffnet, in Schubkästen schaut, Ecken inspiziert, tatsächlich wie einer der fremd ist oder länger in der Fremde war.
Da mich seine Aktivitäten genieren, während mich doch seine Neugier andererseits beruhigt, weil sie etwas Menschliches hat, schlage ich vor: „Lassen Sie uns das Bild angucken.“
Aber da zögert Frau Johanna wieder, und ich spüre schon ihre Abneigung, mir das unfertige Bild zu zeigen, weil sie das unvollkommene Gemälde nicht mag, bevor sie sich darüber auslässt. Das Düstere stoße sie ab und das Fragmentarische. Ersteres könne sie, den Maler, ihren Mann im Auge, nicht recht nachvollziehen, letzteres nur zu gut. Das eine passe also zu ihm, das andere sei nicht er. Auch deshalb habe sie das Bild verbannt.
„Wir müssten nach oben gehen“, schlägt sie schließlich vor.
Nun da ich weiß, wohin wir gehen müssen, erschrecke ich. Oben befand sich meines Freundes kleines Atelier. Oben, das ist ein Stockwerk höher, ist ausgebauter Dachboden. Aber dort oben soll Joachim Deixel auch einen Schlussstrich unter sein Leben gezogen haben, wobei ich seit jüngstem im Zweifel bin, ob in dem Zusammenhang das Substantiv ‚Leben’ ein Anhängsel ‚bisheriges’ verträgt, so dass ich wirklich nicht weiß, ob dort oben etwas Endgültiges geschehen ist, indem er sich stranguliert hatte. Zwar wurde mir damals manches geschildert, doch gesehen habe ich nichts. Neben einem Stuhl will ihn Frau Johanna gefunden haben. Den Strick um den Hals. Das obere Ende des Strickes habe trotz einiger Last zuverlässig am Dachbalken festgehalten. Neben ihm, in erreichbarer Nähe auf dem Fußboden, eine Schnapsflasche, nach der zu angeln es sich kaum mehr lohnte, weil sie höchstens noch einen Schluck enthielt. Man sagte, Frau Johanna sagte, indem sie sich den Polizeibericht zueigen machte, Joachim Deixel hätte sich des Strickes entledigen können, wenn ihn der Alkohol nicht gehindert hätte. Strang und Hochprozentiger hatten ihn umgebracht. Nur im Verein konnte geschehen, was sich ereignet hatte. Aber passierte es tatsächlich? Hat er sich vergiftet und erwürgt? Oder hat er sich gerettet? Verdankt er Rettung sein Fortleben? Da ich nichts gesehen habe, mich auch gescheut hatte, den Tatort zu besichtigen, kann ich getrost sagen, ich habe meine Zweifel. Wäre es nicht auch möglich gewesen, dass das was ich sah, nämlich in der Aufbahrungshalle, Sinnestäuschung oder sogar Irreführung war? Den Zweifel liebend, an ihm leidend, gebe ich mir dennoch einen Ruck.
„Gehen wir“, fordere ich sie und mich auf, indem ich ihr nicht einmal Zeit lasse, die unvermeidliche Zigarette zu Ende zu bringen.
„Na schön“, sagt Frau Johanna, und es hört sich wie eine Warnung an.
Joachim Deixel oder wer oder was sich mir auch immer zum Schatten anbot, wem oder was ich Begleiter wurde, die Gestalt folgt uns.
Hier oben scheint alles unverrückt und museal an seinem Platze. Licht flutet durch die großen schrägen Fenster. Bei unserem Eintritt fühlt Staub sich aufgefordert in der sonnenlichtdurchfluteten Luft zu tanzen. Staub liegt auf allen Gegenständen wie ein dünner Schleier. Die Hausfrau weigert sich hier oben Hausfrau zu sein und erklärt, nichts anrühren zu wollen, solange der Raum nicht benötigt werde. Vielleicht könne sie mal in die Lage kommen, vermieten zu müssen. Vielleicht begeistere sich ein solider Kunststudent für die großen Dachfenster, um überdacht und geborgen, auf Sonnenschein nicht verzichten müssend, sich seiner Kunst widmen zu können. Nach dieser Vision bekommt Frau Johanna einen Hustenreiz, folgt ihm hustend und hüstelnd und erklärt, sie halte es hier oben nicht lange aus. Es müsse in den Balken stecken, vom Dach herkommen oder einfach in der Luft liegen. Da habe ich das Gefühl angesteckt zu werden. Schon glaube ich Kratzen im Hals zu verspüren, aber mein besorgter Freund bedeutet mir durch Mienenspiel, zu bleiben, mich nicht durch trockene Luft in die Flucht schlagen zu lassen. Schon will sie mich allein lassen, schon rät mir Frau Johanna, mich umzusehen so lange ich will, da erinnere ich sie.
„Wo ist das Bild? Wo haben Sie es hingesteckt? Wo hat er es möglicherweise versteckt?“
Nicht, dass ich meinem Begleiter misstraue, aber ich muss darauf gefasst sein, nur die Witwe, die ich auch gern Strohwitwe nennen würde, kennt das Versteck. Diesen Liebesdienst leistet sie mir noch; sie steht auf, zieht hinter einem Regal mit längst eingetrockneten Farben, Flaschen, die ihren Inhalt, Verdünner, bewahren konnten und Büchern, die sieben Jahre vergeblich warteten, angeblättert zu werden, das Bild oder das was ein Bild werden sollte hervor. Ich eile ihr zu Hilfe. Gemeinsam heben wir die gespannte und teilweise bemalte, teilweise mit Entwürfen bedeckte Leinwand auf eine Staffelei.
Dann gibt Frau Johanna auf und erklärt zwischen zwei Hustenstößen: „Machen Sie was Sie wollen. Mich finden sie unten.“
Mit dem Schlüssel in der Hand entdecke ich mich allein wieder. Allein mit ihm. Joachim Deixel sitzt auf einem Stuhl, offenbar in sein Bild vertieft. Da ich unsicher bin, ob ich mich zusammen mit einem Gespenst in einem Raum befinde, in dem zuletzt ein Selbstmörder gehaust und geschafft haben könnte, die unheimliche Erscheinung nichts zur Erklärung oder Aufklärung beitrug, überfällt mich Wut.
„Zu Hause hast du wohl nichts zu bestellen? Hier versagen deine albernen Künste?“ schreie ich wütend.
Da gibt er sich bescheiden, antwortet mit sanftem Augenaufschlag: „Ich kann ohnehin nicht viel. – Vor allem kann ich Versäumtes nicht nachholen. Das können wir alle nicht … deshalb: Gebraucht der Zeit, sie geht so schnell von hinnen.“
Meine Erregung auskostend, mich an meinem Zorn labend, werfe ich ihm vor, zu rätselhaft und zu geschwollen zu reden und fordere, endlich Farbe zu bekennen, wobei ich es nicht lassen kann, ihn zu fragen, ob er verdammt und zugenäht ein Zombie sei. Ich fürchte, ich kann noch so sehr aus mir herausgehen, er verrät mir nichts, lässt auch die Frage unbeantwortet, ob er ein Zombie ist, und möchte offenbar, dass ich weiterhin meine Vorstellungskraft bemühe. Stattdessen betrachtet er mit verliebten Augen das Werk, an dem er vor sieben Jahren den letzten Strich gemacht hatte, ohne es beendet zu haben. Sein Blick zwingt schließlich meinen Blick, ihm zu folgen. Das Bild war in meinem Gedächtnis gut aufgehoben, wie ich nun vergleichsweise am Original feststelle. Sicher muss ich auch mein Urteil nicht revidieren, wobei ich unsicher bin, ob es gerechtfertigt ist, von Stückwerk zu sprechen, da doch alle Konturen sichtbar scheinen. Doch noch nach sieben Jahren kann ich die Mängel in der Komposition und die Anleihen bei bekannten und rechtschaffenen Malern erkennen, wobei ich nur die Namen Dix und Grosz nenne. Über dem Bild, so weit es Bild geworden ist, liegt ein Grauton, atmosphärisches Grau, nicht zu verwechseln mit düsterem Grau. Die Atmosphäre ist es vor allem, die mich für Joachim Deixels letztes Werk einnimmt, mich zur Andacht zwingt. Mein aufmerksames Betrachten wird gestört.
Mit leiser Stimme, laut genug, dass meinem Ohr nichts entgeht, während mein Auge gefangen ist, werde ich aufgefordert: „Du sollst es zu Ende malen!“
Ich erschrecke, gebe mich aber nicht eingeschüchtert, sondern weiterhin gefangen, um dann zögernd einzuwenden: „Das kann ich nicht. Deine Mentalität ist nicht meine. Ich würde es dir verderben.“
Aber das lässt er nicht gelten, wirft mir Fisimatenten vor und bekennt sich dazu, mir behilflich sein zu wollen.
„Ich führe dich“, sagt er leise und dennoch höre ich heraus, dass er verführen meint, obwohl er mir sicher einreden möchte, meine Hand mit dem Pinsel soll bloß seinen Vorstellungen folgen.
Die mitschwingenden Töne ängstigen mich. Ich weiß plötzlich nicht, was ich von uns beiden halten soll.
Er spürt meine Unsicherheit, ruft mir zu, und daran erkenne ich meinen ehemaligen Freund: „Sei ein Mann … sei Faust!“
Hat mich bei erster Begegnung der ehemalige Stalinverehrer überzeugt, so spricht nun aus ihm der Goetheliebhaber. Trotz dieser pathetisch lächerlichen Aufforderung, Faust sein zu sollen, ist mir eher nach Margarete zumute, so dass sich mir Pathos auf die Lippen drängt… Mir graut’s vor dir. Obwohl das sicher Gedanke blieb, sehe ich ihm an, solchen Abschied will er nicht gelten lassen. Dennoch, mit einem Male überfällt mich Schwäche, Abschied oder nicht, ich kann mich nur um mich selbst kümmern. Ich fühle Schwindel. Ich habe das Gefühl, mich unbedingt setzen zu müssen, folge meinem Gefühl, verspüre zuerst schmerzhaft die Stuhlkante, bevor das Sitzmöbel mich ganz hat und mir Aufenthalt gewährt. Dann, obwohl sicher nichts passiert, wird mein Gedächtnis lückenhaft, habe ich einen so genannten Filmriss, den ich einer Ohnmacht verdanke. Vielleicht sind es mehrere Bewusstlosigkeiten, die sich als farbige bezeichnen lassen und mir vor allem Rot, Grün und Blau vorgaukeln, sicher den Maler in mir ansprechen wollen, was ihnen auch, allerdings nicht restlos gelingt. Ich weiß nicht, wie lange die Vorstellung mit den Farbspielen dauert. Als ich zu mir komme, bin ich vollkommen verlassen, fühle mich dementsprechend, scheue es, zu rufen, lasse mir Husten und Hüsteln einfallen. Vergeblich.