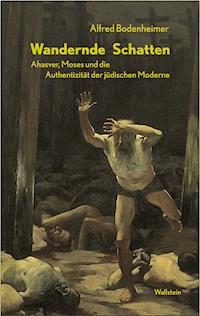15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Als Kind floh Bianca Himmelfarb aus Nazi-Deutschland über die Schweiz nach England, und Rabbi Kleins Großvater war ihr Fluchthelfer. Später heiratete Bianca einen Industriellen; als er starb, wurde sie Unternehmerin und Kunstmäzenatin. Immer im Frühjahr residiert sie in ihrer Luxuswohnung am Zürichberg. Dort wird sie, nur wenige Stunden, nachdem Rabbi Klein sie besuchte, tot aufgefunden. Selbstmord, heißt es. Ein Verbrechen, vermutet der Rabbi, Kommissarin Bänziger jedoch glaubt nicht recht daran. – Gabriel Kleins Gelehrtheit, seine Einfühlung und seine Neugier machen ihn zu einem angesehenen Rabbi, aber auch, zum Leidwesen der Kriminalpolizei, zu einem unschlagbar guten Detektiv.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Ähnliche
Nagel & Kimche E-Book
Alfred Bodenheimer
Im Tal der Gebeine
Rabbi Kleins fünfter Fall
Seit dem Umsteigen in Mannheim lässt sich die Beklommenheit nicht mehr unterdrücken. Beide wissen: Wenn sie diesen Zug verlassen, dann bedeutet das die Trennung – eine sehr, sehr lange Trennung und eine sehr, sehr große Entfernung, die dann zwischen ihnen liegen wird.
In Frankfurt hat Bianca schon von der Mutter Abschied genommen. In der Bahnhofshalle hat die Mutter noch gelacht, wenn auch etwas gezwungen, ihr aufgetragen, was sie Ruth alles ausrichten soll, und gesagt, dass sich die Verhältnisse sicher rasch ändern würden, und dann wären sie wieder zusammen, alle vier. Bianca weiß nicht genau, was Verhältnisse sind, aber sie hat nichts gesagt. Auf dem Bahnsteig hat die Mutter sie umarmt, sie an sich gepresst, fast ist Bianca die Luft weggeblieben. Die Mutter hat die Wange auf ihre Wange gelegt und unablässig gesprochen, leise, fast flüsternd. Bianca hat nur einen Teil davon verstanden, Fetzen wie «stolz auf dich» und «über alles in der Welt», der Rest wurde vom Quietschen des einfahrenden Zugs verschluckt. Und als die Mutter sie losließ, da war Biancas Wange ganz feucht.
Sie sind dann eingestiegen, Vater und sie, die Mutter stand noch vorm offenen Fenster, aber sie hat nichts mehr gesagt, sich nur die Augen gewischt mit einem weißen Taschentuch. Als der Zug ruckelte und anfuhr, rief sie plötzlich: «Bianca, vergiss mich nicht!», was ihrer Tochter einen furchtbaren Schrecken eingejagt hat. In diesem Moment hat sie verstanden, dass das mit den Verhältnissen nicht stimmt, dass die Mutter es selbst nicht glaubt. Vater hat sie dann aufgefordert, aus dem Fenster zu schauen, sie sah die Mutter winken mit ihrem feuchten Taschentuch, Vater hat auch ein Taschentuch gezückt und zurückgewinkt.
Aber Bianca hat nicht gewinkt, nur hinausgeschaut auf die kleiner werdende Figur ihrer Mutter.
Nun, da auch die Trennung vom Vater naht, erscheint es ihr unverständlich, dass die Mutter sie nicht begleitet hat auf dieser Reise nach Basel. Sie fragt den Vater, warum die Mutter in Frankfurt geblieben ist.
«Ging nicht anders», sagt der Vater kurz angebunden, und sein Blick verrät, dass er nicht darüber sprechen will, weil sie nicht allein im Abteil sitzen. Zwei Herren sitzen noch da, beide lesen Zeitung, beim einen ist die Titelseite zu sehen, ganz unten auf der Seite steht in fetten Buchstaben: «Die Juden sind unser Unglück!»
Als die beiden Herren in Freiburg ausgestiegen sind, vergisst sie, nochmals zu fragen. Sie wird den Grund nie erfahren, aber Jahre später wird sie es verstehen. Es sind zwei Gründe. Erstens hat die Mutter Angst, eine dermaßen in die Länge gezogene Trennung nicht zu überstehen. Als Ruth vor drei Monaten auf den Kindertransport nach England ging, da durften die Eltern nicht einmal zum Bahnhof kommen, weil die Behörden keinen Auflauf wollten. Das traf die Mutter hart. Aber sie spürt zugleich: Bianca zu begleiten bis zur Grenze, das würde sie nicht durchstehen. Die letzten sechs Jahre haben an ihr gezehrt. Sie würde sich, das Kind und den Mann verrückt machen, wenn sie mitführe. Das ist der erste Grund. Der zweite: Eine Fahrkarte nach Basel und zurück kostet Geld, selbst in der Holzklasse. Und da fast nichts mehr hereinkommt, müssen sie haushalten.
Bald darauf beginnt das Kind zu schlottern, ihm ist kalt, und das am 31. Juli, nur mit halbem Ohr hört es zu, was der Vater ihm nun einschärfen will, wie schon ein Dutzend Mal in den letzten Tagen, und was es eh schon auswendig hersagen könnte. Er sieht sie besorgt, aber auch geistesabwesend an, reicht ihr das letzte Brötchen, das die Mutter zubereitet hat, das Kauen tut ihr plötzlich weh, sie sagt es, doch er ist verstrickt in seine Litanei, die er sich schon deshalb sparen könnte, weil alles auch auf einem Zettel steht, den sie ihr eingepackt haben.
«In Basel gebe ich dir deinen Pass, und du gehst über den Zoll. Ich bleibe auf der deutschen Seite und fahre zur Mama zurück. Auf der Schweizer Seite erwarten dich Max und Ludwig. Das sind meine Vettern, ganz liebe Leute, vor denen du keine Angst haben musst, im Gegenteil, sie haben sehr viel für uns getan und freuen sich, dass du kommst. In Basel bleibst du nur eine Nacht, Ludwig hat für dich ein eigenes Hotelzimmer bestellt, stell dir vor! Er schläft dann auch im Hotel, im Zimmer nebenan, und am nächsten Tag fährt er mit dir nach London. In dieselbe Stadt, in der jetzt Ruth ist. Das ist ein großes Glück. Aber du wohnst dann nicht bei Ruth, sondern bei einem Ehepaar, Herrn und Frau Shelley. Die haben schon große Töchter und nehmen dich auf. Bei ihnen wirst du es gut haben, sie haben ein großes Haus und sind sehr nett, hat Ludwig geschrieben. Wir haben ihre Adresse und werden dir ganz oft schreiben. Bitte schreib uns zurück, Ruth schreibt auch jede Woche.»
Rückblickend wird Bianca sich ein Leben lang fragen, wieso ihr Vater, der, solange Juden noch ohne Einschränkungen arbeiten durften, einer der bekanntesten Internisten Frankfurts war, damals nicht bemerkte, dass sie krank war.
In Basel wird ihr ein zweites Mal an diesem Tag fast die Luft abgedrückt. Jetzt spürt sie die sanft kratzenden kleinen Stoppeln des Vaters an ihrer Wange. Wie feinstes Schmirgelpapier – tatsächlich denkt sie in diesen letzten Sekunden, in denen der Vater sie berührt, an Schmirgelpapier. Wieder ist ihre Wange nass, als sie sich löst. Den Koffer kann sie kaum hochheben. An diese wenigen Meter zwischen Deutschland und der Schweiz scheint niemand gedacht zu haben, wo ihr weder der Vater noch die Vettern helfen können. Dazu ist sie fiebrig, zu warm angezogen.
Ich werde es gar nicht bis in die Schweiz schaffen, denkt sie, halb verzweifelt, halb hoffnungsfroh. Dieser Koffer zwingt mich, mit Papa wieder heimzufahren.
Doch da kommt ein Mann und fragt freundlich und in badischem Dialekt, den sie das erste Mal in ihrem Leben hört, ob er der jungen Dame helfen kann.
Junge Dame, denkt sie und muss nun doch ein bisschen lachen, während sie schüchtern nickt. Sie ist neun Jahre alt.
Der Mann trägt ihr den Koffer bis zum deutschen Zollbeamten und steht hinter ihr, während ihr Pass gründlich durchgeblättert wird, ein Papier herausgenommen, wieder hineingelegt, und sie schließlich durchgewinkt wird.
Wieder ein paar Meter, diesmal bis zu den Schweizer Beamten. Ihr Helfer sagt zwei, drei freundliche Worte. Wieder eine Passkontrolle, nun dauert sie länger. Der Beamte holt einen Kollegen, vielleicht ist es ein Vorgesetzter, sie schauen den Pass an, dann wieder das Papier, dann das Kind. Schließlich wendet sich der eine Zöllner an Bianca. «Wirst du abgeholt?» Zunächst versteht sie ihn kaum, einen so eigenartigen Akzent hat der Mann.
Schließlich, schwitzend und frierend und mit schmerzendem Hals, nickt sie schwach.
«Von wem?»
«Von Ludwig und von Max.»
«Kennst du auch ihre Nachnamen?», fragt der Beamte.
Bianca wird panisch. Was will der Mann von ihr? Natürlich kennt sie den Nachnamen. Hundertmal hat ihn der Papa ihr gesagt. Nur gerade jetzt fällt er ihr nicht ein. Es ist ein hübscher Name, ein niedlicher, das weiß sie noch. Aber sie kommt nicht drauf. Sie hat sogar vergessen, dass er auf dem Zettel steht, den die Mutter ihr eingepackt hat in das Täschchen, das sie umhängen hat, in dem das Wichtigste ist, etwas Geld, Fotos und auch der Pass, wenn ihn nicht solche Männer in den Händen halten und nicht mehr hergeben.
«Sie sind die Vettern meines Vaters», sagt sie stattdessen.
Das scheint nicht zu reichen. Einer der Zöllner greift zum Telefon.
Bianca ist wütend auf ihren Vater, dass er sie darauf nicht vorbereitet hat. Sie solle den Pass zeigen und gut darauf achten, dass das Papier drinbleibe, das sei sehr wichtig. Dann würde alles gutgehen. So hat er gesagt.
Es geht aber nicht gut. Am Zoll geht es nicht gut, und ihr geht es nicht gut, sie steckt fest, zu ihrem Vater kann sie nicht zurück und zu den Vettern in die Schweiz kann sie nicht hinüber, weil zwei Männer mit steifen graugrünen Mützen sie nicht lassen. Nur weil ihr dieser dumme Name nicht einfällt!
Der Mann am Telefon sagt: «Isch guet. Jä, isch guet. Guet. Mache mer.» Dazu nickt er. Dann legt er auf.
«Komm mal mit», sagt er.
«Wohin?», fragt Bianca. Sie hat das Gefühl, dass ihre Beine sie nicht mehr tragen, und plötzlich hat sie einen schrecklichen Druck auf der Blase und ein Loch im Magen. Und furchtbare Halsschmerzen. Und heiß. Und kalt.
«Komm einfach mit.»
«Aber mein Koffer!»
«Den kannst du hierlassen. Wir passen schon auf ihn auf.»
Das klingt aber nicht freundlich, sondern eher so, als ob der Koffer verhaftet wäre. Und sie? Wird sie auch verhaftet?
Der Mann geht voraus und schaut, ob sie ihm folgt. Sie setzt ein Bein vor das andere, es scheint ihr unendlich schwer. Zuvor hat sie sich noch umgewandt zu dem freundlichen Mann. Vielleicht ein Lächeln zum Abschied. Doch der Mann schaut nicht.
Der Zollbeamte öffnet eine Tür und winkt sie hinein. Und wenn sie einfach wegrennen würde? Ist sie nicht bereits in der Schweiz? Unsinn, der Mann würde sie sofort einfangen, und dann ginge es ihr erst recht an den Kragen. Außerdem kann sie kaum mehr gehen, wie sollte sie da rennen?
Plötzlich hört sie ihren Namen. Sie wendet sich um, einen Schritt vor der geöffneten Tür. An einer Schranke steht ein Herr, sie müsste sein Gesicht von den Fotos kennen, die die Mutter und der Vater ihr gezeigt haben, aber sie ist sich nicht sicher, sie kennt nur Fotos, die Menschen darauf nicht. Aber das muss Max sein, der da steht, ein großer Mann, der seinen Hut schwenkt.
«Max!», ruft sie, und wie sie ihn da stehen sieht, fällt ihr auch wieder ein, was der Vater ihr gesagt hat zu ihren Nachnamen: «Meine Vettern sind beide groß und heißen Klein.»
Der Zöllner blickt ebenfalls in Richtung des winkenden Mannes, und nun sagt sie selbstbewusst: «Klein heißen die Vettern. Sie sind groß und heißen Klein.»
Der Zöllner wirkt unentschlossen. «Warte hier», sagt er und geht mit einem misstrauischen Blick zurück zur Schranke und spricht mit Max. Er zeigt ihm den Pass, das Papier, Max nickt, zieht etwas aus der Gesäßtasche und zeigt es dem Zöllner, der es kontrolliert und ihm dann zurückgibt.
Er kommt zu Bianca zurück und reicht ihr den Pass. «In Ordnung. Du kannst deinen Koffer holen.»
Das ist leichter gesagt als getan. Ihr Helfer ist längst durch. Der Zöllner sieht sie ratlos vor ihrem Riesenkoffer stehen, und während sein Kollege weiterhin Reisende abfertigt, nimmt er den Koffer und trägt ihn bis zur Schranke.
«Dieser Service ist sonst nicht inbegriffen», sagt er, als er sich abwendet und zurückgeht. Bianca versteht den Satz nicht, aber es ist ja auch egal, schon steht der Max vom Foto neben ihr und sagt: «Bianca, Gott sei Dank, da bist du. Ich bin der Ludwig.»
Entschlossen greift er nach ihrem Koffer und bringt sie als Erstes zu einer Stelle, von der aus man hinüber auf die deutsche Seite sehen kann. Mit ausholender Geste zeigt er auf Bianca hinunter, und sie sieht weit entfernt den Vater winken, euphorisch, verzweifelt, er schickt ihr Kusshände, dann verschränkt er die Hände ineinander, drückt sie, wohl um Ludwig zu danken.
«Willst du dem Papa nicht winken?», fragt Ludwig.
«Doch», sagt Bianca. Aber sie winkt nicht. Entweder man bleibt beieinander, denkt sie, oder man trennt sich halt, aber dann sagt man auf Wiedersehen, und die Sache ist vorüber. So hat sie es auch mit Ruth gemacht, als die weggefahren ist. Sie kann nicht winken, sie wünscht, dass der Vater nun aufhört damit, und geht.
Das tut er schließlich auch. Die Mutter mit ihrem Taschentuch, der Vater mit seinen Kusshänden – es ist das Letzte, was sie von ihnen gesehen hat, für immer.
Jahrzehnte später wird Isi Klein ihr die Briefe zeigen, die ihre Eltern in den Jahren vor Biancas Reise an Max und Ludwig geschrieben haben, und erst da wird sie begreifen, was ihnen damals widerfahren ist. Dass ihr Vater, Doktor Leopold Kugel, aus Deutschland fortwill, mit der ganzen Familie, gleich als Hitler an die Macht kommt und er Schwierigkeiten hat, im Krankenhaus zu arbeiten, während in seiner Praxis die arischen Patienten bald wegbleiben. In Australien, hat man ihm erzählt, herrsche Ärztemangel, und er meldet sich dort bei Krankenhäusern und bekommt tatsächlich eine Einladung, als Oberarzt in Canberra zu arbeiten. Oberarzt, so schreibt er an seine Cousins, das ist zwar unter meinem jetzigen Niveau, aber es ist ein Fuß in der Tür. Nur weg aus Deutschland!
Noch während Leopold Kugel sich um die Papiere bemüht, erleidet die Schwiegermutter einen Schlaganfall. Undenkbar, sagt Grete Kugel, dass sie ihre Mutter in diesem Zustand in Frankfurt allein zurücklässt und sich auf die andere Seite der Welt begibt. Der ganze Plan muss beerdigt werden.
Später, als alles immer schwieriger wird, ergreifen die Schweizer Cousins die Initiative. Ludwig Klein, Junggeselle und Besitzer einer gutgehenden Kaffeerösterei bei St. Gallen, möchte die ganze Familie in die Schweiz holen, er kann für die finanziellen Aufwendungen bürgen. Und obwohl die Schweizer Ärzteschaft keine jüdische Konkurrenz aus dem Ausland braucht, wird es vielleicht doch eines Tages möglich sein, dass der Doktor aus Frankfurt der Eidgenossenschaft gute Dienste leistet.
Die Fremdenpolizei gibt grünes Licht. Unter einer Bedingung: Grete Kugels Mutter muss in Deutschland bleiben. Pflegefälle einreisen lassen, das machen sie nicht. Da kann einer zehnmal bürgen.
Und wenn es nur die Kinder wären? Die beiden Mädchen? Leopold Kugel sieht schwarz für die Juden in Deutschland, seine Kinder werden nie eine Chance erhalten, hier zu studieren und in Frieden einen Beruf auszuüben, sich nie frei bewegen können, es wird ja nur alles schlimmer, Juden sind Freiwild, jeder staatlichen Willkür schutzlos ausgesetzt.
Ludwig könnte die beiden Töchter nicht übernehmen, einem Junggesellen ist das nicht erlaubt, aber bei Max, der zwei Kinder hat, könnte man sie einquartieren. Max ist nicht auf Rosen gebettet, aber das Finanzielle könnte Ludwig übernehmen. Grete ist zögerlicher als Leopold, sich von den Kindern zu trennen, das tut man doch nur in der äußersten Not, schließlich willigt sie ein – aber die Schweizer Fremdenpolizei lehnt es ab, die Mädchen allein einreisen zu lassen.
Dann kommt das Novemberpogrom, die Reichskristallnacht, und nun hat jeder Jude in Deutschland begriffen, dass keine Zeit mehr zu verlieren ist. Alle Hoffnung auf bessere Zeiten ist verflogen. Die pflegebedürftige Schwiegermutter werden sie in dieser Hölle nicht allein lassen, das betonen Leopold und Grete immer wieder, aber die Kinder müssen raus, so rasch wie möglich.
Und plötzlich, im Frühjahr 1939, überstürzen sich die Ereignisse, Hitler marschiert in Prag ein, der Krieg scheint unausweichlich. Da erreicht die Kleins eine Meldung aus Frankfurt: Es gibt Kindertransporte nach England, und die Eltern haben es geschafft, die beiden Mädchen auf die Liste zu bekommen. In zwei Wochen, schreiben die Kugels, werden sie schon losfahren, man weiß nicht, ob man über das Glück für die Kinder lachen oder über die Trennung weinen soll. Wenige Tage später ein entsetzter Brief: eine furchtbare, verhängnisvolle Schlamperei! Nur die Ältere, Ruth, wurde auf die Liste gesetzt, Bianca darf nicht mitfahren. Die Eltern haben beide Kinder angemeldet, für beide eine Bestätigung erhalten. Doch was nützt dir eine Bestätigung, wenn es dann mitleidlos heißt, alle Plätze seien belegt?
Max und Ludwig werden gebeten, nach jedem denkbaren Weg zu suchen, um für Bianca einen Platz zu finden. Sie schreiben in die ganze Welt, an Geschäftspartner und alte Kontakte. Vor allem Ludwig kennt viele Leute, in Brasilien, in Mexiko, und er schreibt alle an, ohne zu wissen, wie die kleine Bianca allein dorthin kommen sollte. Das aber hat er Leopold und Grete nie geschrieben, Isi erinnert sich an die Gespräche am Küchentisch. Auch daran, dass nach und nach die Absagen eintreffen, von denen Ludwig und Max den Verwandten in Frankfurt nicht berichten. Ruth ist längst in England, schreibe «tapfere Briefe», wie die Kugels es nennen. Aber für Bianca ist nichts in Sicht.
Und dann plötzlich, so wird Isi sich erinnern, steht an einem Schabbat Ludwig an der Tür von Max. Er ist mit dem Auto von St. Gallen gekommen, und obwohl er selbst sich nicht streng an die Religionsgesetze hält, hätte er dem frommen Bruder Max nie zugemutet, ihn am Schabbat mit dem Auto zu besuchen, wenn es nicht etwas wirklich Wichtiges zu besprechen gäbe. Ein Telegramm ist eingetroffen, von Sir Winfred Shelley aus London. Er und seine Frau wären bereit, Bianca aufzunehmen. Ihre eigenen Töchter seien verheiratet, und sie hätten Platz im Haus. Frau Shelleys Bruder arbeite im Außenministerium, er kümmere sich um die Formalitäten, man solle nur rasch die nötigen Angaben über Bianca kabeln. Rasch wird beschlossen, dass Bianca über die Schweiz nach England reisen soll. Eine Bewilligung zur Einreise für vierundzwanzig Stunden dürfte sie wohl erhalten. Leopold bringt sie bis an die Grenze, dort wird die Familie sie empfangen, und Ludwig wird sie nach London begleiten und dem Ehepaar Shelley übergeben. London! Sie wird in derselben Stadt wohnen wie Ruth.
Und Isi wird sich erinnern, sein ganzes Leben, wie Max seinen Bruder umarmt und laut und deutlich den Segensspruch rezitiert, den man beim Empfang einer guten Nachricht spricht, über Gott, der gut ist und Gutes tut. Und der Bruder, der soeben am heiligen Schabbat aus dem Auto gestiegen ist, sagt feierlich «Amen».
So steht nun Bianca in Basel am Badischen Bahnhof, umringt von Schweizer Verwandten. Denn nicht nur Ludwig ist da, auch Max ist von Zürich gekommen, und mit ihm die ganze Familie, seine Frau Minna, die Tochter Margot und Isi, der Sohn.
Doch was Doktor Leopold Kugel, versunken in seiner Verzweiflung, seiner Hoffnung und seinem Schmerz, an seiner Tochter während der ganzen Reise nicht bemerkt hat, das sieht Minna auf den ersten Blick. «Dem Kind geht es nicht gut. Das Kind ist krank.»
Sie bringen Bianca mit dem Taxi ins Hotel Greub, gegenüber vom Schweizer Bahnhof SBB. Max und Minna begleiten sie, die anderen folgen mit dem Tram. Ludwig hat sein Auto zuhause gelassen, er soll ja morgen mit Bianca den Zug nach Frankreich nehmen. Noch im Taxi geraten Max und Minna in einen heftigen Streit. Max meint, Bianca müsse unter allen Umständen morgen die Reise antreten, sonst laufe ihre Bewilligung ab. Minna erklärt, ein krankes Kind auf eine Reise zu schicken, nur weil man ein überkorrekter, fanatisch staatstreuer Schweizer Jude sei, wäre absolut unverantwortlich.
Sie einigen sich darauf, einen Arzt zu rufen. Dessen Diagnose ist eindeutig: Mumps. Und seine Meinung zu einer Weiterfahrt am kommenden Tag ebenfalls: «Sie riskieren eine Hirnhautentzündung. Das Kind darf unter keinen Umständen eine so lange Reise antreten.»
Max schaut betreten drein. Während der Zugfahrt nach Basel hatte er begeistert erklärt, unter welch gutem Stern Biancas Reise stehe. «Heute, am einunddreißigsten Juli, ist das Datum des fünfzehnten Aw, einer der heute fast vergessenen, früher besonders ausgelassenen Freudentage in der jüdischen Tradition. Und morgen ist der erste August, die Bundesfeier der Schweiz, Symbol für die Freiheit von fremdem Joch und Unterdrückung. Bessere Vorzeichen kann es doch für Biancas Reise gar nicht geben.» Der Besuch mit der Familie an der patriotischen Landesausstellung am Tag zuvor hat offensichtlich auf ihn abgefärbt.
Das alles fällt nun in sich zusammen. Der Arzt schreibt ein Attest, und damit wird man morgen zur Fremdenpolizei gehen müssen, um eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis um vierzehn Tage zu erlangen. Noch ist der 1. August kein offizieller Feiertag, die Ämter sind geöffnet.
Während die Männer versuchen, sich mit der neuen Situation abzufinden, ist Minna bereits einen Schritt weiter. Sie wird heute Nacht im Hotelzimmer nebenan schlafen, das Ludwig für sich gemietet hat, und darum bitten, die Verbindungstür zwischen den Zimmern aufzuschließen. Ludwig und Max mit den Kindern sollen jetzt heimfahren. Ludwig, der sein Auto in Zürich stehen hat, soll es holen und sie morgen, wenn er auf der Fremdenpolizei gewesen ist, nach Zürich fahren. Dann kann Bianca hinten auf der Rückbank liegen, das ist besser als im Zug. Daheim kann sie die Kleine pflegen.
Und so wird Bianca zwei Wochen lang in der Wohnung von Max Klein und seiner Familie in Zürich umsorgt. Sie bekommt Isis Zimmer und Bett, Isi schläft bei Margot. Deren Protest erstickt die Mutter sofort. Am liebsten, sagt sie, würde sie das Kind bei sich behalten, dann hätte Margot ohnehin kein eigenes Zimmer mehr. Jetzt wird kein Theater gemacht wegen eines kleinen, geflüchteten, kranken Kindes!
Isi beschwert sich nicht. Er hat Bianca vom Augenblick, als er sie fiebrig und unglücklich im Bahnhof stehen sah, ins Herz geschlossen. Zwischen den beiden wird sich eine lebenslange, tiefe Verbundenheit entwickeln. Er ist knapp drei Jahre älter als sie und versteht es als seine Pflicht, dem Mädchen, das seine Eltern furchtbar vermissen muss und vor einer ungewissen Zukunft steht, die Wochen bei sich zuhause möglichst angenehm zu gestalten. Sooft er kann, sitzt er bei ihr und liest ihr vor oder erzählt ihr von den Neuigkeiten in der Welt draußen. Wenn sie müde ist, sitzt er manchmal einfach schweigend da.
Nach einigen Tagen fühlt sie sich besser und kann zum Gespräch beitragen. Sie entdecken, dass sie über dieselben Dinge lachen, und so gelingt es ihm, sie aufzuheitern und auf andere Gedanken zu bringen, wenn sie schwere Momente und Sehnsucht nach den Eltern hat. Als die zwei Wochen um sind, in der Nacht vor Biancas Abreise, kann Isi nicht schlafen. Er weiß, dass er dieses Mädchen furchtbar vermissen wird.
Um sechs Uhr morgens wird die ganze Familie vom Klingeln des Telefons geweckt: ein Anruf aus dem Bürgerspital Basel. Ludwig ist im Hotel, in dem er übernachten wollte, gestern Abend die Treppe hinuntergefallen, er hat sich das Bein gebrochen. Unmöglich, mit Bianca nach England zu fahren. Max muss einspringen. Doch alle notwendigen Papiere sind auf Ludwig ausgestellt, und Max hat noch nicht einmal einen gültigen Reisepass. Der Zug fährt um neun Uhr vom Hauptbahnhof ab.
«Ich muss zur Fremdenpolizei», ruft Max verzweifelt. «Wir müssen den Aufenthalt von Bianca nochmals verlängern.»
Doch diesmal drängt Isis Mutter zu Biancas Abreise.
«Wenn du das tust», sagt sie, «dann riskierst du, dass sie ausgewiesen wird. Zurückgeschickt nach Frankfurt.»
Die Vorstellung, irgendjemanden zu hintergehen, und gar den Schweizer Staat, ist Max Klein unerträglich. Umso entsetzter reagiert er auf die Forderung seiner Frau, sofort in Ludwigs Hotelzimmer dessen Reisedokumente zu holen und selbst mit Bianca aufzubrechen.
«Niemals!»
Diesmal streitet seine Frau nicht mit ihm. Sie holt einen Koffer aus dem Schrank und packt Max’ Sachen. Sie beginnt mit dem Tallit und den Tefillin, ohne die er nie verreisen würde.
«Was tust du da?»
«Ich packe für dich. Du fährst entweder mit Bianca nach England, oder du ziehst aus. Gehen wirst du auf alle Fälle.»
«Aber ich sehe überhaupt nicht aus wie Ludwig», macht Max einen letzten Versuch. «Wenn jemand den Pass anschaut …»
«Wenn jemand den Pass anschaut und dann dich, dann wird er sagen: ‹Gott, ist der Mann alt geworden.›»
Also sitzt Max Klein um neun Uhr mit Bianca im Zug, voller Angst und mit schlechtem Gewissen, aber auch mit Spuren von Lippenstift auf den Wangen. Seine Frau hat sich schöngemacht für die Abreise, Bianca soll das Gefühl haben, es sei ein feierlicher Moment.
Einige Tage später, als Max die Tür aufschließt und ruft: «Ich bin wieder da!», sitzt Isi mit seiner Mutter und Margot im Wohnzimmer und hört auf Radio Beromünster, dass Hitler und Stalin einen Nichtangriffspakt geschlossen haben. Geblieben ist Isi Klein von dieser Reise die Zinnfigur eines Beefeaters, die ihm der Vater aus London mitgebracht hat. Es ist überhaupt seine einzige Zinnfigur, und er hat sie sein Leben lang behalten und seinem Sohn Gabriel vererbt. In der Schachtel mit den Briefen von Leopold und Grete Kugel aus den dreißiger Jahren.
1
Selbst durch die Dampfschwaden erkannte Gabriel Klein die Umrisse der sportlich untersetzten Figur mit den abstehenden Haaren sofort. Obwohl sie so gar nicht hierhergehörte. Vielleicht war es ihre Haltung – die Ruhe gegenüber der Hektik und Beflissenheit der Leute, die das Prozedere hinter sich bringen wollten.
Sie befanden sich alle im Ausnahmezustand. Ihre Aufmerksamkeit war seit Tagen nur noch auf das Pessachfest gerichtet. Auch bei ihm zuhause hatte Rivka wie jedes Jahr mit der Putzfrau das Unterste zuoberst gekehrt; jedem Krümel Brot oder Kuchen, der sich in einer Ritze verstecken mochte, jedem abgebrochenen Partikelchen einer Spaghetti, aber auch jedem Staubkorn, das sich zwischen den Küchenregalen versteckt haben mochte, wurde der Garaus gemacht. Kleins Angebot – im Sinne eines modernen Geschlechterverständnisses –, bei dieser Arbeit zu helfen, wurde brüsk zurückgewiesen. Dafür wurden Zeitungen, Hefte, Broschüren, Papiere, die Klein, unschlüssig, was damit zu tun sei, hatte herumliegen lassen, mitleidlos entsorgt, wenn er sie nicht rechtzeitig in Sicherheit brachte. Rivka war eine rücksichtsvolle Ehefrau, aber nur während zehneinhalb Monaten im Jahr. Die Pessachvorbereitungen holten aus ihr einen Perfektionismus und eine Strenge hervor, die Klein jedes Jahr erneut kalt überraschten. Von Amtes wegen war er in dieser Zeit vor allem damit beschäftigt, den Mitgliedern alle möglichen Fragen zu beantworten, was man an diesem Fest essen und nicht essen, aufbewahren und nicht aufbewahren durfte, an dem kein Chametz genossen werden oder sich auch nur im Haus befinden durfte. Viele Lebensmittel, die man sonst im Supermarkt kaufte, waren jetzt in der kostspieligen, garantiert chametzfreien Version im Koscherladen von Josef Gut zu erstehen, wenn man sicher sein wollte, das Fest korrekt einzuhalten. Selbst das Geschirr wurde durch Pessachgeschirr ersetzt, welches das Jahr über in Kisten auf Dachböden oder in Kellern lagerte.
Ein besonderer Vorgang, wenige Tage vor dem Fest, war das Kaschern von Metallgeschirr, den Pfannen, die man auch an Pessach benutzen wollte, den schönen Silberbechern, die viele Familien an Festtagen für den Kiddusch und am Sederabend für die obligatorischen vier Becher Wein benutzten. Die mussten, um für Pessach bereit zu sein, nicht nur blitzblank geputzt werden, sondern auch noch in kochendes Wasser getaucht, um den letzten Rest gesäuerter Elemente zu entfernen. Klein stand in der Küche des Gemeindezentrums, legte die Gegenstände, die ihm gereicht wurden, sorgfältig in einen großen Metallkorb, nachdem er ihre Sauberkeit geprüft hatte, und ließ ihn in das brodelnde Wasser im Becken gleiten. Dabei trug er eine Gummischürze und hitzebeständige Gummihandschuhe, die bis zum Ellbogen reichten. Gesicht und Haar nass von Schweiß und Dampf, fuhr er sich mit dem hochgekrempelten Ärmel über die Stirn. Ein Schweißband, wie er es als Jugendlicher beim Sport getragen hatte, würde sich für einen Rabbiner beim Kaschern nicht geziemen.
Er konnte jetzt nicht weg, der Leute wegen nicht, des kochenden Wassers wegen nicht, und er versuchte, der überraschend aufgetauchten Kommissarin Karin Bänziger ein Zeichen zu geben, dass es noch eine Weile dauern würde. Doch sie blieb einfach an den Türrahmen gelehnt stehen, jemand sprach sie an, Klein konnte nicht erkennen, ob sie ausführlich antwortete, er musste sich auf seine Arbeit konzentrieren. Als er nach einer Weile wieder hinschaute, war Karin Bänziger nicht mehr zu sehen.
Als er schließlich fertig war mit dem Kaschern, den Herd abstellte, die Handschuhe abstreifte, die Schürze auszog, kam sie herein, nicht eilig, aber bestimmt, und sie gaben einander die Hand.
«Guten Tag, Herr Rabbiner, Ihre Sekretärin Frau Wild hat mir gesagt, dass ich Sie hier finde.»
«Frau Kommissarin», erwiderte er, «was führt Sie denn in diesen Höllenschlund?» Dass es nichts Gutes war, ließ sich ja ahnen, das war es nie, denn für die angenehmen Dinge war sie nicht zuständig. Aber er erschrak nun doch, als sie mit ernstem Gesicht fragte, ob sie sich irgendwo setzen könnten.
«Ja, natürlich», sagte Klein leicht beunruhigt und führte sie in das Zimmer, in dem sonst die jüdische Loge tagte, ein langgezogener Raum, der meist verschlossen war. Klein drehte das Licht an, und sie setzten sich an den nächsten Tisch.
«Man hat mir gesagt, Sie seien in Zürich der einzige Verwandte von Bianca Himmelfarb», sagte Frau Bänziger.
«Wer hat das gesagt?», fragte Klein, als wäre das von Bedeutung.
«Frau Haas», sagte Frau Bänziger. «Filomena Haas, Frau Himmelfarbs Haushälterin. Sie kennen sie, wenn ich nicht irre.»
«Seit bald dreißig Jahren», bestätigte Klein.
«Eben. Sie hat mir auch erzählt, dass Sie gestern noch zu Besuch waren bei Frau Himmelfarb.»
«Ja, das stimmt», sagte Klein nervös. «Wieso, was ist mit Frau Himmelfarb? Ist ihr etwas zugestoßen?»
«Leider ja», sagte Frau Bänziger. «Frau Haas hat sie heute Morgen tot in ihrer Wohnung gefunden. In ihrem Lehnsessel im Salon. Mein Beileid.»
Klein sagte nichts, er schaute vor sich auf die Tischplatte. Frau Bänziger wartete, gab ihm Zeit, sich zu sammeln.
«Sie war», sagte er heiser und räusperte sich, «sie war ja auch nicht mehr jung. Nächste Woche wäre sie neunundachtzig geworden.»
Frau Bänziger nickte. Klein sah sie an, sie erwiderte seinen Blick. Ihm war bewusst, dass eine friedlich entschlafene alte Dame in einem Lehnstuhl kein Anlass für eine Kriminalkommissarin war, die Verwandten aufzusuchen.
«Sie ist ermordet worden?»
Frau Bänziger zuckte fast unmerklich die Schultern. «Der Arzt, der den Totenschein ausgestellt hat, fand keine äußeren Verletzungen, aber gewisse Merkmale kamen ihm verdächtig vor, insbesondere Verfärbungen der Haut. Deshalb hat er vorgeschlagen, die Leiche obduzieren zu lassen, und das haben wir getan. Sie ist offenbar an Gift gestorben. Konzentrierte Blausäure.»
«Wie bitte? Vergiftet? Tante Himmelfarb?»
Tante Himmelfarb. So hatte er sie schon immer genannt, obwohl sie eigentlich nur eine entfernte Cousine seines Vaters war.
«Wir müssen davon ausgehen, dass sie vergiftet wurde, ja. Wir fanden in der Küche ein Glas, das gesäubert wurde, aber immer noch Spuren des Gifts enthält, und eine halbvolle Mineralwasserflasche. Wenn sie aus diesem Glas getrunken hat, kann sie es nicht mehr in die Küche gebracht und gespült haben, dafür wirkt das Gift zu schnell und zu heftig. Es kann sein, dass der Täter die Tablette in Sprudel aufl