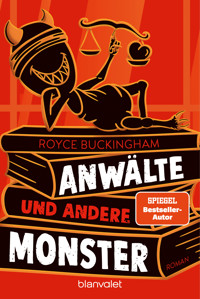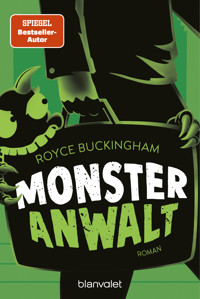9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Monsteranwalt Daniel Becker
- Sprache: Deutsch
Auch Monster haben Rechte! – Der neue Geniestreich von SPIEGEL-Bestsellerautor Royce Buckingham.
Daniel Becker ist Anwalt, und er ist moralisch flexibel genug, dass ihm eine steile Karriere vorgezeichnet ist. Bis ihn ein echtes Monster dazu bringt, es vor einem übernatürlichen Gericht zu verteidigen. Zu seiner eigenen Überraschung ist Daniel erfolgreich, und sein Monsterklient gilt von nun an als unschuldig. Doch damit scheint das Schicksal von Daniels Karriere besiegelt zu sein. Nicht nur, dass sehr seltsame Gestalten in seiner Kanzlei auftauchen, die ebenfalls seine Hilfe wollen. Der monströse Richter verlangt auch von Daniel, dass er die wahren Schuldigen aufspürt – und macht deutlich, dass Versagen keine akzeptable Möglichkeit ist …
Lachen, bis der Anwalt kommt. Monstermäßig gut!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Daniel Becker ist Anwalt, und er ist moralisch flexibel genug, dass ihm eine steile Karriere vorgezeichnet ist. Bis ihn ein echtes Monster dazu bringt, es vor einem übernatürlichen Gericht zu verteidigen. Zu seiner eigenen Überraschung ist Daniel erfolgreich, und sein Monsterklient gilt von nun an als unschuldig. Doch damit scheint das Schicksal von Daniels Karriere besiegelt zu sein. Nicht nur, dass sehr seltsame Gestalten in seiner Kanzlei auftauchen, die ebenfalls seine Hilfe wollen. Der monströse Richter verlangt auch von Daniel, dass er die wahren Schuldigen aufspürt – und macht deutlich, dass Versagen keine akzeptable Möglichkeit ist …
Autor
Royce Buckingham, geboren 1966, begann während seines Jurastudiums an der University of Oregon mit dem Verfassen von Fantasy-Kurzgeschichten. Sein erster Roman »Dämliche Dämonen« begeisterte weltweit die Leser*innen und war insbesondere in Deutschland ein riesiger Erfolg. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen lebt Royce Buckingham in Bellingham, Washington. Er arbeitet zurzeit an seinem nächsten Roman.
Besuchen Sie uns auch aufwww.instagram.com/blanvalet.verlag undwww.facebook.com/blanvalet.
Royce Buckingham
Im Zweifel für dasMonster
Roman
Deutsch von Hans Link
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Alexander Groß Umschlaggestaltung: © Anke Koopmann | Designomicon Umschlagmotiv: © Elm Haßfurth | elmstreet.orgHK · Herstellung: sam Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-26422-2V002www.blanvalet.de
Anwaltsleben
Ich bleibe stehen und blicke zum Belltown Tower hinauf. Der moderne Monolith aus Glas und Stahl erhebt sich hoch in den dunklen, erwachenden Himmel von Seattle wie eine Rakete, die im Morgengrauen starten soll. Er ragt hinter dem neuen Biodome von Amazon auf, der wie eine bunte Glasmütze für King Kong aussieht. Der trostlose alte Betonbunker der Stadtverwaltung, ein Stiefkind der Architektur, stammt aus den siebziger Jahren und hat schon bessere Tage gesehen. Er hockt – ein Wort, das passenderweise das Bild eines im Wald scheißenden Bären heraufbeschwört – leer und ungenutzt meinem Turm gegenüber und ist mir eine Mahnung, dass ich mich glücklich schätzen kann, hoch oben über den Bausünden der Stadt in einem Wolkenkratzer zu arbeiten. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, als ich ihn mit meiner Schlüsselkarte betrete.
Im Aufzug nach oben verkündet der Lauftext auf einem Computerbildschirm die Nachrichten des Tages. Börsenzahlen. Schusswaffentote. Verrücktes Zeug, das unser Präsident verzapft hat. Ich beachte es nicht. Wenn ich mich nur noch für ein Jahr zusammenreißen und mich auf die Arbeit konzentrieren kann und wenn es mir gelingt, die anderen erfolgshungrigen Mitarbeiter auszustechen – vor allem zwei von ihnen –, bin ich ein gemachter Mann.
»Guten Morgen, Mr Becker.«
Das ist Miriam. Empfangsdame. Verlässlich. Professionell. Hat einen Magister in Dichtung oder Kinderliteratur oder einen ähnlich nutzlosen Abschluss, der als Vorbereitung auf die Arbeit als überqualifizierte Sekretärin dient. Ich habe sie mal in einem Café im Queen-Anne-Viertel gesehen, als sie ein Gedicht vorgetragen hat. Drei andere Schriftsteller heuchelten Interesse, während sie sich Latte reinzogen und darauf warteten, dass sie an die Reihe kamen, um ihre eigenen hochtrabenden Sonette, rätselhaften Haikus und unanständigen Limericks vorzulesen oder was sie sonst in ihre kleinen Ledernotizbücher geschmiert hatten, die sie in den verschwitzten Händen hielten. Heute Morgen nickt Miriam mir zu, als ich vorbeigehe. Das bedeutet, dass ich vor meinen beiden Erzrivalen zur Arbeit erschienen bin. Die zwei sind nicht direkt Feinde. Das heißt, Bricklin vielleicht doch. Sie hat meine Recherchen mal »aus Versehen« durch den Schredder gejagt, und ein andermal hat sie mir die falsche Adresse für meine Beförderungsfeier genannt, sodass ich zu spät gekommen bin und alle Partner eine Stunde lang warten ließ. Ich habe zwar keine eindeutigen Beweise, aber einen durchaus begründeten Verdacht …
Heute bin ich der Erste im Büro. Ich gehe an Pearsons riesiger Drehtür vorbei, damit sie mich auch wirklich sieht. Pearson ist eine Partnerin. Bei der Tür handelt es sich um eine Sonderanfertigung aus dem Holz eines alten Schiffes. Wenn ich morgens nicht der Erste bin, schleiche ich mich an ihrem Büro vorbei, damit sie sich nicht sicher ist, ob ich der Erste oder der Zweite oder, Gott behüte, der Dritte war.
»Hi, Caroline.« Ich winke Pearson zu. Sie grummelt. Ich wurde zur Kenntnis genommen. Das reicht mir. Heute gewinne ich.
Ich komme an Fiona vorbei. Sie ist unsere externe Weiterbildungsberaterin in Sachen Ethik. Sie lächelt mich an und tut so, als wäre nichts zwischen uns. Es stimmt – man kann es nicht als Beziehung bezeichnen –, aber wir kennen den praktischen Wert des anderen und respektieren uns gegenseitig für die harte Arbeit, die wir sowohl in unserem jeweiligen Beruf als auch im Schlafzimmer ihrer Penthousewohnung leisten, wo wir nach Kräften ethische Bedenken ignorieren, wann immer es der Terminkalender erlaubt. Wir passen gut zusammen – sie hat einen Abschluss in Unternehmensphilosophie von der UCLA und kleidet sich wie ein Nordstrom-Model für Business Outfits, während ich das Zeug zum Partner habe, nur ohne Wohlstandsbauch. Wie immer sieht sie tipptopp aus. Ich muss unbedingt in meinen Terminplan schauen und sie anrufen, wenn ich eine Lücke entdecke.
Mein Tee wartet auf mich. Er ist noch heiß. Kleine Dampfwölkchen steigen zur Decke empor wie Rauch aus einem acht Zentimeter Einschussloch. Ich hebe die Tasse und trinke. Fettarme Milch und zwei Löffel Zucker. Perfekt. Der erste Koffeinstoß durchströmt mich. Ich brauche das, um mein Gehirn in Gang zu bringen. Juristisches Denken erfordert Konzentration und Energie. Es ist anstrengende geistige Arbeit, wie ein zehnstündiges Schachspiel gegen sich selbst. Jeden Tag. Mit einer halben Stunde Mittagspause.
Ich setze mich auf meinen Stuhl und schaue aus meinem Fenster über die Stadt, die berühmt ist für die Space Needle, Bigfoot, hundertzweiundfünfzig Regentage im Jahr, Microsoft, Amazon, Google und ein Dutzend weiterer boomender Technikfirmen, die jedes freie Grundstück bebauen. Ihre Kräne heben die Skyline von Seattle zu neuen Höhen und treiben die Grundstücks- und Immobilienpreise dermaßen nach oben, dass sie normale Menschen verdrängen. Ich bin kein normaler Mensch. Ich bin Rechtsanwalt.
Ich verdiene sechsstellig und lebe auf einem Hausboot auf dem Lake Union. Meine Anzüge sind maßgeschneidert, ich könnte jeden Monat ein anderes Auto fahren, wenn ich wollte, und ich arbeite im Stadtzentrum bei Fury, Styles, Anderson und bla, bla, bla, toter Partner, toter Partner etc. Es ist eine große Kanzlei mit großen Mandanten. Wir haben 1999 den Prozess um den Einsturz des Kingdome-Stadions geführt, als während der Nationalhymne ein busgroßer Teil des Daches auf die Gastmannschaft der Boston Red Sox fiel und die gesamte Startaufstellung auslöschte – das Team hat geklagt, die Familien haben geklagt, selbst die traumatisierten Fans haben geklagt, nachdem ihre Kinder mit ansehen mussten, wie ihre Lieblingsspieler an der ersten Baseline zerschmettert wurden. Sehr unschön, das alles. Wir kümmern uns außerdem um sämtliche Datenschutz-Streitsachen von Lookbook, und wir haben den Verkauf der Space Needle an Bi-Di abgewickelt, den neuesten Technikgiganten. Wie ich schon sagte, große Sachen.
Nur die Top-Kandidaten schaffen es in die großen Kanzleien von Seattle – die besten fünf Prozent der Juraabsolventen, die in ihrer Jugend zu den besten fünf Prozent der Collegeabsolventen gehört haben. Die besten Jurapraktikanten bei Fury und Styles werden als Mitarbeiter übernommen, und die besten Mitarbeiter werden schließlich Partner. Sie haben die Spitze der Karriereleiter erreicht, so wie ich. Na ja, fast. Nach fünfzehn Jahren mit Fünfzig-Stunden-Wochen, langen Wochenenden im Büro und Tausenden von juristischen Schriftstücken stehe ich kurz davor, Partner zu werden. Es ist der Höhepunkt meines Lebenswerks. Ich habe im Wesentlichen zwei Ziele im Leben, und bei Fury und Styles Partner zu werden ist eins davon.
»Guten Morgen, Phil.«
Ich spreche, ohne aufzuschauen, weil ich weiß, dass unser Praktikant wie ein wachsames kleines Erdhörnchen in meiner Tür steht. Er hält die Hände wie eifrige Pfoten vor der Brust. Phil ist Student der Politikwissenschaften an der Universität von Winnipeg und hofft – berechtigterweise –, für das Jurastudium zugelassen zu werden. Er wohnt auf dem Capitol Hill im Herzen der LGBT-Gemeinschaft. Kleidet sich fast so gut wie ich, obwohl er nicht mehr besitzt als zwei Anzüge von der Stange, fünf taschenlose Sporthemden und ein Sammelsurium von Vintage-Krawatten aus Secondhandläden, die bei ihm tatsächlich gut aussehen.
»Wie ist Ihr Tee?«
»Perfekt. Falls wir dich nicht einstellen sollten, hast du eine große Zukunft als Barista vor dir.« Ich beobachte sein Gesicht und warte auf eine Reaktion. Nichts. Er ist die Gelassenheit in Person.
»Damit verdiene ich mir am Wochenende was dazu.«
»Bezahlen wir dir nicht genug?«
»Ich bin freiwilliger Praktikant.«
»Und jeden Penny wert.« Er lässt sich immer noch nicht aus der Ruhe bringen. Phil wird von mir grundsätzlich verarscht. Nicht so schlimm, dass er eine Klage wegen Belästigung am Arbeitsplatz einreichen würde, aber genug, um ihn davon abzubringen, Anwalt zu werden. Er ist einfach zu nett für das konfliktreiche Leben eines Anwalts.
»Ich habe für Sie die Wettbewerbsverbotsklauseln recherchiert«, sagt er.
»Langweilig.« Ich setze mich und rolle auf meinem Ballstuhl vor und zurück. »Aber notwendig. Hast du eine Liste der Möglichkeiten erstellt, sie zu umgehen?«
»Ja. Es gibt zwölf legale und eine illegale Methode, die aber anwendbar ist, wenn wir unsere Mandanten davon überzeugen können, ohne ihnen dazu zu ›raten‹.« Bei dem Wort »raten« malt er mit den kleinen Fingern Anführungszeichen in die Luft.
»Ganz großartig, aber ich werde es als meine Idee verkaufen müssen. Das verstehst du doch, oder?«
»Ja.«
Immer noch ungerührt. Was für ein toller Junge. »Gut, dann lass die Liste hier und geh. Ich muss eine Stunde meiner Zeit nur für die Durchsicht deiner Recherchen in Rechnung stellen.«
»Sie brauchen meine Arbeit nicht zu prüfen. Sie wissen, dass alles stimmt.«
Das tue ich. Er ist äußerst gewissenhaft. »Ja, aber ich bin für dich zuständig. Ich bin moralisch verpflichtet, deine Recherchen zu überprüfen, wenn ich für einen Jungen vom College die Kosten eines Anwaltsgehilfen in Rechnung stellen will. Außerdem wird auf deiner Arbeit mein Name stehen.«
Marlin Goucher sucht sich diesen Moment aus, um wie ein Rhinozeros in mein Büro gestampft zu kommen. Er bleibt nicht an der Tür stehen, um bedeutungslosen Smalltalk mit mir zu machen oder mit seinen Streberkindern zu prahlen – sie gehen auf die Northwestern University in Chicago und das Whitman College in Walla Walla –, daher weiß ich, dass sein Besuch einen ernsten Anlass hat. Das ist gut. Marlin verteilt die Fälle. Er sichtet sie, wenn sie hereinkommen, und trifft sich dann in der Bibliothek am »Erwachsenentisch« mit den Partnern, um zu besprechen, wem diese Fälle zugeteilt werden. Die Art, wie er die Lippen kräuselt, ist ein verräterisches Zeichen – sie sagt mir, dass ich etwas Großes bekomme.
»Es ist ein neuer Fall hereingekommen«, beginnt er.
Bingo! »Ausgezeichnet. Ich brenne darauf, mehr darüber zu hören.«
»Wenn Sie die Nachrichten gesehen haben, haben Sie schon davon gehört.«
Wow. Interessant. »Ich bin ganz Ohr«, sage ich und falte die Hände vor mir auf dem Schreibtisch, um den Eindruck völliger Konzentration zu erwecken. Dafür bin ich hier bekannt – nachdem ich mein Koffein bekommen habe.
»Der Dampfer-Prozess«, sagt er schlicht.
Davon habe ich tatsächlich gehört. Zwei Jugendliche wurden entstellt, als ihnen E-Zigaretten im Mund explodiert sind. Die Dampferindustrie ist zwar erst wenige Jahre alt, aber schon jetzt treten bei Dampfern rätselhafte Gesundheitsprobleme auf. Das schreit geradezu nach einer Klage, und es scheint, dass wir die glückliche Kanzlei sind, die sie im Staat Washington einreichen darf.
»Warum nicht Bricklin oder Sachma?« Eine gute Gelegenheit für mich, Einblick in das Wettrennen um den Posten des Partners zu gewinnen.
Marlin kräuselt die Lippen. »Die Partner haben Sie dafür ausgewählt. Sachma hätte damit … philosophische Probleme.«
»Warum? Es scheint ein gerechter Prozess zu sein. Diesen armen Kindern ist das Gesicht weggerissen worden. Sie werden für den Rest ihres Lebens aussehen wie ausgewickelte ägyptische Mumien. Und es gibt bereits Berichte über weitere Gesundheitsprobleme.«
»Weil Dragon Vape, Undertaker Vapor, Volcanic, Magic Cloud und Vixen Vapor sich zusammengetan haben, um sich gemeinsam verteidigen zu lassen, und weil sie uns hinzugezogen haben. Wir verklagen sie nicht. Wir verteidigen sie.«
»Oh.«
»Das ist doch kein Problem für Sie, oder?«
Ich muss mir einen Moment Zeit nehmen. Aber nur einen Moment. »Nein. Kein Problem.«
»Wie sehen Sie die Sache von der anderen Seite?«
Das ist ein Test. »Nun, wer sagt denn, dass die Jugendlichen ihre E-Zigaretten nicht umgebaut haben? Sie könnten die Gefahr selbst erzeugt haben. Sie waren noch nicht einmal alt genug, um zu dampfen; wie können verantwortungsbewusste Firmen für das leichtsinnige Handeln risikofreudiger Jugendlicher und Gesetzesbrecher haftbar gemacht werden? Und ungeklärte gesundheitliche Probleme sind genau das – ungeklärt. Das ist die einfache Seite der Klage.«
»Erstaunlich. Ich weiß nicht, wie Sie das machen, aber das ist der Grund, warum man Sie ausgewählt hat.«
»Ich bin dabei.«
»Gut, denn die Sache wird in nächster Zeit Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern. Einige Ihrer unwichtigeren Fälle werden neu vergeben werden müssen. Für diesen Fall müssen Sie klar Schiff machen. Er könnte uns in naher Zukunft definieren.«
»Das ist gut möglich«, stimme ich zu. Die Kanzlei, die dem Dampfen dabei hilft, die nächste Tabakindustrie zu werden. Reizend.
»Dann werde ich den Partnern ausrichten, dass sie von Ihnen eine Bestleistung erwarten dürfen?«
»Ja.« Das ist mein Ticket zum Partner. Ich muss nur gute Arbeit leisten, so einfach ist das. Ein Rechtsanwalt braucht übrigens nicht immer zu gewinnen, um seine Sache gut zu machen. Gute Schadensbegrenzung ist ebenfalls wichtig, daher ist die Beilegung aussichtsloser Fälle in unserer Welt eine wertvolle Fähigkeit. Dieser Fall könnte auch so einer sein. Aber sollte ich tatsächlich gewinnen, Mann, das wäre wirklich beeindruckend. Marlin nickt, als er sicher ist, dass ich mit an Bord bin, dann wendet er sich zum Gehen.
Phil macht, dass er aus dem Weg kommt, und flieht vor Rhinos beträchtlicher Leibesfülle wie ein Insekt vor einer heranrasenden Windschutzscheibe. Marlin rauscht an dem mageren Praktikanten vorbei, als wäre er gar nicht da.
Phil schaut mich an. Der beeinflussbare junge Mann wartet auf meine Reaktion. Marlin gegenüber habe ich ein Pokerface bewahrt. Bei Phil lächle ich jedoch. Es gibt keinen Grund, mich zurückzuhalten – er ist nur Praktikant. »Ich habe den verdammten Jackpot geknackt!«
»Wie meinen Sie das?«
»Du wurdest gerade Zeuge, wie Karriere gemacht wird.«
»Mit nur einem Fall?«
»Jepp. Der Sieg im richtigen Fall ist wie die Verleihung des National Book Award – jeder in der Branche hört davon und will den Autor kennenlernen. Und die Partner haben mich auserwählt, dieses spezielle Kapitel der amerikanischen Rechtsgeschichte zu schreiben.«
»Haben Sie keine Angst, es zu vermasseln?«
Ich stoße ein verächtliches Lachen aus. Unverschämter kleiner teekochender Lümmel. »Ich gehöre zu den besten fünf Prozent. Ich habe vor gar nichts Angst.«
Monster
Ich reiße die Augen auf. Es ist dunkel. Ich rolle mich herum und schaue auf meinem Handy nach, wie spät es ist: ein Uhr früh. Verdammt. Als ich klein war, ist mir das oft passiert – ich bin mitten in der Nacht ohne erkennbaren Grund aufgewacht und konnte nicht wieder einschlafen. Ich muss schlafen. Morgen stürze ich mich in den Dampferfall.
Ich kneife die Augen zusammen und lasse den Blick durch die Kabine meines Bootes schweifen. Es ist so dunkel, dass ich nichts als Schatten erkennen kann. Die Lichter der Stadt, die hinter dem See im Nieselregen von Seattle verschwimmen, sind zu schwach, um meine Kabine durch das offene Bullaugenfenster zu beleuchten. Dunkle Wolken verdecken den Mond.
Was hat mich geweckt?
Der See ist wild heute Nacht. Der Wind aus dem Süden heult wie ein verängstigter Hund. Ich spüre, wie er auffrischt und in meine Richtung weht. Gleich darauf rauscht eine starke Böe zornig über das Wasser auf mich zu. Sie bringt mein Boot zum Schaukeln, und etwas kratzt oben übers Deck. Ein Stuhl? Nein, die Stühle habe ich vor zwei Tagen zusammengeklappt und weggeräumt. Eine Festmacherleine? Nein, die kratzt nicht, die knarrt. Ein Mann, der zur Kabinentür geht und ein Bein nachzieht? Das ist ein beunruhigender Gedanke. Manchmal überwinden Herumtreiber die Absperrung des Yachthafens, um Boote an ihren Anlegestellen auszurauben. Aber es gibt keinen Hinkenden; es ist der Wind, dessen bin ich mir zu neunzig Prozent sicher, daher werde ich hier liegen bleiben und nichts tun, während das Wasser an meinem schwankenden Heim leckt wie eine große, nasse Zunge.
»Es ist nur der See«, sage ich und bin überrascht, wie laut meine Stimme in der dunklen Kabine klingt. Mir wird bewusst, dass ich ein erwachsener Mann bin, der im Bett liegt und versucht, sich selbst zu beruhigen. Dumm, ich weiß. Da ist niemand bei mir oben an Deck, und ich spiele unter meiner Zweitausend-Dollar-Gänsedaunendecke von Nordstrom nicht Verstecken. Aber es widerstrebt mir trotzdem, aufzustehen und das Licht einzuschalten. Ich misstraue der Dunkelheit, schon seit meiner Kindheit. Dunkelheit ist der Inbegriff des Unbekannten, und etwas nicht zu kennen macht Kindern und Rechtsanwälten Angst.
Und dann spüre ich, wie sich etwas Schweres auf mein Bett setzt.
»Hallo, Danny.«
Mir bleibt fast das Herz stehen. »Scheiiii …?«
Das Geräusch, das aus meinem Mund kommt, soll das »Sch«-Wort sein – ein Wort, das ich als Kind nicht sagen durfte –, aber stattdessen kommt es wie ein Quieken heraus, und ich ziehe mir instinktiv die Decke über den Kopf. Nicht sehr erwachsen, ich weiß, aber so funktioniert Instinkt nun mal.
Die Stimme im Dunkeln wartet, bis ich mit Quieken fertig bin. Sie ist ruhig, ungezwungen und furchteinflößend, sogar unmenschlich – das leise Summen einer Wespe, die den Kopf umkreist. Und sie kennt meinen Namen.
»Komm unter der Decke hervor, Danny. Ich will mit dir reden.«
Wir Männer sehen uns oft als Actionhelden und schwelgen in Fantasien, wie viele Gegner wir erledigen würden, wenn wir uns in lebensbedrohlichen Situationen wie Banküberfällen und Flugzeugentführungen wiederfinden würden – oder zum Beispiel bei einem unangekündigten nächtlichen Besuch durch einen Eindringling. Wir malen uns aus, wie wir den Schurken, ohne zu fackeln, mit bloßen Fäusten windelweich prügeln. Aber so funktioniert das leider nicht. Wenn ein Raubtier aufs Bett kriecht, erstarrt man und hofft, dass es weggeht. Wie ein Reh oder ein Häschen. Wie ein Beutetier.
Ich bin nicht der Typ, der mit einer Waffe unterm Kopfkissen schläft. Leute, die eine Waffe zu Hause haben, haben ein doppelt so hohes Risiko, erschossen zu werden, wie Leute ohne Waffen. Blöde Statistik. Mein Handy liegt neben mir. In der Dunkelheit kann ich vielleicht danach greifen, ohne gesehen zu werden. Ich könnte den Eindringling mit dem Blitz blenden. Oder versuchen, jemanden anzurufen. Oder vielleicht ist ein Telefon auch nur das beruhigendste Gerät, an das ein moderner Mensch sich klammern kann. Ich lasse die Hand lautlos auf den Nachttisch gleiten. So weit, so gut. Nur noch ein paar Zentimeter und …
Etwas packt meinen Arm. Kalt. Rau. Reptilienhaft. Es legt sich um mein Handgelenk, und ich spüre, wie sich nadelfeine Spitzen in meine Haut bohren. Heiliger Gott, es ist eine Klaue! Ich versuche, die Hand zurückzureißen, aber das Ding hält sie fest wie ein Schraubstock.
Plötzlich begreife ich, was es ist. Ich weiß es, ohne hinzusehen, und ich sehe nicht hin. Ich kann gar nicht hinsehen – zu dunkel, zu verängstigt. Ich hatte recht – es ist kein hinkender Einbrecher. Es ist etwas Schlimmeres, etwas viel Schlimmeres. Ich kauere mich unter meinem luxuriösen Bettzeug zusammen, meiner altbewährten Rüstung. Mir ist klar, dass das nicht sonderlich erwachsen von mir ist, aber meine Bettdecke hat mich als Kind immer beschützt, wenn dieses Mistvieh aufgetaucht ist. Ich habe überlebt, indem ich mich vor ihm versteckt habe.
Es ist schwer. Sein Gewicht drückt die Matratze herunter, sodass meine Beine zu ihm hin rutschen. Es ist noch nie auf mein Bett gekommen. Es hat immer unter dem Bett gelauert oder im Schrank gewartet oder sich hinter meiner großen Spielzeugtruhe versteckt, oder es ist einfach in meinem Zimmer herumgewandert, aber es hat sich nie auf mein Bett gesetzt. Das ist neu. Das ist schlecht. Es hat mich auch noch nie zuvor gepackt. Natürlich war ich als Kind auch nie so blöd, die Hand unter der Decke hervorzustrecken. Mein erwachsenes Herz schlägt mir in der Brust bis zum Hals, während ich darauf warte, dass es mich unter meiner feinen Bettdecke hervor auf den Boden zerrt, wo es mich mit Sicherheit ausweiden und dann verschlingen wird.
Stattdessen sitzt es einfach nur da und hält meine Hand.
Diese verfahrene Situation beschwört lebhafte Erinnerungen an meine Kindheit herauf. Im Geiste sehe ich den Schatten der großen Spielzeugtruhe vor mir, die ich als Zehnjähriger jeden Abend mit zitternden Händen mit einem Vorhängeschloss versperrt habe, damit meine Werwolf-Actionfigur nicht herauskonnte, während ich schlief. Ich höre das Klicken der dämlichen Vampir-Uhr, deren spitzzähniger Bewohner um Mitternacht heraussprang, um mit schlechtem transsylvanischem Akzent »Guten Abend« zu sagen. In heißen Nächten pflegte meine Mutter in mein Zimmer zu kommen, während ich schlief; wenn ich aufwachte, stand mein Fenster offen, und die Vorhänge flatterten im Wind wie Zwillingsgeister. Heute Nacht habe ich mein Bullaugenfenster offen gelassen – so ist es hereingekommen. Ich schaudere. Ja, ich bin jetzt ein erwachsener Mann, aber ich fühle mich wie als Kind, wenn ich Angst hatte.
Ich weiß nicht, wie lange ich dort gelegen habe, erstarrt in seinem Griff. Eine Minute? Zehn? Im Dunkeln lässt sich die Zeit schwer einschätzen. Durch die Bewegung des Bootes und die Geräusche des Sturms kann ich nicht sagen, ob das Ding sich bewegt hat. Mein Arm ist von der verdrehten Haltung eingeschlafen. Als ich diese unbequeme Stellung schließlich nicht mehr halten kann, verändere ich vorsichtig meine Position.
»Ich kann das die ganze Nacht«, sagt es. »Das weißt du.«
Scheiße! Das ist keineswegs Angeberei. Einmal, als ich neun war, hat das Ding von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang auf meiner Kommode gehockt, ein großer, immer wacher, persönlicher Gargoyle. Er hat eine Höllengeduld, und er hat mich in der Hand. Er kann hier auf meinem Bett wie ein regloser Vogel sitzen, den Kopf zur Seite geneigt, und darauf warten, dass die Bettdecke verrutscht, damit er mir die Augen auspicken kann.
Es ist ein Monster. Mein Monster. Das weiß ich jetzt ganz sicher. Mein zehnjähriges Ich hat es gewusst, und dieser verängstigte kleine Junge hatte recht! Damals hat es mich nie erwischt, aber es hat all die Jahre gewartet, und jetzt ist es wieder da.
»Nein!«, rufe ich plötzlich. »Nein!« Ich versuche, trotzig zu klingen, aber ich schreie unter der Bettdecke.
»Nein, nein, nein!«, verhöhnt es mich, fast schon gelangweilt. »Scheiße, scheiße, scheiße. Igittigittigitt. Sei bitte still. Ich werde dich nicht fressen. Hör mich einfach an.«
Ich habe mein Handy fallen lassen, als es mein Handgelenk gepackt hat. Es war ohnehin ein lächerlicher Plan, die Bestie zu blenden, so was funktioniert nur im Film. Das Ding wartet jetzt wieder und hält geduldig meinen entblößten Arm fest. Es ist sinnlos, es austricksen zu wollen. Es weiß, wo ich bin. Es weiß, dass ich mich nicht wehren werde. Es weiß, dass ich zu große Angst habe, um die Decke zurückzuwerfen und zu fliehen. Es kennt mich. Persönlich.
»W … w … warum bist du wieder da?«, frage ich.
Ich bin beeindruckt, dass ich den Mut habe, meinen Peiniger direkt anzusprechen. Als Kind habe ich das Monster nie zur Rede gestellt, habe es nie besiegt. Das ist es! Ich muss es jetzt tun, als Erwachsener; das ist meine Buße dafür, dass ich es als Kind nicht geschafft habe, mich meiner größten Angst zu stellen. Ich träume natürlich, aber was nutzt einem diese Erkenntnis, wenn man nicht aufwachen kann? Ich konnte damals nicht aufwachen, und ich kann es auch jetzt nicht, da kann ich mich kneifen, so viel ich will. Ich muss da jetzt durch. Wenn man in einem Traum stirbt, stirbt man angeblich auch im echten Leben, daher wird man am Morgen vielleicht meine Leiche mit einem zersprungenen Herzen finden. »Er ist vor Angst gestorben«, wird der Sanitäter mit ernster Miene sagen. Stichwort für die Musik aus Twilight Zone.
Die Bestie wiederholt meine Frage und grübelt darüber nach. »Warum ich zurückgekommen bin? Hm. Ja, warum eigentlich? Nun, ich werde dir sagen, warum. Danny, ich brauche deine Hilfe.«
»Meine Hilfe?«
»Du bist doch jetzt Rechtsanwalt, oder? Einer der besten der Stadt, wenn die Gerüchte stimmen.«
»Ich bin Anwalt, ja.«
»Mann! Du warst immer schon schlau. Ein Weichei, aber schlau. Ich wusste, dass du etwas bringen würdest.«
»Es zu etwas bringen«, korrigiere ich ihn.
»Und immer noch ein kleiner Klugscheißer, wie ich höre. Aber egal. Ich bin nicht hier, um über die Vergangenheit zu reden.«
»Was?«
»Nimm die Decke runter, wenn du mich nicht verstehst. Verdammt, tu sie einfach weg. Das hier ist wichtig.«
Es ist ein Trick! »Die Decke bleibt, wo sie ist.«
Wenn ich sie wegnehme, wird das Ding mein Gesicht fressen. Ganz bestimmt. Ich werde diesen Traum einfach unter meiner Decke aussitzen, bis er zu Ende ist oder die Sonne aufgeht. Aber es hat immer noch meinen Arm. Was bedeutet das? Ich habe die Grundregel gebrochen; ich habe einen Arm rausgestreckt. Ich habe mich gezeigt und bin erwischt worden. Jetzt bin ich am Arsch. Dämliche Erwachsenenidee, nach dem Handy zu greifen. Wen wollte ich denn anrufen? Die Polizei? Stellen Sie sich meinen Notruf vor: »Hallo, ich stecke gerade mitten in einem Albtraum aus meiner Kindheit, könnten Sie bitte einen Streifenwagen vorbeischicken, damit er auf dem dritten Boot an Anleger zwölf nach dem Rechten sieht? Ich bin der erwachsene Mann, der sich unter der Bettdecke versteckt.«
»Danny, ich habe deinen Arm. Wenn ich ihn loslasse, redest du dann mit mir, von Mann zu Mann?«
»Du bist kein Mann.«
»Dann eben von Mann zu Bestie. Von Mann zu mir.«
»Gib mir meinen Arm wieder.«
»Abgemacht.«
Er hält Wort und lässt meinen Arm los. Ich reiße ihn überrascht unter die Decke und taste ihn nach Verletzungen ab.
»Alles klar zwischen uns?«, sagt es.
»Das ist nicht genug.«
Ich kann es verärgert knurren hören. »Okay, ich werde dir das ultimative Friedensangebot machen.«
»Und das wäre?«
Ich spüre, wie die Matratze sich hebt, als die schwere Kreatur aufsteht. Dann höre ich die Krallenfüße über den Kabinenboden kratzen. Es klingt genau wie das Scharren oben auf dem Deck. Hab ich’s doch gewusst! Es war nicht der Wind. Unter der Decke höre ich ein vertrautes Klicken auf der anderen Seite des Raums – das Geräusch, das der Lichtschalter an der Kabinenwand neben der Luke macht, wenn man ihn umlegt. Mein Gott, das Ding, das sich während meiner ganzen Kindheit im Dunkeln versteckt hat, um mich zu quälen, hat gerade das Licht angemacht!
»Ist das dein Ernst?«, frage ich.
»Ja.«
»Aber nicht Buh machen.«
»Ich mache nicht Buh.«
»Ohne Scheiß. Wenn du mich erschreckst, ist dieses Gespräch vorbei.«
»Ich erschreck dich nicht, Ehrenwort. Kleiner-Finger-Schwur.«
»Fick dich! Das ist nicht lustig.«
»Nein, du hast recht. Es wird höchste Zeit, dass wir reden, Danny.«
»Bleib da drüben.«
»Gut. Hier bin ich.«
Ich spähe durch die Finger. Es ist ein Moment, um sich in die Hose zu machen. Ich kann immer noch nicht gut sehen. Im Raum ist es jetzt hell, und meine Augen müssen sich erst an das Licht gewöhnen, aber ich kann erkennen, dass neben der Luke zum Deck etwas auf zwei Beinen hockt. Es ist eine schauerliche Silhouette mit mächtigen Schultern und breiten Hüften, die durch eine unglaublich schmale Insektentaille verbunden sind. Ein großer, schräger Kopf. Lange, tief herabhängende Arme, die in Klauen enden. Mein Monster. Ich sitze immer noch in der Kabine meines Bootes fest – das Monster blockiert den einzigen Ausgang –, aber wenn es zuschlägt, werde ich genug Zeit haben, mir wieder die Decke über den Kopf zu ziehen. Es bleibt, wo es ist. Meine Pupillen verengen sich, und dann sehe ich es zum ersten Mal in meinem Leben klar und deutlich.
Bisher habe ich nur kurze Blicke auf das Monster erhascht – kriechende Schatten, durchsetzt mit aufblitzenden Krallen, wogendem Fell oder dem Schimmer leuchtend grüner Augen. Den Rest hat immer meine Fantasie ergänzt. Jetzt steht es hell erleuchtet und offen da. Mir kommt der Gedanke, dass es sich entblößt fühlen muss, so wie ich, wenn ich zum Bett gerannt bin, nachdem ich das Licht ausgeschaltet habe. Gut. Geschieht ihm recht. So ist es nicht ganz so furchteinflößend. Es ist immer noch schrecklich, da gibt es kein Vertun. Aber es ist nicht so … unbekannt.
»Okay, rede«, sage ich. »Und ich hoffe, dass du dich dafür entschuldigen wirst, dass du mich jahrelang in meinen Träumen gequält hast. Denn genau dorthin verbannt dich jetzt mein erwachsenes Ich für immer. Das Licht geht endlich an, und du schrumpfst zu nichts.«
Aber mein Monster schrumpft nicht. Ich sehe, wie es sein sabberndes Maul öffnet. Speichel tropft mit einem feuchten Platschen auf die Holzplanken meines Bootes. »Ich fürchte, nein«, schmatzt es. »Ich stecke nämlich in leichten Schwierigkeiten. Die Sache ist die, man wirft mir etwas vor, das ich nicht getan habe. Und, nun ja … Ich brauche einen Anwalt.«
»Wer klagt dich an?«
»Die Behörden.«
»Welche Behörde? Die Polizei von Seattle? Interpol? Wer?«
»Größere Mächte in meinem Reich. Echter übernatürlicher Scheiß. Du würdest es nicht verstehen, jedenfalls jetzt noch nicht.«
»Okay, und was wirft man dir vor? Erschrecken ohne Lizenz?« Ich muss zugeben, dass ich mich langsam ein wenig entspanne und mich zum ersten Mal in dieser Nacht amüsiere.
»Ich soll ein Mädchen getötet haben.« Es runzelt die Stirn. »Ich soll es angeblich in seinem Bett gefressen haben.«
Nicht witzig. Um ehrlich zu sein, es raubt mir den Atem zu hören, dass das Monster, das mich als Kind verfolgt hat, im Verdacht steht, Kinder zu töten. »Wahrscheinlich hast du es wirklich getan«, sage ich ernst und ziehe mir die Decke wieder bis ans Kinn.
»Ich habe es nicht getan, das versichere ich dir!« Es ist jetzt ganz aufgeregt, geht auf und ab, öffnet und schließt die Krallen. Seine Reißzähne klappern aufeinander, lauter als der Wind draußen. Es ist nicht zornig. Es wirkt eher, als wäre es verzweifelt. Ich ermahne mich, dass verzweifelte Tiere die gefährlichsten sein können. Es bleibt stehen und wirft frustriert die Arme hoch. »Wenn ich nicht beweise, dass ich es nicht getan habe, wird man mich für tausend Jahre in eine Flasche sperren. Eine kleine, wie eine Shampooflasche. Reisegröße. Du bist Rechtsanwalt. Du solltest mich für unschuldig halten, bis meine Schuld bewiesen ist.«
»Das gilt für Geschworene, nicht für einen Rechtsanwalt. Ich beurteile einen Fall auf Grundlage der Fakten, und die Fakten sind nun mal die, dass du junge Menschen verfolgst und mit sämtlichen körperlichen Werkzeugen eines Fleischfressers ausgestattet bist.«
»Komm schon, Mann, ich habe dich nicht gefressen, obwohl ich oft genug Gelegenheit dazu gehabt hätte.«
»Das ist nicht beruhigend.«
»Ich kenne dich, Danny. Du warst ein guter Junge. Du hast immer anderen geholfen und das Richtige getan. Ich weiß noch, wie du einmal eine Brieftasche mit zwanzig Dollar darin gefunden und sie ein Jahr lang aufbewahrt hast, nur für den Fall, dass der Besitzer auftauchte. Du hattest einen starken Gerechtigkeitssinn.«
»Ich bin nicht mehr dieser Junge.«
Die dicke Braue über seinem gelben linken Auge zuckt, dann sackt sein grotesker, missgebildeter Körper zusammen. Wenn man einen traurigen Werwolf mit einer Gottesanbeterin kreuzen würde, dann würde das Ergebnis ungefähr so aussehen wie das, was da an meiner Bootsluke schmollt. In dem Moment wird mir klar, dass ich nicht mehr so große Angst vor ihm habe. Ich verlasse noch nicht mein Bett – so weit sind wir noch nicht –, aber jetzt, da ich etwas über das Monster weiß, kann ich zumindest den Mut aufbringen, mich ihm zu stellen, wenigstens verbal. Ich habe »nein« zu ihm gesagt. Es schaut für einen Moment zu Boden, als würde es über schlechte Lebensentscheidungen nachsinnen, dann spricht es wieder.
»Hör zu, du bist der Einzige, den ich kenne, der mir helfen kann. Ich habe nicht viele Freunde.«
»Natürlich nicht. Du bist ein Arschloch. Und du bist nicht echt. Außerdem bin ich nicht dein Freund. Was immer du getan hast, es geht auf deine Kappe. Ich werde jetzt weiterschlafen, und wenn ich aufwache, wirst du einfach nur eine unwillkommene Erinnerung sein.«
Es starrt mich einen Moment lang an, dann nickt es; keine Ahnung, warum. »Du wirst mir helfen, Danny, weil du weißt, dass ich unschuldig bin. Und wenn du darüber nachdenkst, wirst du wissen, warum.«
Mit diesen Worten macht es das Licht wieder aus. Scheiße! Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal Angst kriegen könnte, aber ich gerate fast in Panik, als ich es durch den Raum huschen höre. Dann sehe ich, wie sein Schatten sich dem Bullauge nähert, und es ist fort.
Ein neuer Tag
Der Klingelton meines Digitalweckers ist das Gebell des Nachbarhundes in meinem alten Haus in Wallingford. Der Hund, ein panischer schokoladenbrauner Labrador, brüllte frei übersetzt: »Da, genau da! Sieht denn niemand diese beschissene Krähe auf unserem Zaun? Sie ist doch genau vor eurer Nase! Wuff-Wuff-Wuff-Wuff-Wuff!« Lucy und ich haben diesen hysterischen Hund als Vater-Tochter-Scherz aufgenommen, als sie mir geholfen hat, den Wecker einzustellen. Der Scherz geht auf meine Kosten. Lucy wohnt jetzt bei ihrer Mom, und ich weiß nicht, wie ich das verdammte Ding anders einstellen kann. Technik wird an der juristischen Fakultät nicht gelehrt. Meine Ex-Frau hätte gewusst, wie es geht. Sie hat an der Universität von Winnipeg Computerprogrammierung studiert, als das Fach noch eine Männerdomäne war. Klug. Zu klug, um bei mir zu bleiben. Das Positive daran war, dass ich von ihr einiges übers Scheidungsrecht gelernt habe.
»Ist ja gut, Hund, ich bin wach«, brumme ich.
Ich hatte eine Scheißnacht. Verrückte Albträume. Am liebsten würde ich im Bett unter der Decke bleiben, aber der Hundewecker meiner Tochter zwingt mich, aufzustehen und mich der Welt zu stellen. Er ist meine Version der Glocke im Boxring, und ich kämpfe jetzt schon fünfzehn Jahre jeden Werktag und die meisten Wochenenden mit ihm. Mein Handy ist weg. Ich krieche auf dem Boden herum wie der Hund in meinem Wecker, wenn er die Witterung von Eichhörnchen aufgenommen hat. Das verflixte Ding muss während des Unwetters vom Nachttisch gefallen sein. Es war ein heftiger Sturm. Das Boot schaukelt heute Morgen immer noch – der Wind hat sich noch nicht gelegt. Mir ist leicht übel. Das Leben auf dem Lake Union ist nicht so romantisch, wie es sich anhört, glauben Sie mir. Aber das Boot hat nur ein Zehntel dessen gekostet, was ich für das Haus meiner Frau in Wallingford hingeblättert habe, und es ist das Immobilienäquivalent eines Schokoriegels im Kleinformat, daher hält es mich davon ab, zum Hamsterer zu werden. Außerdem habe ich es nicht weit zum Büro.
Der Holzboden ist kalt, aber wenigstens ist er fest und real. Ich brauche Koffein. Ich werde mir über dem Campingkocher Teewasser heiß machen müssen – der Herd funktioniert nicht. Die Kabine ist für ein Boot dieser Größe geräumig. Licht fällt durch das offene Bullauge herein, himmlische Strahlen, die den Morgennebel in Bänder zerschneiden. Ich werde im Fitnessstudio des Belltown Tower duschen. Die meisten meiner Kleidungsstücke befinden sich drei Meilen entfernt in einem Lagerraum. Zwei Anzüge und eine Handvoll weißer Hemden hängen in dem kleinen Schrank, viel mehr passt nicht hinein. Meine Jacketts hängen an der Rückseite meiner Tür im Büro. Aber ich habe eine Menge Krawatten, einen ganzen Korb voll davon, in dem sie wie in einer bunten Schlangengrube durcheinanderliegen. Wenn man genug verschiedene Krawatten hat, kann man den Anschein eines wohlgefüllten Kleiderschranks vermitteln. Und niemand merkt es, wenn man wie ich jeden Tag dieselben Schuhe trägt.
Heute werde ich zu spät zur Arbeit kommen. Das ist sorgsam geplant. Ich wähle jede Woche einen Tag dafür aus und stelle sicher, dass die Partner mitbekommen, dass ich abends länger bleibe, um die Zeit nachzuholen. Heute werde ich später kommen, weil Lucy ein Fußballspiel hat, und die verpasse ich nie. Eine Beziehung zu meiner Tochter zu haben ist mein anderes Lebensziel. Im Grunde habe ich dieses Ziel in dem Moment erreicht, in dem sie geboren wurde, aber sie verändert sich ständig, vor allem jetzt, da sie ein Teenager ist, daher ist es eine permanente Aufgabe. Eigentlich soll ich nicht zu ihren Spielen gehen. Ein Teil des scheidungsbedingten Erziehungsplans weist diese Zeit meiner Frau zu. Aber ich liebe Fußball, und ich tue nichts lieber, als Lucy spielen zu sehen. Ich mache es so: Der Parkplatz vor der Fußballanlage bietet einen guten Blick auf das Spielfeld. Ich fahre mit einem Gebrauchtwagen hin, den niemand kennt, und schaue von der anonymen Behaglichkeit des Vordersitzes aus zu.
Unsere Kanzlei hat mal einen Gebrauchtwagenhändler namens Victor Gianopoulos vertreten, der ein kleines Steuerproblem mit dem Staat hatte. Und mit der Stadt. Und auch mit der Bundespolizei. Na jedenfalls, ich habe seinen Fall bearbeitet. Ich habe ihn vom Großteil seiner Probleme befreit, doch nach den ganzen Bußgeldern hatte er ein wenig Mühe, seine Anwaltsgebühren zu bezahlen. Also habe ich mit ihm die kostenlose Nutzung seiner Gebrauchtwagen ausgehandelt; entweder auf Lebenszeit oder bis er pleitegeht. Wenn ich einen brauche, gehe ich einfach auf den Parkplatz und suche mir einen aus. Es ist ein toller Deal – ich brauche in der Stadt kein eigenes Auto, und Victor hat alle Autos auf dem Platz für »Testfahrten« versichert, sodass ich auch keine Versicherung zu zahlen brauche. Heute nehme ich einen schwarzen Cadillac Escalade mit getönten Scheiben. Er sieht aus wie ein Regierungsfahrzeug von der CIA, vor allem, da ich eine Sonnenbrille tragen werde, die im regnerischen Seattle grundsätzlich ein verdächtiges Accessoire ist. Victor runzelt die Stirn. Er denkt immer, dass das Auto meiner Wahl an dem Tag verkauft werden wird, und drängt mich mit seinem griechischen Akzent, mir ein anderes auszusuchen. Das tue ich nie. Wenn ich mich von ihm beschwatzen lasse, weniger zu nehmen als das, was ich ausgehandelt habe, wird sich die Abmachung zu seinen Gunsten verändern. Das ist eine Anwaltsregel – wenn man nicht auf sein Recht pocht, verliert man es.
Der vierundzwanzig Hektar große Fußballkomplex ist ein surreales, in sich geschlossenes Fußballuniversum. Drei Parkplätze, sechs Imbisswagen, zweiunddreißig saubere Dixi-Klos und vierundzwanzig Fußballfelder für die Junioren. Es ist der Heimatplatz des Crossfire Fußballclubs. Es gibt zehn Firmensponsoren, darunter Microsoft, Amazon, Lookbook und Bi-Di, Seattles große Technik-Schwergewichte. Ihre riesigen Schilder hängen an den Maschendrahtzäunen rings um die Spielfelder, während Gruppen herumlaufender Kinder ihnen als wandelnde Reklametafeln dienen: Firmenlogos prangen auf ihren Uniformen wie geometrische Parasiten – farbige Quadrate für Microsoft, ein gebogener Pfeil für Amazon, verschlagene Augen für Lookbook und die miteinander verschmolzenen Buchstaben d und b von Bi-Di. Ich frage mich immer noch, wie zum Teufel sie es geschafft haben, zwei Kleinbuchstaben markenrechtlich schützen zu lassen. Unser eigenes Schild von Fury und Styles hängt neben den Technikbannern und ist fast genauso groß. Frances Fury, die Partnerin, die für das Management verantwortlich ist, ist eine große Anhängerin und Förderin, Gott segne ihr philanthropisches Herz. Sie hat ihre eigenen Kinder seit deren achtem Lebensjahr durch das sorgfältig aufgebaute Crossfire-Fußballsystem geschleust, und nun durchlaufen ihre Enkel das Programm. Sie sitzt sogar im Vorstand von Crossfire.
Die Größe der Spielfelder ist den Altersklassen der Spieler zwischen acht und achtzehn Jahren angepasst. Das Können reicht von Freizeitkickern, die einfach nur schießen und rennen, bis hin zu der statistisch unbedeutenden Zahl ultra-ehrgeiziger Kinder, die in einem überfüllten Strafraum eine Ecke mit dem schwachen Fuß in einen Fallrückzieher verwandeln können. Sie werden umgehend in die Mannschaft der Seattle Sounders Development Academy aufgenommen und auf eine mögliche Profikarriere vorbereitet. Von den Tausenden, die hier durchgeschleust werden, hat es vielleicht sieben oder acht von diesen potenziellen Profis gegeben, aber keiner von ihnen hat es tatsächlich in die Profimannschaft von Sounders geschafft. Lucy befindet sich da irgendwo in der Mitte.
Ich parke den Escalade am Ende von Platz 5 zwischen einem Honda-Odyssey-Minivan mit Aufklebern einer Zeichentrickfamilie, die von einem T-Rex gejagt wird, auf der Heckscheibe und einem höhergelegten GMC-1500-Truck, dessen Räder die Größe von Treckerreifen haben. Diese Wagen bieten mir gute Deckung. Ich kurbele die Fenster herunter, um das Spiel zu hören. Eve, meine Ex-Frau, sitzt fünfunddreißig Meter entfernt mit einem roten Tuch um den Kopf. Nach der Scheidung hat sie ihren Stil geändert, irgendwie Pseudohippie, pseudoprogressiv. Merkwürdig. Als wir noch das Musterbeispiel eines Karrierepaars unserer Generation waren, hat sie das Kanzleileben mit Anzug und Krawatte geliebt. Sie sitzt auf einem Klappstuhl am Spielfeldrand, zu weit entfernt, um mich durch den Maschendrahtzaun, die getönte Windschutzscheibe und die Sonnenbrille zu erkennen. Hoffe ich jedenfalls. Links und rechts wird sie von anderen Müttern flankiert. Kein Mann. Noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie es mir damit geht. Vor allem bin ich erleichtert, dass ich mich heute nicht damit auseinandersetzen muss, wie es mir damit geht. Ich hatte eine harte Nacht.
Ich lehne den elektrisch verstellbaren Sitz zurück und mache es mir bequem, um mir das Spiel anzusehen. Lucy spielt außen, eine Position, wo der Spieler Zeit zum Nachdenken hat, anders als im Mittelfeld, wo es schnell und heftig zugeht. Sie ist klein, wie ich es in dem Alter war, und ihre »Fußballintelligenz« ist wahrscheinlich ihre beste Waffe. Sie trifft gute Entscheidungen. Ich hoffe, dass das auch für außerhalb des Fußballplatzes gilt. Sie hat jetzt fast das Alter erreicht, in dem sie Dates haben wird. Ich bin mir auch nicht sicher, wie es mir damit geht. Ich lasse den Blick über die Zuschauer an der Seitenlinie schweifen und suche nach möglichen festen Freunden. Es ist eine andere Art von Eifersucht – die halb besorgte, halb unsichere Art, wenn eine Tochter anfängt, Jungs mehr zu mögen als ihren Dad. Zwei junge Burschen in ihrer Altersklasse lümmeln im Gras, aber da die Mannschaft aus achtzehn Mädchen besteht, sind die Chancen gering, dass sie wegen Lucy hier sind. Sie könnten auch einfach nur Brüder sein.
Das Spiel beginnt. Die andere Mannschaft ist stark. Sie spielt nicht so gut, aber härter, schneller, mit mehr Körpereinsatz. Wir liegen schnell ein Tor im Rückstand. Mist. Aber Lucy ist gut. Sie ist flinker als die stämmige Linksverteidigerin der anderen Mannschaft und lässt sich nicht einschüchtern. Mit einem Eckstoß bereitet sie das Kopfballtor ihrer Stürmerin vor und sorgt damit für den Ausgleich. Braves Mädchen. Ich messe Lucys Spiel an zwei verschiedenen Erfolgskriterien, wenn ich ihr zusehe. Nummer eins: Die Mannschaft gewinnt, und Lucy spielt gut. Nummer zwei: Lucy hat Spaß. Heute ist bisher an allen Fronten ein guter Tag.
Es geht hin und her. Die gegnerische Mannschaft liegt einen Tabellenplatz vor uns, und der Frust wächst. Lucy erhält einen Pass hinter der dicken Linksverteidigerin. Eine andere Verteidigerin in der gegnerischen Hälfte befindet sich näher an der Torlinie, es ist also nicht abseits. Lucy rennt los, direkt auf mich zu, ihre Gegnerin hinterher. Sie ist schneller, aber sie lässt das dicke Mädchen glauben, dass es sie einholen wird. Ich kenne diese Taktik – Lucy wird den Ball in die Mitte zurückspielen, wo man einen besseren Schusswinkel aufs Tor hat. Es ist die pure Freude zu sehen, wie meine Tochter zwei Schritte vorausdenkt, wie sie einer Tänzerin gleich mit dem Ball über den Platz schwebt, Haken schlägt und …
Die Dicke knallt voll in meine Tochter rein. Das ist keine Ballabnahme, es ist eine Ganzkörperblockade. Lucy fliegt durch die Luft und schlägt hart auf dem Boden auf. Heilige Scheiße! Der Schiedsrichter ist sofort da und pfeift ab. Danke, Schiri. Es folgt ein angespannter Moment, in dem ich darauf warte, dass Lucy aufsteht, das allgemein gültige Zeichen dafür, dass sie unverletzt ist. Ich brauche nicht lange zu warten. Sie kämpft sich auf die Füße, bevor man sie bemitleiden kann. Zähes Mädchen. Puh! Enttäuschendes Ende für einen guten Gegenangriff, aber zumindest bedeutet es für sie nicht das Ende der Saison. Allerdings ein verdammt hartes Foul. Ich frage mich, ob … Der Schiedsrichter redet mit dem anderen Mädchen. Jepp! Da ist die Karte. Gelb. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan.
Eine fette Frau in der Nähe johlt. Zuerst denke ich, dass sie meiner Tochter Beifall klatscht, weil es Tradition und höflich ist zu klatschen, wenn ein verletzter Spieler aufsteht. Aber es gibt keine Verletzung. Seltsam. Jetzt brüllt sie: »Gut gespielt« und »Toll gemacht!«, und dann wird mir klar, dass sie gar nicht für Lucy jubelt. Sie ist die Mutter des dicken Mädchens. Sie ist auch dick. Und aggressiv. Starke Ähnlichkeit. Es besteht kein Zweifel. Außerdem sitzt kein Ehemann neben ihr – ebenso wenig wie bei meiner Frau. Sie brüllt immer noch wie eine Kuh. »Gut gespielt! Gut gespiiiielt!«
Meine getönte Scheibe ist bereits unten, und sie ist in Rufweite. »Entschuldigung«, spreche ich sie höflich an. Ich brauche drei Versuche, bevor sie sich zu mir umdreht und mich mit offenem Mund angafft, eine dunkle, substanzlose Höhle. Als ich ihre Aufmerksamkeit habe, fahre ich fort: »Wenn ein Spieler eine gelbe Karte sieht, ist das ganz sicher kein gutes Spiel. Es ist ein Vergehen, für das die Mannschaft bestraft wird.«
»Ich weiß, was eine gelbe Karte ist«, blafft sie. Es erstaunt mich immer wieder, wenn Kotzbrocken noch einen drauflegen und diejenigen anschreien, die sie davon abbringen wollen, sich wie ein Kotzbrocken aufzuführen.
»Dann wissen Sie ja, dass man dafür keinen Beifall klatscht.«
»Wer sind Sie, der Parkplatzwächter?« Sie schnaubt, als wäre das witzig. Ist es nicht.
»Ich bin der Vater der Spielerin, gegen die Ihre Tochter sich unsportlich verhalten hat. Und da Ihre Tochter die Regeln nicht zu kennen scheint, dachte ich, ich sag es Ihnen, damit Sie es unterlassen können, Ihre Tochter in ihrer irrigen Meinung und ihrem mangelnden Sportsgeist zu bestärken. Sie könnten durchaus etwas lernen. Sie lernen von mir, bei einem Foul nicht zu jubeln.«
»Die Kleine?« Sie sagt »klein« auf eine Weise, die Minderwertigkeit aufgrund von Körpergröße impliziert. Ich habe das schon mal gehört. Von größeren Kindern, als ich klein war. Von Schlägern. Ich mag Schläger nicht. »Es war wirklich ein gutes Spiel«, sagt sie, wenn auch mit weniger Überzeugung. »Meine Tochter hat den Lauf gestoppt.« Sie sieht eine andere Mutter neben ihr hilfesuchend an, die sich klugerweise raushält.
»Ach, tatsächlich?«, antworte ich. »Es ist ein gutes Spiel, weil sie einen Sololauf brutal gestoppt hat? Großer Gott! Und dabei ist der wirkliche Grund, warum sie meine Tochter von hinten angegriffen hat, der, dass meine Tochter sie besiegt hat und sie dumm dastehen ließ. Aber loben Sie nur weiter ihre Aggressivität, damit sie ja keine goldene Gelegenheit verpasst, einer Mitspielerin das vordere Kreuzband zu zerreißen. Bravo! Sie haben sich wirklich als Mutter bewährt, Sie fette Sau.«
Ich hätte nicht »fette Sau« sagen sollen. Ich hätte überhaupt nichts davon sagen sollen. Ich blicke auf. Die Leute starren mich an. Ich bin aus dem Wagen ausgestiegen und habe es nicht einmal bemerkt. Ich benutze außerdem meine laute Stimme, meine Gerichtsverhandlungsstimme. Und Mama Fetti … weint. Scheiße! Die Spielerinnen, die im nahen Strafraum stehen, starren mich an. Der Schiedsrichter starrt mich ebenfalls an. Selbst die dreißig Meter entfernten Eltern an der Seitenlinie starren mich an, was bedeutet, dass Eve mich auch anstarrt. Und Lucy.
Ich springe zurück auf den Fahrersitz des Escalade. Meine Sonnenbrille ist mir halb von der Nase gerutscht. Ich ignoriere den Sicherheitsgurt und taste nach dem Startknopf, aber ich bin mit dem Wagen nicht vertraut und schalte stattdessen die Scheinwerfer ein. Sie beleuchten die weinende Frau wie ein Punktstrahler. Verdammt!
Als es mir gelingt, den SUV anzulassen, kommt ein Fußballoffizieller in einer gelben Weste auf mich zu. Sein Auftreten und seine Kleidung verleihen ihm etwas von einem Militärpolizisten. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn nun bin ich derjenige, der gleich einen Vortrag über Erziehung zu hören bekommen wird. Nein, werde ich nicht, denke ich, lege den Rückwärtsgang des Escalade ein und stoße kiesspritzend zurück, wobei ich den Spiegel des Vans neben mir absäbele. Wahrscheinlich ist es Fettis Wagen, denn sie ist genau der Typ für geschmacklose Aufkleber auf der Heckscheibe. Der Spiegel des Escalade ist auch kaputt und hängt an den Drähten herunter. Mann, wird Victor sauer sein.
Zu spät
Die Schwingungen in der Innenstadt sind anders, wenn man zu spät zur Arbeit kommt. Ich bin zu Fuß schneller als die Autos in der verstopften Straße. Zwei Teslas und drei Nissan Leafs hintereinander – die reichen und die armen Versionen der Elektroautos, die die Technikszene von Seattle am liebsten fährt. Es ist schon unheimlich, wie die Elektroautos verstummen, wenn sie stehen bleiben – kein Benzinmotor im Leerlauf. Die Autoschlange kriecht im Schritttempo voran, aber die Fahrer bleiben seltsam höflich und respektvoll. Es ist ein Nordwest-Ding – die Leute fahren hier nicht aggressiv oder hupen ständig wie in Boston oder New York City an der Ostküste. Kaffeetragende Fußgänger drängen sich an den Ecken von Elliot Ave, Broad Street und Battery Street. Jede Menge formlose Pullis und weite Hemden über T-Shirts. Nur sehr wenige Frauen in Kostümen oder Hosenanzügen. Noch weniger Krawatten bei den Männern – sie tragen eher Mützen. Seattle kleidet sich nicht gut.
Es ist nicht wie an den Tagen, an denen ich früh unterwegs bin. Dann sausen überraschend wenige Autos die steilen Hügel von Seattle hinauf und hinab, und es schlendern nur vereinzelte ehrgeizige Typen wie ich über die nassen Bürgersteige, um der Konkurrenz zuvorzukommen. Wir tragen Anzüge. Wir trotten an Ladenbesitzern vorbei, die sich auf den Tag vorbereiten, an ein paar Schichtangestellten, die zu den seltsamsten Stunden arbeiten, und an vereinzelten Obdachlosen, die zum Schutz vor dem Regen in Hauseingängen schlafen.
Ich gehe zügig durch die langsamere Menge. Eine Gruppe älterer Frauen bedenkt mich mit frostigen Blicken, als ich sie überhole – in dieser Stadt gilt es als unhöflich, sich vorzudrängeln. Als ich am Belltown Tower ankomme, habe ich deswegen und wegen meiner Verspätung ein schlechtes Gewissen. Meine Schlüsselkarte funktioniert beim ersten Mal nicht, und auch nicht beim zweiten Versuch. Ich fluche laut. Einer unserer Stamm-Obdachlosen späht mir über die Schulter und meint, dass ich sie verkehrt herum halte. Ich schaue hin. Er hat recht. Ich bedanke mich bei ihm und gebe ihm drei Dollar, genug für einen kleinen Kaffee. Er bedankt sich seinerseits bei mir. Wir nicken einander zu und sehen uns für einen Moment an, und jeder fragt sich, wie er da gelandet ist, wo er ist.
Ich hatte nicht vor, Rechtsanwalt zu werden. Es ist irgendwie passiert. Ein Freund von mir hatte ein Buch, wie man sich auf die Aufnahmeprüfung der juristischen Fakultät vorbereitet. In dem Buch gab es hinten eine Tabelle, der man entnehmen konnte, welche Universitäten einen mit guten Prüfungsergebnissen aufnehmen würden. Ich bin gut in Prüfungen, also sagte ich: »Ich wette, das schaffe ich.« Und ehe ich mich’s versah, hatte ich das Examen zur Zulassung zur Anwaltschaft abgelegt. Rückblickend hätte ich etwas anderes tun sollen, irgendetwas anderes, aber jetzt, zwei Jahrzehnte später, ist es zu spät für mich, noch den Beruf zu wechseln.
Zu spät. Der Aufzug fährt immer langsam, wenn man es eilig hat. Ich muss im Umkleideraum im Keller duschen und mich umziehen. Ich stelle fest, dass ich heute Morgen auf dem Boot die falsche Krawatte ausgesucht habe. Sie beißt sich mit der Farbe meiner Hose. Und nicht nur das, es ist auch noch eine Weihnachtskrawatte. Mit Elfen. Und der Dezember liegt in weiter Ferne. In meinem Schlafzimmer war es dunkel, als ich heute Morgen danach gegriffen habe, und ich war abgelenkt von diesem Traum – diesem verdammt seltsamen Traum. Was hatte das alles zu bedeuten? Hing es mit meiner Kindheit zusammen? Mit meinem großen Fall? Meiner kaputten Ehe? Eve würde es als Omen oder als Zeichen oder sonst einen Schwachsinn deuten; für einen Computernerd ist sie seltsam abergläubisch geworden – das hat sie von der Kultur in ihrem Büro. Aber ich glaube nicht an diesen Kram. Meiner Meinung nach sind Träume nur ein wahlloses Wirrwarr übrig gebliebener oder unvollendeter Gedanken, die unser Verstand zu sortieren versucht und in eine zusammenhängende Erzählung presst – wie die übrig gebliebenen Punkte auf der mentalen Checkliste des Tages, die unser Gehirn sich selbst erklären und durchstreichen muss.
Die Aufzugtüren öffnen sich, und ich gehe mit langen Schritten in die Lobby. Miriam blickt auf und wirft mir ein gequältes Lächeln zu. Oh-oh.
»Was ist?«, frage ich ohne Begrüßung.
Sie mustert mich. »Geht es Ihnen gut?«
»Ja. Wieso?«
»Phil meinte, Sie hätten einen Autounfall gehabt und seien deshalb spät dran.«
»Einen Autounfall …« Das ist verwirrend. Klar, ich habe einen Spiegel verloren, aber das war doch kein Unfall. Und woher wusste Phil das überhaupt? Und warum sollte mein Praktikant mein Zuspätkommen entschuldigen? »Jetzt, da ich hier bin, ist alles in Ordnung mit mir. Ich habe alles im Griff.«
Aus ihrem gequälten Lächeln wird ein Stirnrunzeln.
»Stimmt etwas nicht, Miriam?«
»Alles bestens«, beteuert sie. Aber sie klopft nervös mit dem Bleistift auf den Tisch, wie immer, wenn sie lügt. Ich habe sie dabei gesehen, wenn Mandanten am Telefon sind und fragen, ob ein Partner zu sprechen sei, und sie ihnen mitteilt, der Partner befände sich in einer Besprechung, obwohl er in Wirklichkeit nur einen halben Meter entfernt steht und abwinkt und mit den Lippen das Wort »Nein« formt.
»Miriam, wir sind doch ein Team, oder? Spannen Sie mich nicht auf die Folter. Was ist passiert?«
Sie rutscht auf ihrem Stuhl herum, als müsste sie pinkeln, dann sprudelt alles gleichzeitig aus ihr hervor. »Die Dampfermandanten sind da. Ich habe Sie dreimal auf dem Handy angerufen, aber Sie sind nicht drangegangen.«
Dafür gibt es einen guten Grund – ich habe es verloren. Es lag nicht auf dem Boden, wo ich es im Traum der vergangenen Nacht habe fallen lassen, und unter dem Bett war es auch nicht. Als wäre der Tag nicht schon beschissen genug.
»Was? Sie hatten einen Termin für Donnerstag. Warum sind sie heute schon da?«
»Sie sind nervös. Sie wollten sofort mit jemandem sprechen. Sie sind vor fünfzehn Minuten eingetroffen.«
»Scheiße! Ich muss mich fertig machen.« Ich setze den ersten Schritt in den Flur, aber Miriams Stimme lässt mich erstarren.
»Es, ähm, spricht bereits jemand mit ihnen.«
»Was? Wer? Wally? Rhino?«
Rhino ist mein Spitzname für Goucher. Normalerweise bringt es Miriam zum Lachen. Heute nicht.
»Bricklin.«
Doppelscheiße. Unsere Rezeptionistin und Mädchen für alles senkt den Blick und schiebt Papiere herum. Sie weiß, dass das schlecht für mich ist. Wenn die Mandanten sich mit Bricklin wohlfühlen und möchten, dass sie sie vertritt, könnte mein Fall, der mich zum Partner machen soll, im Handumdrehen an meine Todfeindin gehen.
»Das werde ich gleich klären«, sage ich zu Miriam und schenke ihr ein gewinnendes Lächeln. Aber es steht kein Gefühl dahinter, und wahrscheinlich kommt es so unecht rüber, wie es ist. Ich fliehe aus der Lobby.
Phil wartet hinter der Ecke, um mich abzupassen. Ich weiche ihm aus, doch er kapiert den Wink mit dem Zaunpfahl nicht und geht neben mir her. Er ist jetzt schon der Zweite, der ein gequältes Gesicht macht.
»Puh. Grässliche Krawatte«, sagt er.
»Dir auch einen guten Morgen. Woher wusstest du, dass ich einen Autounfall hatte?«
»Sie hatten echt einen? Wow! Ich habe einfach die beste Entschuldigung genommen, die mir eingefallen ist. Ich dachte, niemand würde die Notlüge bemerken, da Sie ohnehin jeden Tag das Auto wechseln.« Er neigt den Kopf zur Seite. »Geht es Ihnen gut?«
»Ja, verdammt noch mal. Aber Bricklin gräbt gerade in meiner Goldmine, und ich muss da rein.«
»Kein Grund zum Fluchen.«
»Entschuldige, ich hatte eine schlimme Nacht. Und einen schlimmen Morgen. Ist Tee da?«
»Ich habe ihn in die Mikrowelle gestellt, um ihn aufzuwärmen, als ich Ihre Stimme im Foyer gehört habe.«
Wie aufs Stichwort erklingt hinten im Flur das Ping der Mikrowelle. »Hängt der Beutel da seit drei Stunden drin?«
»Keine Sorge. Ich habe ihn nach viereinhalb Minuten rausgenommen. Das ist die optimale Ziehzeit für schwarzen Tee, danach wird er bitter.«
Der Junge ist ein Heiliger – von der nervigen Sorte, die alles so gut macht, dass man sich beinahe wünscht, dass er mal etwas vergeigt.
»Sie haben Ihren Job gut gemacht.«
»Es ist eigentlich nicht mein Job, aber gern geschehen.«
Ich überhole ihn und halte schnurstracks auf den Tee zu, aber er dackelt hinter mir her wie ein kleiner Bruder, der mit zu dem großen Spiel will.
»Goucher hat Ihre Mandanten in Ihrer Abwesenheit zu Bricklin geschickt, um sie mit der Kanzlei bekannt zu machen. Bricklin hat sich übrigens freiwillig gemeldet.«
»Warum überrascht mich das nicht?«
»Weil sie ehrgeizig ist, und es ist ein Karrierefall. Das haben Sie selbst gesagt.«
»Es war eine rhetorische Frage, Praktikant.«
»Warum nennen Sie mich Praktikant?«
»Das ist dein Titel.«
»Aber es ist nicht mein Name. Ich denke, Sie wollen mich damit an meinen Platz am unteren Ende des Firmentotempfahls erinnern.«
»Nein. Es soll dich daran erinnern, dass du noch nicht einmal auf diesem Pfahl bist.«
»Noch nicht? Das heißt, es besteht eine Chance?«
»Geh und lies dir ein paar Fälle durch, auf mich wartet echte Arbeit.« Wenn es eines gibt, was Phil kann, dann ist es das Nachlesen von Fällen, vor allem von großen, aufwendigen Fällen. Er kann sich in fünfzigseitige Entscheidungen des Obersten Gerichts vertiefen, als würde er einen guten Roman lesen, und anschließend jeden Punkt erklären oder sich durch Dutzende von Akten wühlen und eine ganze Woche damit verbringen zu lesen, zu sortieren und abzulegen, während er von Take-away aus dem Thai Time im Erdgeschoss lebt.
Was mich betrifft, ich bin kein Fan der langweiligen Aspekte des Rechts. Ich bin besser darin, das große Ganze zu sehen und Sachen herauszudestillieren. Ich kann mir komplizierten Mist durchlesen und ihn den Richtern und Geschworenen so erklären, dass er ganz einfach klingt. Ich bin wie eine juristische Destillerie. Das hat sich als wertvolle Eigenschaft erwiesen, vor allem im Umgang mit Mandanten. Deshalb gefällt mir die erste Phase eines Falles am besten – die Durchsicht der Fakten. Man muss alle Fakten kennen. Wenn ein Gerichtstermin naht und man sich unvorbereitet fühlt, liegt das wahrscheinlich daran, dass man seine Fakten nicht gut genug kennt. Ich lese mir Hunderte von Seiten mit Fakten vier- oder fünfmal durch, nur um mir den einen Satz zu erarbeiten, in dem ich sie auf den Punkt bringe. Damit kriegt man sein Publikum – mit dieser einfachen Zusammenfassung. Ich bringe sie einmal zu Beginn der Verhandlung und einmal am Schluss. Der Rest dazwischen ist nur Füllkram, um diese beiden Buchstützen zu halten. Wann immer ich mich in meine Höhle zurückziehe, um mich auf einen Fall vorzubereiten, kenne ich – wenn ich meine Bürotür wieder öffne, um Luft zu schnappen – die Details so gut, dass ich die Eröffnungs- und Schlussplädoyers auswendig halten kann. Oft tue ich das auch, im Auto auf der Heimfahrt, beim Abendessen auf dem Boot oder sogar unter der Dusche. Das kann peinlich werden, weil ich momentan im Fitnessstudio dusche, und manchmal denken andere nackte Männer, ich würde mit ihnen reden. Verfahrensrecht macht weniger Spaß. Mehr Plackerei. Einige Anwälte sind Techniker, Jurafreaks wie Phil. Sie stellen jede Menge Anträge, die auf verfahrenstechnischem Schwachsinn basieren. Sie nutzen alles für ihre Strategien, bis auf das