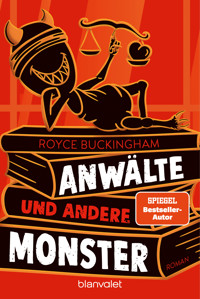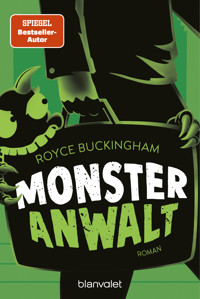11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mapper
- Sprache: Deutsch
Manchmal verändert eine falsche Entscheidung den Lauf der Geschichte …
Ian Krystal ist ein einfacher Soldat, als König Preston seinen Clan übers Meer schickt, um den neu entdeckten Kontinent zu besiedeln. Während andere versuchen, die hier lebenden Völker zu unterwerfen, erreicht Ian Krystal durch Verhandlungen ein friedliches Miteinander. Doch dann befiehlt ihm König Preston, seine einheimischen Freunde zu verraten und das Land mit Waffen und alter dunkler Magie zu erobern. Nun muss sich Ian entscheiden, ob er seinem König die Treue hält oder dem Ruf seiner eigenen Ehre folgt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 723
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ROYCE BUCKINGHAM
Roman
Aus dem Englischen von Michael Pfingstl
1. Auflage
Oktober 2014 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe 2014 by Royce Buckingham
Published in agreement with the author, Baror International, Inc., Armonk, New York, U.S.A.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by Blanvalet Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Max Meinzold, München
Umschlagillustration: © Max Meinzold, München
Karte: © Jürgen Speh
Redaktion: Alexander Groß
Lektorat: Holger Kappel
Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-12634-6www.blanvalet.de
Prolog
Petrich liebte die Dunkelheit. Nicht nur wegen ihrer Reinheit und Schönheit, sondern weil sie seine vertraute Begleiterin war. Andere fürchteten das Dunkel und die Schatten, verabscheuten sie und verfluchten sie still, als könnte die Finsternis ihre Worte hören und sie bestrafen. Nicht so Petrich Krysalis aus den Hügeln Artungs. Er schritt die Steinstufen hinunter, die schon seit Jahrhunderten vergessen waren, tauchte ein in die Finsternis und fühlte sich sicher, geborgen vor der Welt des Lichts, die so hart, grausam und manchmal schlichtweg böse war.
Seit seinem fünften Lebensjahr war das Dunkel seine treueste Freundin. Damals hatte der Talklan in einer mondlosen Sommernacht alle Männer seines Bergdorfes getötet. Aber die Dunkelheit hatte ihn vor ihren eisernen Äxten verborgen. Dorthin hatte er sich verkrochen, ins Innere eines von der Fäulnis ausgehöhlten Baumstamms, in dem er noch am Morgen desselben Tages mit seinen Vettern gespielt hatte. Der erste Trupp der blutrünstigen Krieger war so dicht an seinem Versteck vorbeigekommen, dass er ihre stinkenden und verschwitzten Tierhäute riechen konnte und hörte, wie die Hauer der Keiler, die sie an Schnüren um den Hals trugen, bei jedem Schritt gegen ihre Lederharnische schlugen. Grunzend wie Schweine brachten die bärtigen Krieger jeden Mann im Dorf um, den sie nur finden konnten. Ihre Äxte schmatzten, wenn sie die Schädeldecke durchschlugen, und das grausame Grinsen auf ihren Gesichtern, die im Licht der flackernden Fackeln aufblitzten, war weit grauenhafter als alles, was sich im Schwarz der Nacht verbergen mochte.
Diese Nacht hatte ihn zutiefst verändert und ebenso seinen Klan. Nicht ein Mann aus seinem Dorf hatte überlebt, und jede Frau seines Klans trug nun das kreisförmige Brandmal der Sklaven auf der Stirn. Nur er, der kleine Petrich, war entkommen. Seine Freundin, die Dunkelheit, hatte sich über ihn gelegt wie ein schützender Schleier. Als die Talbewohner vor seinem Versteck kauerten und mit ihren Fackeln hineinleuchteten, wünschte er, das Licht möge verschwinden, und die Dunkelheit erhörte seine Bitte. Sie widersetzte sich dem Licht, ihrem natürlichen Feind, hüllte Petrich in Schatten, kämpfte für ihn und schlug das Licht zurück. Die bärtigen Männer waren schnaubend wieder verschwunden, zu blind oder zu dumm, um etwas zu bemerken.
Petrich hatte sich selbst beschmutzt vor Angst. Eine unsägliche Schande für einen Spross des Bergklans, selbst im Angesicht des Todes. Sein Vater hätte ihn dafür mit einer Rute verprügelt, aber sein Vater war tot, sein Kopf von einer Axt gespalten. Aber Petrich lebte. Wie durch ein Wunder. Seine Verbündete, die Dunkelheit, hatte ihm das Leben geschenkt, und noch während er eingekeilt in dem fauligen Baumstamm lag und die Bisse der Rüsselkäfer und Mückenlarven in seinen Ohren und an den Handgelenken ertrug, schwor er, sich eines Tages zu bedanken.
Jetzt, als dreiundzwanzigjähriger Mann, bewegte er sich durch die Straßen einer längst vergessenen Stadt jenseits des Meeres, weit entfernt von seiner Heimat. »Die Täler« nannten die Einheimischen sie. Schon in die zweite Flucht aus Steinstufen drang kein Licht mehr, und als er die dritte erreichte, tastete er sich nur noch mit den Fingern voran, immer tiefer hinein in die Erde. Als Zeichen der Freundschaft trug Petrich keine Fackel bei sich. Die Finsternis scheute das Licht, und solange er sich nicht mit der verhassten Sonne verbündete, würde die Dunkelheit ihn mit offenen Armen empfangen, ihm vielleicht ihre Geheimnisse preisgeben.
Weit über ihm erstreckten sich die Ruinen einer einstmals prächtigen Stadt, doch die Zeit ihrer Blüte lag lange zurück. Mehr als nur Jahrhunderte, dachte Petrich. Die steinernen Bauten waren längst verfallen. Wie geborstene Felsnadeln ragten sie auf, klagten Regen und Sonne an, die weiter an ihnen fraßen, und sangen ihr nimmer endendes Totenlied. Die Menschen, die hier gelebt hatten, mussten auf einem weit höheren Entwicklungsstand gewesen sein als die Höhlenbewohner und Nomaden, die jetzt diesen Landstrich bevölkerten. Was sie einst zu Fall gebracht hatte, war für Petrich genauso rätselhaft wie die riesigen Statuen, die sie als Wächter vor der Treppe errichtet hatten.
Die Augen vermochten ihm hier keine Dienste zu leisten, aber Petrichs andere Sinne waren aufs Äußerste geschärft, und er spürte eher, als dass er sah, wie die Stufen sich zu einem großen Raum öffneten. Die Luft war dick und schwer, kein Hauch regte sich. Der Widerhall seiner Schritte wurde lauter, die Wand, an der er sich entlanggetastet hatte, verschwand, und es roch auch anders. Der stechende Geruch von etwas Lebendigem hing in der Luft, durchsetzt mit dem Gestank von Exkrementen und Tod.
Petrich hielt inne und lauschte. Er hörte ein Tropfen – und Atemgeräusche, ganz leise und flach. Kein Höhlenbär also. Ein weiteres demütiges Geschöpf wie ich selbst, das inder Dunkelheit Zuflucht sucht, dachte Petrich und betrat die unterirdische Kammer.
»Vergib mir mein Eindringen«, flüsterte er dem unsichtbaren Wesen zu. »Hier drinnen ist genug Finsternis für uns beide.«
Wie als Antwort ertönten ein hohes Kichern zu seiner Linken und ein Schlurfen zu seiner Rechten. Klauen, die über Stein schabten. Wer oder was auch immer diese Geräusche verursachte, es waren mindestens zwei. Dann hörte er ein Wimmern, wie er es noch nie von einem lebenden Geschöpf vernommen hatte, und ein eiskalter Schauer lief ihm über den Rücken. Petrich kämpfte den unbändigen Drang zur Flucht in sich nieder und spannte die Hinterbacken an, damit sein Darm sich nicht entleerte. Die Dunkelheit ist deine Freundin, rief er sich ins Gedächtnis. Einen Moment lang blieb er stehen, dann tastete er sich weiter, befühlte den steinernen Boden mit den schwieligen Sohlen seiner nackten Füße, als wären sie Hände.
Hätte Petrich behauptet, er wüsste, wonach er suchte, hätte er gelogen. Etwas zog ihn hierher, das war alles. Er würde es merken, wenn er es fand. Aber was es war und wozu er es vielleicht gebrauchen konnte, wusste er nicht.
»Was tue ich hier?«, fragte er sich laut.
Vorgeblich war er im Auftrag des Königs hier. Er sollte neue Ländereien für die Krone beanspruchen. König Schwarzwasser hatte den Klanskriegen ein Ende gemacht, und dann waren auf seinen Befehl hin die Gefangenen ausgetauscht worden. Petrichs Schwester Rachee war auch unter ihnen gewesen. Sie kehrte zurück, körperlich und seelisch gezeichnet, aber am Leben. Dann waren sie beide in die Hügel zu entfernten Verwandten ihres Klans geschickt worden, die in den höheren Lagen der heimischen Rostigen Berge lebten. Dort wuchsen sie auf, wiedervereint, aber ohne Eltern, und die Bande zwischen ihnen wurden während der nächsten sieben Jahre umso enger, bis Rachee mit Petrichs Zustimmung an einen entfernten Cousin verheiratet wurde. Aus Dankbarkeit, dass er seine geliebte Schwester gerettet hatte, hatte Petrich dem König ewige Treue geschworen. Nicht nur mit Worten, sondern aus tiefstem Herzen, denn ohne Rachee wäre Petrich mutterseelenallein gewesen auf der Welt. Er sorgte sich sogar mehr um ihr Leben als um sein eigenes. Nur die überraschende Intervention des Königs hatte ihn davon abgehalten, selbst einen Befreiungsversuch zu unternehmen. Petrich hatte sich einen schlauen Plan zurechtgelegt, und manchmal bedauerte er es beinahe, dass er nicht dazu gekommen war, ihn durchzuführen. Vielleicht wäre er ein Held geworden.
Dennoch war es nicht seine Loyalität gegenüber dem König, die ihn hierhergeführt hatte. Während die anderen ein gutes Stück entfernt von den Ruinen im Lager schliefen, hatte die Dunkelheit ihre Fühler ausgestreckt und ihn zu sich gerufen.
Dem Echo seiner Schritte nach zu urteilen, hatte er nach etwa zehn Schritten die Mitte des Raums erreicht. Die scharrenden Geräusche um ihn herum wurden jetzt hektischer. Er hörte ein leises Klatschen, Schweiß oder Geifer, der zu Boden tropfte. Noch hielten sie Abstand, aber wie lange noch? Petrich war ganz nahe dran. Ob sie das Geheimnis bewachten? Das wäre bedauernswert, denn er war nicht gekommen, um zu kämpfen. Im Gegensatz zu den anderen Klansmännern, die sich von den Ruinen fernhielten, weil die Geschichten, die sie darüber gehört hatten, ihnen Angst machten, war Petrich kein Krieger. Aber ebendiese Krieger glaubten, dieser Ort sei verflucht. Selbst wenn er sie hätte überzeugen können, ihn zu begleiten, wären sie niemals ohne Fackeln hier heruntergekommen. Und dann wäre die Dunkelheit geflohen, hätte sich verkrochen und ihr Geheimnis niemals enthüllt.
Petrich tastete nach seinem Dolch. Er konnte zwar nichts sehen, aber genauso wenig würden seine Angreifer die Klinge sehen, die so scharf war, dass sie selbst die dicke Haut eines Ebers durchstechen konnte.
Er war jetzt in der Mitte angekommen und schlich weiter zur gegenüberliegenden Wand, von der er wusste, dass sie da sein musste. Alles wurde still. Die Geschöpfe liefen jetzt nicht mehr auf und ab. Sie pirschten sich an und würden sich jeden Moment auf ihn stürzen.
Aber die Dunkelheit ist meine Freundin.
Er hörte ein leises Einatmen, eine letzte Vorbereitung …
Petrich ging blitzschnell in die Knie und stieß den Dolch nach oben. Die Bestie schnellte über ihn hinweg und schlitzte sich im Sprung den Bauch an Petrichs Klinge auf. Warmes, klebriges Blut spritzte auf ihn herab, besprenkelte den Boden, und Petrich spürte, wie die Dunkelheit sich veränderte. Sie verdichtete sich, wurde schwärzer.
Sie will Blut. Das ist es, was sie braucht.
Der Gedanke, dass sie ihn gerufen haben könnte, weil sie sein Blut wollte, kam Petrich gar nicht erst in den Sinn. Die Finsternis war seine Verbündete.
Er hörte, wie die Kreatur auf den steinernen Boden schlug und zuckend in ihrem eigenen Blut liegen blieb.
Eine noch.
Sabbernd folgte die andere Kreatur dem Winseln ihres Artgenossen und dem Geruch von Blut. Offensichtlich glaubte sie, es wäre Petrich, der dort am Boden lag. Er konnte jetzt alles spüren, was sich in der Kammer befand: den steinernen Altar zu seiner Rechten, die tiefe Grube zu seiner Linken, in die er beinahe gestürzt wäre, die er aber instinktiv umgangen hatte – und den Aufenthaltsort der zweiten Kreatur. Das alles verriet ihm die Dunkelheit. Sie gab ihm Mut, mehr noch: Sie gab ihm Macht, verbarg ihn vor seinen Feinden und verbarg auch seinen eigenen Gegenangriff.
Die unsichtbare Bestie lief an ihm vorbei und beschnüffelte den Kadaver auf dem Boden. Zu spät merkte sie, dass es sich dabei nicht um Petrich handelte, denn der stürzte sich bereits auf sie, frisch erstarkt und mit einem Mal genauso grimmig wie der wildeste Krieger seines Klans. Er schlang einen Arm um die Stelle, die der Hals der Bestie sein musste, und stieß zu, wieder und immer wieder, nährte die Dunkelheit mit Blut. Petrich war in diesem Moment kein Mensch mehr, er war ein Tier geworden, das ums nackte Überleben kämpfte.
Als die Kreatur reglos liegen blieb, stand Petrich auf, und das Dunkel zog sich um ihn herum zusammen. Vielleicht kam es auch wegen des Blutes, mit dem er vom Scheitel bis zur Sohle beschmiert war. Seine Verbündete legte sich über ihn wie eine wärmende Decke. Petrichs dickes Lederwams hing in Fetzen. Die Klauen des Geschöpfes hatten es zerrissen wie Papier. Es war ein Wunder, dass er noch lebte. Sein Gegner war gefährlicher gewesen, als er gedacht hatte, aber die Dunkelheit hatte ihn umhüllt und beschützt wie eine Rüstung.
Die meisten Klansmänner häuteten ihre Beute und gaben mit der Haut vor ihren Kameraden an. Petrich hingegen verspürte kein Bedürfnis, einen Schrecken ans Tageslicht zu zerren, dessen Anblick ihn wahrscheinlich nur entsetzt hätte.
Sollen die Schatten sie behalten.
Er hatte bereits gefunden, weshalb er gekommen war: eine noch tiefere Dunkelheit, als er sie je gekannt hatte. Wie ein Schleier hüllte sie ihn ein. Petrich öffnete seinen Beutel und schöpfte das undurchdringliche Schwarz mit vollen Händen hinein. Es war dick und zähflüssig wie Tinte. Als der Beutel prall und schwer war von seinem Gewicht, verschloss er ihn mit einem Riemen, steckte ihn in einen weiteren Beutel und den wiederum in einen Sack, den er unter seinen Mantel stopfte, sodass kein Licht je hineingelangen konnte. Dann wandte er sich zur Treppe.
Es war ein langer Weg nach oben, und als Petrich ins grelle Mondlicht trat, nahm er die Dunkelheit mit sich.
Buch 1
1
»Eine ein Volk, und es wird dich lieben. Erobere es, und es wird dich hassen.«
Ian Krystals Vater, der Drottin seines Hügelkuppenklans, hatte diese Worte zu ihm gesagt. Monate lag das jetzt zurück. Unter einem wie mit Diamanten gesprenkelten Nachthimmel hatten sie zu Hause in Artung allein vor dem herunterbrennenden Feuer gesessen – auf der anderen Seite des Ozeans, der Ians Heimat von diesem seltsamen Land namens Abrogan trennte.
Die Worte hallten in der friedlichen Stille wider, die er nur unter Wasser fand. Ian wartete, bis er es nicht länger aushielt, dann riss er den Kopf aus dem Fass, streckte die nackten Arme der Sonne entgegen und saugte die frische Morgenluft in seine Lunge, während er sich das Wasser aus dem schulterlangen flachsblonden Haar schüttelte. Hier in Abrogan war er der Drottin, und die anderen mussten warten, bis er fertig war, bevor auch sie sich die Haare waschen konnten.
Ian war froh, dass sie die unheimlichen Ruinen der Täler hinter sich gelassen hatten. Sie waren auf dem Weg nach Südosten und durchquerten das tief gelegene Ackerland von Plynth. Die Plynther waren ebenso seltsam wie das Land selbst. Statt in Betten schliefen sie auf Traumgras, das sie eigens in ihren Hütten anpflanzten, und sie beteten zu Katzen. Seltsam, so wie das gesamte Land. Die Menschen hier schienen keinen Herrscher zu haben. Sie lebten einfach nebeneinanderher, jedes Volk noch verschrobener und abgeschiedener als das andere, denn in dem riesigen, dünn besiedelten Land, kamen sie kaum miteinander in Kontakt. Außerdem gab es hier Tiere, wie Ian sie noch nie gesehen hatte: Hasen mit Hörnern auf dem Kopf und Vögel, die die Sprache der Menschen nachahmen konnten. Selbst die Bäume waren anders. Bei manchen Arten schienen sich die Stämme regelrecht ineinander zu verknoten, bevor sie nach oben Richtung Sonne wuchsen. Und trotz all dieser Eigenheiten – oder vielleicht gerade deswegen – hatte Ian das Gefühl, Abrogan könnte genau der richtige Ort für ihn sein. Immerhin war er als zweitgeborener Sohn eines einfachen Klansanführers hier angekommen, und jetzt befehligte er bereits ein kleines Heer.
Er ließ den Blick über die herumliegenden Wolfsfelle, Säcke und eisernen Gerätschaften schweifen, die sie ihr »Lager« nannten. Die meisten wachten gerade erst auf, nur Ians älterer Bruder Dano war bereits auf den Beinen. Wie ein schlecht gelaunter Eber schlurfte er durch die Reihen und riss die Männer aus dem Schlaf.
»H-H-Handtuch, Herr?«
Ian fuhr herum und tastete instinktiv nach seinem Schwert, aber er hatte Obry noch nicht einmal umgegürtet.
Die Gestalt, die bedrohlich nahe hinter ihm stand, streckte ihm ein ausgefranstes Stück Leinen entgegen.
Ian fuchtelte mit der Hand. »Ich lasse meine Mähne lieber an der Sonne trocknen.«
»Wie Ihr w-w-wünscht.«
Ian musste über seine eigene Schreckhaftigkeit lachen. Der Junge mit dem Handtuch konnte kaum älter als neun sein und trieb sich schon hier herum, seit sie ihr Lager aufgeschlagen hatten. Fasziniert von den Speeren und Soldaten, saugte er in atemberaubendem Tempo Wörter und ganze Sätze ihrer Sprache in sich auf. Nur beim Aussprechen hatte er Schwierigkeiten: Entweder blieben ihm die Worte im Hals stecken, oder sie purzelten viel zu schnell heraus. Die meisten seiner Männer lachten schon, sobald der Kleine nur den Mund öffnete, und Ians jüngerer Bruder Kerr ahmte ihn oft nach, wenn er den griesgrämigen Dano ein wenig aufheitern wollte. Dennoch war der Knabe als Dolmetscher unverzichtbar, wenn sie mit den Plynthern verhandelten. Aber Ian schien der Einzige zu sein, der das begriffen hatte.
»Wir machen dich neugierig, Kleiner, oder?«, fragte er schließlich.
Der Junge nickte. Er erinnerte Ian an Kerr, der als Kind ständig die Nase in die Angelegenheiten der Älteren gesteckt hatte.
»Wissen deine Eltern, wo du bist?«
»N-N-Nein. Aber sie h-h-haben noch andere K-Kinder mit gesunden Z-Z-Zungen und verm-missen mich nicht.«
»Was für eine Schande«, sagte Ian, um den Jungen zu trösten, aber die Worte klangen selbst in seinen eigenen Ohren hohl. Für jemanden, der unerwünscht war – noch dazu als Kind –, gab es keinen Trost. »Mein Vater hat mich hierhergeschickt«, fügte er schließlich hinzu.
»W-Warum?«
»Weil unser König es so will, und um einen Weg in dieser Welt für mich zu finden. Was hältst du davon?«
»Die b-b-bekannten Wege zu verlassen, ist g-g-gefährlich.«
Ian lachte. »Gute Antwort.«
»K-K-Kommt Ihr als E-E-Eroberer?«
»Bei den Göttern, nein. Haben meine Männer dir das erzählt?«
»Sie haben mir n-n-nur g-g-ganz wenig erzählt.«
Ian nickte und bedeutete dem Jungen, sich zu ihm zu setzen. Der Kleine würde höchstwahrscheinlich jedes einzelne Wort im Dorf verbreiten, das er hier im Lager aufschnappte, und Gerüchte konnten gefährlich sein – aber auch von Nutzen, wenn es nur die richtigen Gerüchte waren.
»In Artung und Fretwitt, jenseits des großen Meeres im Süden, wissen wir erst seit einer Generation, dass es dieses Land gibt. Mein Vater war zwanzig, als er mit seinem Schiff das Lebende Riff durchfuhr und hierherkam. Er blieb fünfzehn Jahre und hat das Land westlich von hier erforscht. Dann kehrte er zurück nach Artung, hat mich und meine beiden Brüder gezeugt und erzählte die erstaunlichsten Dinge von diesem Land.«
Der Junge deutete auf einen Speer, der an einem Fass lehnte. »War er ein K-K-Krieger?«
»Wenn er musste, ja. Jetzt ist er der Drottin meines Klans in Artung.«
»Ein K-K-König?«
»Nein, ein Drottin. Er hat mein Volk in den Klanskriegen angeführt. Er ist ein großer Mann.«
»Euer V-V-Vater ist also kein König?«
»Nein«, wiederholte Ian geduldig. »Prestan Schwarzwasser ist unser König. Mein Vater ist Drottin.«
»D-Dient Euer Vater dem K-K-König?«
Ian runzelte die Stirn. Der Junge war einfach noch zu klein, um zu begreifen, weshalb sie hier waren, aber er versuchte es trotzdem.
»Vor acht Jahren hat mein Vater dem König und dessen Fürsten – den durchlauchten Herrschaften des benachbarten Fretwitt mit all seinen Burgen und Städten – Gefolgschaft geschworen. Im Gegenzug entsandte Schwarzwasser sein Heer nach Artung und beendete die Klanskriege, die unser Volk einen hohen Blutzoll gekostet haben.«
»Und dann hat der K-K-König Euch hierhergeschickt.«
»Ja.«
»Damit w-w-wir auch einen Eid sch-schwören.«
Gar nicht mal so dumm, der Kleine, dachte Ian, schüttelte aber den Kopf. »Nein, nein. Er hat uns hergeschickt, weil er mit diesem Land Handel treiben will. Und Straßen bauen. Sag das den Leuten in deinem Dorf. Straßen sind etwas Gutes. Für jeden. Wir wollen keinen Krieg.«
Der Junge lächelte. Ians offene Art schien ihm zu gefallen, und er konnte sehen, wie der Kleine seine Worte unablässig wiederholte, als er sich auf den Heimweg machte.
Ian stand auf und blickte versonnen auf das spiegelglatte Wasser in dem Fass. Ihr Auszug aus Artung war mit das Beeindruckendste gewesen, was er mit seinen einundzwanzig Jahren je erlebt hatte. Alle neun Klans waren an die Küste gekommen, jeder mit seinem eigenen Kontingent an Männern für die Reise. Noch nie hatte er ein so großes Lager gesehen. Unter der Aufsicht der Ingenatoren des Königs hatten die Klans aus Planken und Eisennieten zwölf riesige Langschiffe zusammengezimmert. Als sie fertig waren, wurde noch ein letztes Mal gefeiert, gerauft, gespeist und geweint, und am nächsten Morgen legten sie ab.
Und dann waren sie plötzlich auf offener See gewesen.
Ian schauderte, wenn er an die schrecklichen Wochen dachte, die folgten. Zu vierzigst waren sie an Bord der in den Wellen stampfenden Schiffe zusammengepfercht gewesen, und fast jedes davon hatte gleich zu Anfang mindestens einen Mann an das Lebende Riff vor der Nordküste verloren. Die Seefahrer hatten das Riff immer gemieden. Den »Friedhof des Ozeans« nannten sie es.
Als sie das Riff endlich passiert hatten, waren sie in frenetischen Jubel ausgebrochen, doch die Freude währte nicht lange, denn auf dem offenen Meer starben weitere Männer. Eines der Schiffe war nicht stabil genug gebaut, und der Rumpf hielt dem beständigen Ansturm der Wellen nicht stand. Ian war nicht überrascht gewesen; der Talklan war berüchtigt für seine Wildheit in der Schlacht, nicht für Sorgfalt und Geschick. Glücklicherweise fuhr jeder Klan mit dem Schiff, das er selbst gebaut hatte. So waren die Opfer zumindest selbst daran schuld, als das Wasser die Planken so plötzlich auseinanderriss, dass die Ruderer nicht einmal Zeit hatten, von ihren Riemen aufzuspringen, bevor der Ozean sie verschlang. Petrich vergoss nicht eine einzige Träne, als sie später lediglich drei von den fünfzig Mann Besatzung aus den Wellen zogen.
Ein weiteres Schiff war während des zweiten der beiden Stürme, die sie hatten überstehen müssen, einfach verschwunden. Es war kleiner gewesen, aber Ians Meinung nach der weit größere Verlust. Zwanzig tatkräftige und tapfere Männer aus den Flachlanden segelten nun entweder ziellos übers Meer oder waren ertrunken.
Ein drittes Schiff war von etwas Monströsem in die Tiefe gezogen worden. Sie hatten es kaum zu Gesicht bekommen und sprachen noch viel weniger darüber. Die Besatzung hatte aus Fretwittern bestanden, die in der Frühlingswald-Garnison an der Grenze zu Artung stationiert gewesen waren.
Ians eigene Leute hatten es alle sicher bis Buchtend geschafft. Seekrank, aber am Leben, erbrachen sie die letzte Ration Haferschleim ins stinkende Hafenbecken, als sie endlich einliefen: vierzig Hügelbewohner, unter ihnen auch Petrich, der als einer der wenigen Überlebenden seines einst mächtigen Bergstammes bei Ians Klan aufgewachsen war.
Auch Ians Brüder gehörten zu dem Kontingent. Dano, der grüblerische ältere der beiden, war dreiundzwanzig Jahre alt, groß und stark wie ein Bär und ebenso stur. Ians sorgloser siebzehnjähriger Bruder Kerr war Danos genaues Gegenteil: vertrauensselig, von durchschnittlicher Körpergröße und bei allen beliebt.
Ian war zu einem kräftigen jungen Mann herangewachsen, nicht so bullig wie Dano, aber auf seine ganz eigene Art stark. Er war flink und geschickt, konnte hervorragend mit Speer und Schwert umgehen und vereinte – zumindest meistens – die besten Eigenschaften seiner Brüder in sich. Das war auch der Grund, warum er Obry, das Schwert seines Vaters Kellen Krystal, bekommen hatte. Und wer Obry hatte, war Drottin. Wie Kellen ihm anvertraut hatte, war das Schwert ein guter Ratgeber, er müsse nur richtig hinhören. Eine ganze Nacht lang hatte Ian wach gelegen, ein Ohr auf den Knauf gepresst, ohne auch nur ein Flüstern zu hören. Als Kerr ihn dann auch noch fragte, ob er vorhabe, das Schwert zu begatten, gab er es schließlich auf. Die Klinge war aus Stahl und so lang wie Ians Arm. Der Griff bestand aus geschmiedetem Kupfer und stellte die Miniatur eines Mannes dar: Obry. Die Arme dienten als Parierstange, der Rumpf bildete den Griff und die seitlich abgespreizten Beine den Knauf am Ende. Wenn Ian das Schwert in der Hand hielt, befand sich Obrys Gesicht genau über seinem Daumen und Zeigefinger und schien ihn erwartungsvoll anzustarren.
Dano hatte sich keine Verbitterung über den Entschluss seines Vaters anmerken lassen. »Der Drottin kann zu seinem Nachfolger bestimmen, wen immer er will«, hatte er gesagt, und es gehöre sich nicht, den Entschluss des Drottin infrage zu stellen. Auch nicht für den ältesten Sohn. Außerdem, so hatte er etwas steif hinzugefügt, konnte Kellen seine Entscheidung immer noch ändern.
Ians entfernter Vetter Petrich war ebenfalls dabei. Er war ein seltsamer Kerl, über den die anderen sich oft lustig machten, aber Petrich war Ian in bedingungsloser Treue ergeben. Außerdem rechtfertigte das bittere Schicksal, das ihm widerfahren war, zumindest in Ians Augen Petrichs Eigenarten.
Das Geräusch von Schritten riss Ian aus seinen Gedanken. Er hob den Blick und sah seinen Bruder Dano zum Waschtrog kommen. Als Starke Hand des Drottin war er als Nächster an der Reihe, seine verfilzte Mähne zu säubern. Alle anderen mussten warten, und wer als Letzter von den vierzig Mann dran war, konnte sich die Mühe ohnehin sparen.
»Sei gegrüßt, Bruder«, rief Ian ihm mit einem Lächeln zu; in neun von zehn Fällen übertrug sich die morgendliche Laune des Anführers auf seine Gefolgsleute und hielt dann für den Rest des Tages an, wie sein Vater immer sagte. »Was für ein herrlicher Morgen!«
Dano runzelte die Stirn. »Ja, Drottin, aber in einem absonderlichen Land.« Er bestand darauf, stets Ians offiziellen Titel zu benutzen, was natürlich ein Zeichen seines Respekts war. Doch gleichzeitig erinnerte es Ian immer wieder daran, wie unwohl sich sein Bruder mit dieser neuen Hierarchie fühlte.
Kerr, der sich gerade erst aus seiner Bettrolle geschält hatte, folgte Dano direkt auf den Fersen. Ian wusste sofort, dass das nichts Gutes bedeuten konnte. Kerr, der statt der wild vom Kopf abstehenden hellen Locken des Vaters das seidige dunkle Haar ihrer Mutter geerbt hatte, war immer darauf erpicht, einer der Ersten am Waschzuber zu sein. Drei Schritte bevor Dano den Zuber erreichte, hatte Kerr ihn eingeholt.
»Morgen, Starke Hand«, sagte der jüngste der drei Krystals. »Oder sollte ich lieber ›Stinkende Achsel‹ sagen?« Jedes andere Klansmitglied hätte für diese Beleidigung eins über den Schädel bekommen, aber Kerrs unschuldiges Grinsen schützte ihn wie so oft vor dem Zorn seines Bruders.
»Warte, bis du dran bist«, brummte Dano nur. Sein Haar war braun von Staub und Schweiß. Er wird den ganzen Zuber verdrecken, dachte Ian, und Kerr war anscheinend derselbe Gedanke gekommen.
»War nur ein Scherz, Bruder. Du siehst blendend aus«, trällerte Kerr. »So blitzsauber, dass du auch noch einen Tag warten könntest, während mein armer Kopf die Waschung dringend nötig hat.«
»Spar dir die Worte. Ich kann nicht zulassen, dass meine jüngeren Brüder beide vor mir an der Reihe sind. Die Männer würden mich für einen Schwächling halten.«
»Seltsam«, erwiderte Kerr und rieb sich das Kinn. »So was Ähnliches haben Tuck und Glatz auch gerade gesagt.«
Dano stutzte. »Tatsächlich?«
»Ja. Gerade eben, als ich an der Feuerstelle vorbeikam.« Kerr deutete auf eine Ansammlung von Männern in der Mitte des Lagers.
»Sie haben mich einen Schwächling genannt?«
»Ich könnte mich auch verhört haben, aber dein Name ist gefallen, und dann haben sie gelacht.« Kerr zögerte. »Wenn ich’s mir recht überlege, hätte ich ihnen das nicht durchgehen lassen dürfen«, sagte er schließlich schuldbewusst.
Dano klopfte ihm auf die Schulter. »Nein. Du hast recht, damit zu mir zu kommen, Bruder. Ich werde die Angelegenheit selbst regeln.«
Dano stapfte los und schleuderte den beiden Männern einen wilden Fluch entgegen, während Kerr sich auf das Fass stürzte und seinen Kopf hineinsteckte.
»Du machst dich über ihn lustig«, bemerkte Ian, als Kerr den tropfnassen Schädel aus dem Wasser zog.
»Ab und zu tut ihm das ganz gut«, erwiderte Kerr und wrang sich das lange Haar aus.
Wenige Momente später kam Dano von der Feuerstelle zurück. »Die beiden werden nie wieder an meiner Stärke zweifeln«, erklärte er zufrieden und betrachtete dann verdutzt Kerrs nasses Haar.
»Da hast du wohl recht, Bruder«, warf Ian ein. »Das nächste Mal wird es deine Intelligenz sein, die sie anzweifeln.«
Kerr war nicht nur der kleinste der drei Krystals, er war auch der schnellste Läufer des gesamten Klans. Diese Eigenschaft hatte ihm schon mehrmals das Leben gerettet und tat es auch jetzt, als Dano ihn kreuz und quer durch das Labyrinth aus Zelten jagte.
Ian schaute den beiden eine Weile kopfschüttelnd zu, dann entdeckte er einen kleinen schwarzen Fleck am Himmel, der sich rasch näherte. Es war ein Vogel, und er kam von Westen. Als er über dem Lager war, begann er immer tiefer zu kreisen.
»Esst, wascht euch und brecht die Zelte ab, Männer!«, rief Ian. »Wie es scheint, bekommen wir neue Befehle.«
Der Papagei hielt zielstrebig auf Kerr zu und landete direkt auf seinem Kopf.
Sofort versammelten sich alle neugierig um den bunt gefiederten Vogel, der sprechen konnte wie ein Mensch.
»Auf der Pelikanstraße verschwinden immer wieder Menschen«, verkündete der Papagei. »Führe deine Männer in den Sumpf. Finde die Schuldigen und richte an meiner statt.«
»Wie kommt es, dass dieser vorlaute Vogel uns erzählen kann, was wir zu tun haben?«, brummte der einarmige Schagan. Der verstümmelte Klansmann konnte weder kämpfen noch rudern oder schwere Lasten tragen, aber hervorragend kochen, was auch der Grund war, weshalb Ian ihn mitgenommen hatte.
Ian stellte sich auf einen Baumstumpf und erhob die Stimme: »Dieser Vogel gehört Fürst Hox aus den Fluren. Sein Schiff ist vor Kurzem in Abrogan angekommen, um die Grüne Kompanie zu befehligen. Uns wird die Ehre zuteil, ihm zu dienen.«
»Zur Abwechslung mal geschmorten Hasen mit Steckrüben und Pflaumensauce kochen zu können, wäre mir eine viel größere Ehre«, kommentierte Schagan, und nicht wenige lachten oder nickten zumindest.
»Sei still, Schmortopf«, fuhr Dano ihn mit feuerrotem Gesicht an. »Du kannst froh sein, dass der Drottin dich überhaupt mitgenommen hat. Also sperr die Ohren auf oder verschwinde.«
»Hüte deine Zunge, Hitzkopf. Immerhin hab ich dir deine Ziegenmilch warm gemacht, als du noch ein schreiendes Bündel in einem Weidenkorb warst!«
Ian legte seinem wütenden Bruder eine Hand auf die verkrampfte Schulter – eine Geste des Danks und gleichzeitig eine Ermahnung, Ruhe zu bewahren –, dann sprach er weiter: »Hox untersteht direkt Schwarzwassers Neffen, Fürst Bryss, der der Stellvertreter des Königs hier in Abrogan ist.«
Aufgeregtes Gemurmel erhob sich unter den Männern.
»Schwarzwassers Sohn ist vor einigen Jahren gestorben«, meldete sich Petrich zu Wort. »Hat er Bryss zu seinem Erben ernannt?«
Ian zuckte die Achseln. »Das ist eine gute Frage.« Mehr als gut, dachte er. Du bist schlauer, als dein Alter vermuten lässt, Vetter.
Die Regelung der Thronfolge in Fretwitt war eine wichtige Angelegenheit für die Klans, denn ein neuer König ließ seine Fürsten und Vasallen zuerst ihre Eide erneuern. Die Klans hatten zwar ihre Ländereien behalten dürfen, aber sie gehörten nicht zur Oberschicht und hatten bei Weitem nicht die Macht der Fürsten. Sie dienten dem König, zahlten Steuern und mussten in den Krieg ziehen, wenn er es befahl, aber keiner von ihnen war je in den Adelsstand erhoben worden. So gesehen gehörten sie zur untersten Gesellschaftsklasse, fand Ian. Falls Bryss die Thronfolge übernahm und Ian seine Aufgabe zu dessen Zufriedenheit erledigte, konnte er vielleicht mehr für sich und die Seinen herausholen …
Bryss war stellvertretender Oberbefehlshaber über Schwarzwassers Truppen hier in Abrogan. Ganz wie ein König residierte er auf dem Berg Skye und befehligte fast ein Dutzend Kompanien Klanskrieger – darunter auch Ians Männer –, dazu noch über hundert Bewaffnete des königlichen Heeres, die nach Abrogan entsandt worden waren: die Rote, die Blaue und die Grüne Kompanie. Ians Krieger waren der Grünen Kompanie unterstellt, die wiederum unter Hox’ Befehl stand. Hox war ein hochnäsiger Baron, der in seiner Burg hoch über dem Großen Fluss in den Fluren Fretwitts residierte und saftige Zölle erhob. Ian hatte ihn noch nie zu Gesicht bekommen, nur seinen Papagei, aber er mochte ihn schon jetzt nicht.
»Wie bitte, Ian Krystal kommt erst an vierter Stelle?«, rief Kerr. »Zuerst der König, dann sein durchlauchter Neffe, dann der schon weniger durchlauchte Hox und dann erst unser allmächtiger Drottin?«
Die Männer lachten, wie sie es immer taten, wenn Kerr seine Scherze riss, aber sie spürten die Schmach genauso stark wie Ian. Sie waren einmal ein freies Volk gewesen, doch der Pakt, den Ians Vater mit Schwarzwasser geschlossen hatte, um die Klanskriege zu beenden, hatte sie zu Vasallen gemacht.
»Sieht ganz so aus«, sagte Ian.
Der Befehl, die Sümpfe zu durchkämmen, war eine Art Beförderung. Die Aufgabe, die Schwarzwasser ihnen ursprünglich zugeteilt hatte, war, die Erste Straße auszubauen. Niedere Arbeit. Stolze Männer voll Tatendrang dazu erniedrigt, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang mit Schaufel und Hacke eine Wegstunde Straße so zu verbreitern, dass ein Eselskarren darauf fahren konnte. Nicht zu vergleichen mit dem, was Ians Vater als Drottin hier in Abrogan erlebt hatte. Kellen Krystal war ein freier Mann gewesen, und er war weit gereist. Er hatte unglaubliche Dinge gesehen, fremdländische Völker kennengelernt, hatte zweimal den Ozean überquert und war alt genug geworden, um seine Abenteuer im Klansbuch niederzuschreiben. Der Sohn hingegen, den er zu seinem Nachfolger ernannt hatte, war zum Straßenbauarbeiter degradiert worden, musste Bäume fällen und Erde schaufeln. »Die Aufgabe ist von größter Wichtigkeit«, war ihnen erklärt worden. Die weiten Flachlande, die sich nördlich von Buchtend erstreckten, stiegen zu den Rauchhöhen hin immer weiter an. Die Wälder dort waren dicht, es gab nur zerfurchte und von Wurzeln durchzogene Trampelpfade. Kein Karren und schon gar keine Kutsche konnte dort fahren. Die fretischen Ingenatoren aber ließen nicht locker, sie wollten befestigte Straßen für den Handel mit den weit abgelegenen Dörfern Abrogans. Oder für Schwarzwassers Heer, dachte Ian. Straßen machten ein Land gleich viel kleiner und leichter zu regieren.
In Abrogan schien es kein stehendes Heer zu geben. Die Menschen hier verspürten offensichtlich kein Bedürfnis, ihr Land zu verteidigen. Bisher waren Schwarzwassers Soldaten nur auf armselige Dorfmilizen gestoßen, die mit feuergehärteten Holzspießen versuchten, die Banditen von ihren Feldern und Weilern fernzuhalten. Es gab keinen König, keine Armee, nicht einmal Verträge zwischen den weit verstreut lebenden Völkern. Abrogan schien reif, geeint zu werden, und Ians Klan wurde nun ausgesandt, um den Weg dafür zu bereiten. Erst vor Kurzem war ihnen einer von zwölf Botenvögeln zugeteilt worden, die Schwarzwassers Befehle überbrachten. Allerdings hatte Ians schmuddelige Taube weder eine so klare Stimme wie Hox’ Papagei, noch war sie auch nur annähernd so hübsch.
Bryss hatte das gesamte Hochland um den spektakulär aus den fruchtbaren Graskuppen aufragenden Berg Skye in Besitz genommen. Dort, nicht allzu weit von der Meeresküste im Süden, versammelten sich die eingeschifften Klansleute und Soldaten aus Fretwitt: in der Bergfestung des Königs und zukünftigen Hauptstadt Skye.
Bryss hatte vor, das neue Reich bis jenseits der dichten Wälder im Norden auszudehnen, wo sich ein unzugänglicher Gebirgszug erstreckte, den die Einheimischen Rauchhöhen nannten. Also waren Ian und seine Krieger nach Norden entsandt worden, um Straßen zu bauen. Immerhin ließen sich die Blätter der Schaufeln abnehmen, sodass der Schaft als Spieß verwendet werden konnte. Nur wenige seiner Männer hatten Schwerter, doch fast alle trugen einen Brustharnisch aus gesottenem Leder und eine dicke Wolfshaut über den Schultern.
Die Erste Straße so umzuleiten, dass sie direkt nach Norden verlief, statt sich durch dichte und gefährliche Wälder zu schlängeln, war harte, aber einfache Arbeit: hauptsächlich graben und Bäume fällen. Um die geschlagenen Schneisen zu befestigen, waren allerdings erfahrenere Hände nötig. Ein fretischer Ingenator kam mit einer ganzen Karawane von Wagen, die mit Asche und gemahlenem Ton beladen waren. Seine Gehilfen bestreuten den unbefestigten Boden mit der Mixtur und machten sie feucht, dann breiteten sie Farnwedel darüber und zündeten sie an, sodass das Ganze zu einer harten Fläche austrocknete.
Jenor war der Einzige, der sich für das Werk des Ingenatoren interessierte. Die anderen Klansleute konnten weder mit Straßenbau noch mit Alchemie etwas anfangen. Sie waren Kämpfer, geboren für die Schlacht und aufgewachsen während der Klanskriege in den Hügeln von Artung. Deshalb hatte es ihnen auch keine Schwierigkeiten bereitet, die marodierenden Banditen entlang der Ersten Straße abzuwehren. Fürst Bryss war das anscheinend aufgefallen, und jetzt betraute er sie mit einer neuen Aufgabe, die eher ihren Fähigkeiten entsprach.
»Der minderjährige Kronprinz will, dass wir die Sümpfe für ihn erobern?«, fragte Barsch, ein Hüne von einem Krieger, der Danos Zwillingsbruder hätte sein können, nur dass er älter war, noch grimmiger und – falls das überhaupt möglich war – bulliger.
»Wir sollen sie säubern, nicht erobern«, widersprach Ian. »Wir kommen nicht als Eroberer. In diesen Sümpfen gibt es anscheinend Wilde, die immer wieder die Pelikanstraße überfallen, die gerade von Buchtend aus entlang der Küste gebaut wird.«
»Kannibalen«, flüsterte einer der Männer angewidert.
»Das behaupten nur die plynthischen Bauern, die das Moor nie betreten.«
»Eine schöne Belohnung für unsere Dienste«, knurrte Barsch. »Zwanzig Banditen haben wir beim Bau der Ersten Straße schon den Garaus gemacht!«
»Es waren fünf, die anderen sind geflohen«, murmelte Petrich.
»Wir sind gekommen, um dieses Land zu erschließen«, erklärte Ian, »und der Sumpf ist zumindest ein Anfang.«
»Ich will keine Sümpfe erschließen«, beschwerte sich Frehman.
»Dieses Land bietet uns vollkommen neue Möglichkeiten, Männer«, versuchte Ian es noch einmal. »Der Thronerbe ist auf uns aufmerksam geworden. Und wer den Gipfel erklimmen will, muss zuerst das Tal durchwandern, wie wir in den Hügeln sagen.«
»Oder den Sumpf«, witzelte Kerr.
In diesem Moment kam ein Mann mit Priestertunika und einem aus Gräsern geflochtenen Spitzhut ins Lager gestürmt. Über seinen Schultern lag eine gelangweilt dreinschauende blaue Katze. An der Hand zog er eine junge Frau hinter sich her.
Ian runzelte die Stirn. Mit aufgebrachten Dörflern konnte er umgehen, aber diese bunten Katzen machten ihn nervös. Manchmal hatte er beinahe den Eindruck, als wären die pelzigen kleinen Biester hochintelligent und würden Besitz von den Menschen hier ergreifen. Außerdem war es weitaus einfacher, den Gesichtsausdruck eines Menschen zu deuten als den einer Katze.
Der Bauer-Priester sprudelte in seiner Sprache drauflos und deutete dabei abwechselnd auf den jungen Fregger und das Mädchen, das er am Handgelenk hinter sich herschleifte.
Kurz darauf kam auch der stotternde Junge hinzu. »Unser P-P-Priester sagt, dieser M-M-Mann hat seine Tochter zur Frau genommen«, übersetzte er.
Ian schaute ihn verständnislos an. »Du redest Unsinn. Niemand hat geheiratet.«
Der Junge deutete auf Fregger. »D-D-Doch. Der da h-h-hat sich mit ihr verheiratet.« Sein Zeigefinger wanderte zu dem Mädchen mit dem spitzen Gesicht.
»Fregger, erklär mir das.«
Fregger war ein einfacher Mann, gutherzig, aber nicht besonders klug. »Ich habe niemanden geheiratet«, sagte er nur.
»Kennst du sie?«
Er blickte das Mädchen schuldbewusst an. »Ja. Aber ich habe sie nicht geheiratet. Wenn ich um die Hand einer Frau angehalten hätte, wüsste ich das wohl. Ich weiß nicht, was dieser Katzenbeschwörer von mir will.«
»Junge, sag dem Priester, dass hier ein Missverständnis vorliegt. Vielleicht liegt es an unserer Sprache, vielleicht auch an deinem Gestammel. Wir müssen unser Lager noch heute abbrechen, und ich habe jetzt keine Zeit für ihn.«
»Einen Moment«, sagte Petrich. »Wie heiratet man bei euch eine Frau, Junge?«
»S-S-So, wie es auch die T-T-Tiere tun«, antwortete der Kleine.
»Ich verstehe«, murmelte Petrich und wechselte einen kurzen Blick mit Ian.
»Gibt es keine Zeremonie?«, fragte Ian.
»B-B-Braucht es denn eine?«
»Solange sie nicht schwanger ist, spielt das alles doch keine Rolle«, mischte Fregger sich ein.
Diesmal sprach der Junge etwas länger mit dem Priester, bevor er antwortete. »Ob ein K-K-Kind kommt oder nicht, die b-b-beiden sind miteinander verbunden«, sagte er schließlich.
»Ich habe keine Zeit für so was!«, wiederholte Ian gereizt, doch der Junge ließ nicht locker.
»Und der P-P-Priester sagt, wenn Euer Mann k-keine Ehre hat, dann wird er die Ehre seiner T-T-Tochter eben selbst verteidigen.«
Der Priester trat einen Schritt vor und hob die Fäuste.
Ian verdrehte die Augen. Der Mann war alt und ausgemergelt. Gegen einen jungen Krieger wie Fregger hatte er nicht den Hauch einer Chance.
»Womit will er denn kämpfen? Mit der Katze? Selbst wenn er ein Schwert hätte, würde Fregger ihn im Staub zertreten. Das kann ich nicht zulassen. Wir sind hier, um den Menschen Schwarzwassers Schutz angedeihen zu lassen, nicht um ihre Frauen zu rauben und die zukünftigen Handelspartner des Königs zu erschlagen.«
Petrich beugte sich an Ians Ohr, und sie flüsterten eine Weile miteinander. Die Debatte dauerte so lange, dass Fregger versuchte, sich zu verdrücken, aber Ian pfiff ihn zurück. Schließlich holte er tief Luft und wandte sich mit einem gezwungenen Lächeln an Fregger. »Du kannst dich glücklich schätzen, diese Plyntherin zur Frau zu haben, Klansmann«, erklärte er. »Wir ziehen heute weiter, aber du wirst bleiben und eine Familie mit ihr gründen.«
Fregger wurde blass. »Ich will sie nicht heiraten!«
»Du vielleicht nicht, aber die Wünschelrute zwischen deinen Beinen will es so.«
»Ich bin kein Bauer, sondern Klansmann. Ich will in die Welt hinausziehen und mir einen Namen als Krieger machen!«
»Und ich bin der Drottin der Hügel! Ich kann nicht ein ganzes Dorf gegen uns aufbringen, nur weil du deine Wünschelrute nicht im Griff hast!«
Fregger sah, dass alles Bitten nichts nützte, und ließ den Kopf hängen.
Ian nahm ihn an den Schultern und führte ihn ein Stück von den anderen weg. »Hier bieten sich viele Möglichkeiten für dich, Fregger«, flüsterte er. »Du bist hier der größte Krieger weit und breit, vielleicht kannst du sie ausbilden. Vielleicht machen sie dich sogar zur Starken Hand des Dorfes. Du wärst eine Berühmtheit.«
»Ich gehöre nicht zu ihnen, sondern zu euch, meinem Klan.«
»Wir werden dich besuchen. Du bist unser Botschafter hier. Du wirst ihnen unsere Sprache beibringen und Freundschaften schließen, damit wir willkommen sind, wenn wir zurückkehren. Außerdem kannst du ab jetzt in aller Offenheit mit deiner Frau tun, was du bisher immer heimlich tun musstest. Bleib. Erfreue dich an ihr. Sei ein guter Ehemann. Mach dir einen Namen als Krieger und Ehrenmann.« Mit diesen Worten stieß er Fregger sanft in Richtung des Priesters. »Fregger wird fortan als unser Gesandter in diesem Dorf leben und Blutsbande zwischen Plynth und dem Hügelkuppenklan schmieden!«, rief er den anderen zu, und der ganze Klan jubelte und grölte. »Junge, sag dem Priester, dass wir einen Ersatz für unseren tüchtigen Soldaten brauchen. Einen jungen Mann, der die Lücke ausfüllt, die er hinterlässt.«
Der Junge übersetzte, und der Priester blickte verdrossen drein. Es dauerte eine Weile, bis er antworte, und Ian wurde bereits ungeduldig.
»Es wäre sehr h-h-hart für uns, so k-kurz vor der Ernte einen F-F-Feldarbeiter zu verlieren«, brachte der Junge schließlich heraus. »Und unser P-P-Priester will wissen, w-w-wen Ihr als Ersatz haben wollt.«
»Das kann ich ihm sagen«, erwiderte Ian ohne Zögern.
»W-W-Wen?«, fragte der Junge kleinlaut.
Ian grinste. »Dich.«
2
Die Rinde der Bäume war vollkommen glatt. Sie wuchsen etwa drei Meter senkrecht in die Höhe, dann neigten sie sich zur Seite, bis sie in ungefähr fünf Metern Entfernung wieder den Boden berührten. Wie ein Säulengang wölbten sie sich über den grünlich braunen Trampelpfad, auf dem Ian, Dano, Kerr und Petrich vorausmarschierten. Der Morast war nicht tief, trotzdem machte er das Laufen beschwerlich. Die ledernen Panzerplatten an den Beinen der Männer waren tropfnass und schwer.
Dano runzelte die Stirn. »Ich begreife nicht, weshalb du Fregger gegen diesen mickrigen Jungen eingetauscht hast. Wir haben einen guten Soldaten in unseren Reihen weniger und dafür einen Dolmetscher, der nicht sprechen kann.«
»Wir haben einen Idioten weniger in unseren Reihen«, murmelte Petrich.
»Und einen Führer, der sich in diesem Land auskennt«, fügte Ian hinzu. »Wie heißt dieser Ort, Junge?«
»T-T-Totenmoor, der g-g-große Sumpf.«
Kerr lachte. »Hört, hört! T-T-Tod und S-S-Sumpf.«
»Ich sehe nichts als Schlamm«, knurrte Dano.
»Fürchte dich nicht, Starke Hand«, zog Kerr ihn auf. »Ich bin da und beschütz dich.«
»Ich fürchte mich nicht vor Schlamm, aber er geht mir auf die Nerven. Genauso wie du.«
Da kam Rall herangestapft. Sein Bart war verklebt von dem Saft einer faustgroßen Frucht, die er bereits zur Hälfte verspeist hatte. »Seht mal, was wir gefunden haben«, sagte er mit einem Grinsen. »Blaue Zuckerkugeln.«
Der junge Plynther zupfte Ian am Ärmel. »D-D-Die b-b-blaue Frucht nicht essen.«
»Pah! Das Obst ist so reif wie nur was«, polterte Rall. »Schmeckt ganz süß.«
»Warum soll er sie nicht essen?«, fragte Petrich.
Der Junge versuchte es zu erklären, aber das Stottern machte alles nur noch schlimmer.
Rall lachte. »Der kleine Narr hört sich an, als hätte er selbst das Maul voll davon.«
Der Junge verstummte mitten im Satz und versteckte sich zwischen Ian und Dano. Sie hatten ihn »Flosse« getauft, weil seine Ohren immer zitterten wie Fischflossen, wenn er aufgeregt war. Außerdem konnten sie seinen plynthischen Namen nicht aussprechen. Der Kleine schien ohnehin nicht sonderlich daran gehangen zu haben, und Ian hatte ihn bereits vergessen.
»Deine Ohren zittern, Flosse. Hast du was gesehen?«
»I-I-Ich weiß nicht, aber …«
Ein Ächzen ertönte zwischen den Bäumen zu ihrer Rechten. Ians Männer rissen die Speere hoch und gingen in Kampfstellung. Petrich hingegen breitete die Arme aus und riss alle um ihn herum mit zu Boden. Nur Flosse stand wie gelähmt da, als der riesige, an Lianen befestigte Baumstamm von rechts heranraste und genau über die Stelle hinwegfegte, wo zuvor noch die Köpfe der Männer gewesen waren. Als er wieder zurückschwang, kam er weniger als eine Armeslänge über Flosses zitternden Ohren zum Stehen, und alle sahen die scharfen Dornen, die über die gesamte Länge aus dem Holz ragten.
»Eine Falle!«, rief Dano zornig und sprang auf die Beine.
Ian spuckte den Schlamm aus, den er geschluckt hatte, und packte seinen Bruder. »Runter, alle! Außer ihr wollt euch aufspießen lassen.«
Sie rotteten sich zu einem dichten Haufen zusammen und kauerten sich in den knietiefen Morast. Die Speere und Streitäxte streckten sie in die Luft wie ein waffenstarrender Igel und blickten sich argwöhnisch um. Keiner wagte sich zu rühren.
»Siehst du sie, dort drüben zwischen den Bäumen?«, flüsterte Petrich.
»Ja.« Ian hatte scharfe Augen und war geübt darin, Feinde zu erspähen, selbst wenn sie nahezu mit dem Gelände verschmolzen. »Einer hat einen Speer, aber keinen besonders gefährlichen. Sieht eher aus wie ein Spieß, den sie zur Froschjagd benutzen.«
»K-K-Kannibalen!«, keuchte Flosse mit klappernden Zähnen.
Kerr legte ihm eine Hand auf die Schulter – weniger um ihn zu beruhigen, als um ihn zum Schweigen zu bringen.
Petrich beäugte ihre Beobachter neugierig. »Ihre Haut ist eigenartig grün und braun gefleckt. Zuerst dachte ich, sie hätten sich mit Schlamm und Blättern beschmiert, aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher …«
»Ich sehe sie immer noch nicht«, flüsterte Dano.
»Halte nach ihren Augen Ausschau, sie heben sich hell vom Rest des Waldes ab«, flüsterte Petrich zurück.
»Sie greifen nicht an«, bemerkte Kerr, während Dano angestrengt in den Wald spähte.
»Weil wir zu stark sind«, erwiderte Dano stolz. »Sie haben Angst vor uns.«
»Oder sie warten, bis ihre nächste Falle zuschnappt«, sagte Ian, der in einiger Entfernung noch weitere an Lianen aufgehängte Baumstämme entdeckt hatte. Mit einer Handbewegung signalisierte er seinen Männern, in Deckung zu bleiben. Dann stand er zum Entsetzen aller auf, sprang aber sofort hinter dem Baumstamm, der bereits ausgelöst worden war, in Deckung. »Flosse, ich möchte mit ihnen reden. Kannst du für mich übersetzen?«
Flosse zitterte immer noch am ganzen Leib und rührte sich nicht von der Stelle, bis Kerr ihn vorwärtsschob.
»Komm schon, Junge!«, rief Ian.
Flosse lief zu dem dornenbewehrten Baumstamm und stellte sich neben Ian. »Ich k-kann es m-m-mit meiner eigenen Sprache v-v-versuchen.«
»Dann sag was zu ihnen.«
»Aber w-w-was?«
»Irgendwas. Ich will sehen, ob sie reagieren. Begrüße sie einfach.«
Flosse tat, wie ihm geheißen, brachte aber nicht viel mehr heraus als ein verängstigtes Quieken. Es kam keine Antwort.
»Sag ihnen, dass wir wissen, dass sie hier sind«, sprach Ian weiter. »Sag ihnen, dass ich sie sehen kann, den einen hier drüben zum Beispiel, den auf dem zweiten Ast des großen Baums da.«
Ian deutete in die entsprechende Richtung, und Flosse übersetzte.
Wieder blieb alles still, bis sich plötzlich eine dunkle Gestalt aus dem Gebüsch direkt vor ihnen schälte – viel näher, als Ian für möglich gehalten hätte. Er tat sein Bestes, Ruhe zu bewahren, während die grün-braune Kreatur aus ihrem Versteck kam.
Flosse wurde totenbleich, als der Waldmensch ein paar kehlige Laute ausstieß. »E-E-Er spricht!«
»Mach’s nicht so spannend. Was sagt er?«
»Es k-klingt wie p-p-plynthisch. Er s-s-sagt, wenn Ihr einen von E-E-Euch dalasst, lässt er die anderen g-g-gehen.«
»Wozu soll ich ihm einen von meinen Männern geben?«
»Sie haben H-H-Hunger.«
Ian unterdrückte die Übelkeit, die in ihm aufstieg, und nickte, als wäre das der erste vernünftige Vorschlag, den er an diesem Tag gehört hatte.
»Sag ihm, ich kann ihm keinen von meinen Männern geben.«
»D-D-Dann werden sie uns alle t-t-töten.«
»Sag ihm, dass ich seine Zweifel spüre. Wenn sie so siegessicher wären, hätten sie uns längst angegriffen. Ich möchte verhandeln.«
»V-V-Verhandeln?«
»Genau. Frag ihn, was sie wollen.«
»Sie w-w-wollen uns essen.«
»Sagt er das oder du?«
»I-I-Ich sage das. Ich w-w-weiß es. Das sind K-K-Kannibalen.«
»Deine Aufgabe ist es zu übersetzen, nicht mir Ratschläge zu erteilen. Frag ihn.«
»Er b-bleibt dabei. Er w-w-will einen Mann.«
»Aha, aber es muss nicht unbedingt einer meiner Männer sein. Irgendeiner tut es auch, richtig?«
Flosse übersetzte nur widerwillig, als fürchtete er, er wäre derjenige, den Ian zurücklassen wollte.
»Ja. I-I-Irgendeiner tut’s auch. Er w-will nicht k-k-kämpfen, aber er warnt Euch, dass seine L-L-Leute den Sumpf kennen und Eure nicht.«
»Wohl wahr. Aber wir sind besser bewaffnet, und meine Männer sind Krieger, die besten ihres Klans. Wir sind keine leichte Beute. Sag ihm das.«
»Er s-s-sagt, sie n-n-nehmen nur deshalb lebende Menschen, weil die T-T-Toten nicht mehr in den Sumpf gebracht werden.«
»Schwarzwasser hat es verboten«, flüsterte Petrich aus ein paar Metern Entfernung. »Er hat verfügt, dass ab jetzt in Plynth und Buchtend nur noch ordentliche Begräbnisse stattfinden dürfen.«
»Ah.« Ian nickte. »Flosse, sag unserem schlammfarbenen Freund, dass meine Männer sich nicht gerne bei lebendigem Leib fressen lassen, wir aber gewillt sind zu verhandeln.«
»Er s-s-sagt, Ihr sprecht offen und ehrlich, und er w-w-wird verhandeln.« Flosse begann wieder zu zittern. »A-Aber Ihr werdet ihm nicht wirklich einen M-M-Menschen zum F-Fressen geben, oder?«
»Nein. Nicht einen, sondern viele. Sag ihm, ich werde ihm alle sieben Tage einen bringen, wenn er und seine Leute in Zukunft die Finger von denen lassen, die durch dieses Moor kommen.«
Flosse starrte ihn entsetzt an.
»Sag es ihm, Junge, wenn du nicht willst, dass es hier gleich Tote gibt.«
Flosse übersetzte.
»Er f-f-fragt, wie Ihr das m-m-machen wollt.«
»Banditen und Straßenräuber werden gehenkt. Das passiert alle sieben Tage mindestens einmal. Diebe müssen nicht ordentlich beerdigt werden. Wir werden die Leichen hierherbringen, dann können sie mit ihnen machen, was sie wollen. Im Austausch garantiert er mir, dass seine Leute sich von den Straßen fernhalten. Andernfalls kommen beim nächsten Mal nicht vierzig Soldaten, sondern vierhundert.«
Flosses Stimme zitterte heftig, während er sprach, aber die Botschaft schien verstanden worden zu sein, denn die grünliche Kreatur kam nun mit einem Lächeln auf sie zu.
Ian stand auf. Das Herz schlug ihm beinahe bis zum Hals.
Flosse schrie entsetzt. »E-E-Er kommt!«
»Das sehe ich, Junge. Und jetzt geh ein Stück beiseite, übersetz aber weiter.«
Der Moormensch sagte etwas.
»Er will die A-A-Abmachung mit B-B-Blut besiegeln«, erklärte Flosse.
»Ich werde mein Blut nicht mit dem seinen vermischen, aber ich kann etwas von meinem vergießen, wenn er es wünscht.«
»J-Ja, das g-g-genügt.«
Der Kannibale stand mittlerweile direkt vor Ian. Er war klein gewachsen und roch wie faulige Algen in Brackwasser. Er streckte einen Arm aus und stach sich mit seinem dünnen Speer in die Handfläche.
Ian zog sein Schwert, fuhr sich mit der Klinge über den Unterarm und ließ sein Blut auf die schlammige Erde tropfen.
Sein Gegenüber fing das Blut blitzschnell mit der Hand auf und trank es.
Seine Männer schnaubten angewidert, aber Ian gebot ihnen zu schweigen.
Schließlich streckte der Kannibale seine blutende Hand aus.
Ian schüttelte den Kopf. »Ich bin es zufrieden. Ich brauche nicht zu trinken. Sag ihm, bei uns ist es Brauch, lediglich die Waffen zu kreuzen.« Mit diesen Worten streckte er sein Schwert vor. Einen Moment lang war er versucht, es auch zu benutzen, doch der Moment ging schnell vorüber.
Als Flosse übersetzte, beäugte der Moormensch beeindruckt Ians Schwert. Sein eigener, im Feuer gehärteter Holzspeer war nichts im Vergleich zu der stählernen Klinge. Er befühlte sie ehrfürchtig, klopfte mit seinem dünnen Holzstecken einmal dagegen und hielt dann sieben ausgestreckte Finger hoch.
»Er sagt, Ihr habt sieben T-T-Tage Zeit, die erste Leiche zu übergeben«, erklärte Flosse. »D-D-Danach fangen sie wieder an, d-d-die Reisenden zu fressen.«
Ian rief Schagan herbei und ließ sich eine in Sackleinen gehüllte Rinderkeule aus ihrem Proviant geben. Er wickelte die Keule aus und hielt sie hoch.
»Ein Geschenk, damit ihr bis zu unserer Rückkehr euren Hunger stillen könnt«, sagte er.
Schagan beobachtete mit traurigem Blick, wie das saftige Stück Fleisch den Besitzer wechselte, widersetzte sich seinem Drottin aber nicht.
»Und sag ihm, sie sollen ihre Fallen entschärfen, bis wir aus diesem gottverdammten Wald draußen sind. Das ›Gottverdammt‹ lass lieber weg.«
»Er v-v-verspricht es«, erwiderte Flosse.
»Eine letzte Frage noch: Wie heißt er?«
»Sein Name ist B-B-Brak.«
»Auf bald, Brak«, sagte Ian.
Nachdem die Verhandlungen beendet waren, zog sich der freundliche Kannibale mit seiner Beute zurück und verschwand im Unterholz. Auch von seinen Kumpanen war nichts mehr zu sehen.
Ian und seine Krieger waren wieder allein. Wie vom Donner gerührt kauerten sie immer noch im Morast und wagten endlich wieder zu atmen.
3
»Unser Bruder ist verrückt«, schimpfte Dano.
»Oder genial«, entgegnete Kerr.
»Vielleicht etwas von beidem«, warf Petrich ein. Er saß neben ihnen auf einem umgestürzten Baumstamm, die durchnässte Hose und das Hemd hatte er zum Trocknen darauf ausgebreitet. Bis auf den kleinen Lederbeutel, der mit einem Riemen um seine Hüfte befestigt war und der direkt neben seinen Genitalien baumelte, war er splitternackt.
Sein Schatz, dachte Ian.
Der Rest des Klans hatte sich über eine Wiese verteilt. Wie zottige Schafe rekelten sie sich in der Sonne, genossen die Wärme und die wohlverdiente Ruhepause und aßen sich, so gut es ging, ohne Rinderkeule satt, bevor sie nach Buchtend weitermarschierten, um Fürst Hox von den erfolgreichen Verhandlungen im Totenmoor zu berichten. Die anderen beiden Kompanien waren nach Norden und Westen entsandt worden, um Kontakt zu den an den Seen gelegenen Städten und den Fischerdörfern an der Küste aufzunehmen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!