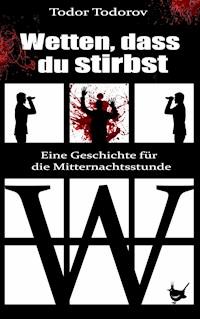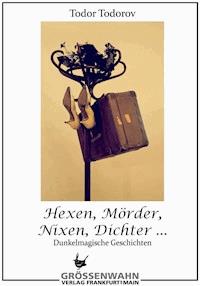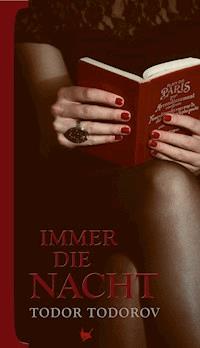
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Größenwahn Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wenn der Tag seine letzten Bronzeschuppen abwirft, der Horizont mit Dunkelheit umhüllt wird, eine angespannte Stille über das Land die Macht übernimmt, und die müden Augen durch plötzliche Gedanken geöffnet werden, dann ist es Zeit, die Nacht willkommen zu heißen. Denn sie bringt Geschenke mit: die magischen Momente, die träumerischen Halluzinationen, das Unmögliche, das Irreale und das Unglaubliche. Den Geist durchdringt die Fantasie. Nachts. Immer nur nachts. Todor Todorov beweist wieder einmal mit diesen Geschichten, dass er ein begnadeter Meister der Sprache ist. Er führt den Leser mit absoluter Sicherheit durch das Delirium der Nacht und lässt ihn in einem Film-Noir als Komparse ein verrücktes Spiel miterleben. Das Drehbuch besteht aus plötzlichen Wendungen von Wahn und Verbrechen. Hier treffen sich unheilvolle Träumer, Stadtschamanen und Telefonmörder. Alles und Alle bewegen sich auf einem magischen Untergrund: Wörter, Gefühle, Bilder. Die Farben der Dunkelheit. Du und Ich. Gefährliche Geschichten von hier bis zum Rand der Welt. Nachts, wenn die Erinnerung erwacht. "In der Dunkelheit ist nichts Dunkles. Die Nacht hat ein leuchtend rotes Herz. Und alles ist rot."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Immer die Nacht | Reihe: Via Egnatia
Todor Todorov
Immer die Nacht
14 Geschichten am Rande der Welt
Aus dem Bulgarischen von Elvira Bormann-Nassonowa
der gott der nacht
das fünfundzwanzigste bild
dort unten
ein weiteres zimmer
ein
fünfzehn minuten
immer die nacht
knut svenson
magda
manchmal im norden
niemand soll die erde berühren
rezept für eine welt
setz-auf-tod.com
taube unterm hut
von der natur verführt
biographisches
Die Deutsche Nationalbibliothek – CIP-Einheitsaufnahme. Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet dieses Buch in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
This book was published with the support of the program National Book Center at the National Palace of Culture
Erste Auflage 2016 © Größenwahn Verlag Frankfurt am Main, 2016 www.groessenwahn-verlag.deAlle Rechte vorbehalten. ISBN: 978-3-95771-081-9 eISBN: 978-3-95771-082-6
IMPRESSUM
Immer die Nacht
Reihe: Via Egnatia
AutorTodor Todorov Erschienen 2012 bei Ciela Verlag: Издателство Сиела, Sofia, BG Originalausgabe: ›Винаги нощта‹ © Todor Todorov
ÜbersetzungElvira Bormann-Nassonowa
SeitengestaltungGrößenwahn Verlag Frankfurt am Main
SchriftenConstantia und Lucida Calligraphy
CovergestaltungMarti O´Sigma Coverbild © Todor Todorov
LektoratEdit Engelmann
Gößenwahn Verlag Frankfurt am MainrFebruar 2016
ISBN: 978-3-95771-081-9 eISBN: 978-3-95771-082-6
Seit drei Nächten bin ich schon hier. Ich glaube nicht, dass es einen Ausweg gibt. Und es ist mittlerweile auch egal. Das Einzige, was mich jetzt interessiert, sind die Nächte. Immer die Nächte.
Ich weiß nicht mehr, weshalb ich hier bin, unter diesen Wilden. Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass ich ein Glas Malt-Whisky leere. Eine Boeing 747. Hinter der Scheibe nur ein grenzenloser, blauer Himmel. Das Eis klimpert im Glas. Ich nicke ein.
Als ich erwache, sehe ich, wie die Sonne in dichten Gewitterwäldern versinkt. Gewitterwäldern. Diese grimmigen Bergrücken verwilderten Grüns scheinen jeden Moment loszutoben und dabei aus ihrem aufgewühlten Schoß Wind, Chaos und Schrecken in die ganze Welt zu schleudern. Der Himmel wirkt dunkel und schwer. Stählern. Es ist kalt.
Ich lebe inmitten ursprünglicher Gerüche. Ich stinke nach Kot, faulen Früchten und Schweiß. Frisches Blut. Leben im Rohzustand. Das Original.
Am ersten Abend bringt man mir bunte, getrocknete Blätter, zu einer Rolle geformt. Die Rolle ist mit einem dicken, braunen, zuckerähnlichen Gemisch gefüllt. Nachdem sie sie angezündet haben, sauge ich daran und mein Kopf füllt sich mit Rauch. Ich beobachte die nackten, schmutzigen Körper der Wilden und sie erscheinen mir immer abartiger. Ich höre das Donnern der Erde, während sie herumspringen, dann schwinge ich mich mühelos nach oben. Mein Flug ist still, ein nächtlicher Kreis am Himmel, langsam tauche ich mit dem Körper in den kühlen Tau der Wolken. Ich sehe die Teilung der Zellen, die elektrische Strahlung der Moleküle, das Leben, die Arterien, in denen das Blut kocht, die Wut, das Verlangen, die Schlafenden, in der Erde erkaltete Gehirne, aus denen im Frühjahr Schneeglöckchen wachsen, Tod im Herzen der Sonne, stehlende Augen, ich sehe die Geschwindigkeit des Spermas, den Todesengel, die Geburt der Erde und die geheime Alchimie des Schlafes, Liebe und Schrecken überall unter dem Dach der Nacht.
Als ich erwache, spüre ich einen dumpfen Schmerz im Kopf, mein Mund ist zur Faust geballt und ausgebrannt vor Durst. Glücklicherweise entdecke ich neben meinem Kopf ein Tongefäß, das mit klarem, kaltem Wasser gefüllt ist. Ich stille meinen Durst und schlafe wieder ein unter den massiven gelben Strahlen einer tropischen Sonne.
Bei Sonnenuntergang unternehme ich meinen ersten Fluchtversuch. Noch weiß ich nicht, dass es auch der letzte sein wird. Ich schleiche mich durch Farne, rötliches Gestrüpp, Dornenbäume und Sumpflöcher. Nach etwa einer halben Stunde wird die Dämmerung intensiver. Noch immer dringt kein Zeichen zu mir, dass mir jemand auf den Fersen ist. Ich tauche in den Ozean des Dschungels ein, es wird feucht und kalt und ich denke sehnsuchtsvoll an die hässlichen Wilden, ihre wärmenden Feuer und aufgerollten bunten Blätter, gefüllt mit Zucker und Mondstaub, von dem sich das Gehirn entleert, indem es die Nacht begattet. Um mich herum verschlingen riesige Raubfalter Vögel und werden selbst von monströsen Raubblumen gefressen, die von der Dunkelheit und dem Duft der Nacht geweckt worden sind. Ich laufe weiter in der zermalmenden Anmut des natürlichen Kannibalismus. Allerorten hacken verängstigte Geschöpfe, deren Augen von der Dunkelheit vergrößert sind, mit dem Stachel ihrer Schnäbel ins Fleisch des Nächsten. Die Natur frisst sich auf. Natürlich verliere ich die Hoffnung, nachdem ich mir noch eine Stunde lang den Weg durch ein Dickicht von Mücken gebahnt habe, um schließlich wieder vor dem Feuer zu stehen, an dem mein Stamm die Gräser der Nacht anzündet. Am Ende meiner Kräfte lasse ich mich auf den Boden fallen und starre lange in den schwarzen Himmel.
Die Wilden sprechen nicht. Ihr Leben ähnelt eher dem der Blumen, der Gräser, dem Qualm und Rauch ihrer Kräuter, dem donnernden Gewitter, den blinden Augen des Schmetterlings. Sie leben nicht wie auf einer Insel inmitten der Natur. Sie sind alles, was die Natur ist. Jeder Sternenstrahl, jeder Tropfen Gift. Sie sind in ihr, organisch umschlossen wie im Mutterleib, ihr Leben fließt aus dem Schoß der Natur, wie das Blut durch die Venen strömt. Grausam und vollkommen unschuldig.
Nur wenige von ihnen geben artikulierte Laute von sich, und diese stellen eher einen Rhythmus dar, ein Mandala wiederkehrender Töne, als wirkliche Worte. Das sind die Stammesweisen, die Schamanen, die viele Stunden in der Dämmerung singen, während sie vor den starren Blicken ihrer urgesellschaftlichen Kameraden ihre geistreichen Kräuter rauchen.
Tagsüber geschieht im Wesentlichen nichts. Lediglich die Hitze. Eine verzehrende, schneidende Hitze. Und das Warten auf die Nacht.
Am dritten Abend bringt man das schönste Mädchen des Stammes zu mir, eine dunkelhaarige Indianerin mit brauner Haut und feuchten, schwarzen Augen. Die Wilden machen Feuer, rauchen Gras und erwarten offenbar, dass ich sie mir nehme. Ich verliere keine Zeit. Ich knabbere an ihren schönen, dunklen Brüsten, öffne ihre Schenkel, ihre Knie, ihre Lippen. Während ich sie liebe, spüre ich, wie sich die Erde um mich zu drehen beginnt, ich bin die Erdachse, der Baum der Erkenntnis, das Totem und das Tabu. Das Mädchen kreischt und wirft den Kopf nach links und rechts, und ich stoße sie noch stärker, prähistorisch. Ich habe es nicht eilig, lasse mich in ihr aufgehen, in ihrem feuchten Innern, für einen Augenblick in der ewigen Nacht des unsichtbaren kosmischen Uterus versunken. Nachdem ich einmal für kurze Zeit die schmale Insel der Glückseligen betreten habe, erinnere ich mich plötzlich, wie das Meer meine Füße umspülte, an das Geräusch des Wellenschaumes und gleichzeitig an die geschmeidige Stille der Winternächte im Gebirge. Eine episodenhafte Eruption der Sinne. Die ekstatische Erinnerung dauert einen Lidschlag lang. Dann lodert alles auf, mein Penis entfaltet sich in ihr wie ein Edelweiß, während ich lange und überreichlich komme.
Am nächsten Tag darf ich mich ausruhen. Man serviert mir Brühen, aromatische Tinkturen und saftige, fleischige Früchte. Das behagt mir. Ich würde gern der hiesige Gott werden. Der Gott der Nacht. Die Blätter werden bläulich, als die Sonne im Westen untergeht, der Schleier der Finsternis fällt herab. Wieder träume ich von der Nacht.
Der vierte Abend. Die Wilden versammeln sich um das rituelle Feuer, atmen die Dämpfe von Riesenschirmpilzen und lila Baumrinden ein, die langsam in den Flammen verschwinden. Ihre Augen pulsieren – stumm-erstaunte Blicke, in der Dunkelheit blass erscheinende Gesichter, lange knochige Finger, indianische Magie, schwarze Schatten, schwarze Nacht, schwarze Hirne. Sie binden mich an Holzbalken, die sie zu den lüsternen Feuerzungen tragen. Für mich wurde ein breites Floß angefertigt, das sie nun über den Flammen herablassen. Für einen Moment erblicke ich das Mädchen von gestern – ihr Haar ist hinten zusammengebunden, sie hat reine Haut, ihre Augen leuchten im Dunkel. In ihrem Schoß trägt sie eine Gottheit.
Alles hatte – ich kann mich noch gut daran erinnern – an einem verregneten Morgen am achtzehnten Oktober begonnen. Also, ich stehe nackt am Fenster und atme ruhig die kühle Luft ein. An einem solchen Tag sind die Straßen nass und still. Das Fenster steht offen, der Wind bauscht die Gardine leicht auf, am Glas laufen feine Wasserspritzer hinab. Es ist grau. Und dieser Regen, diese Tropfen! Sie machen das Leben zu einem Traum. Die ganze Nacht über, an der Fensterscheibe, trägt mich der Regen wie ein Zug … Vom Sommer verbrannte, buntzerzauste Blätter flackern wie verspätete Feuer durch die Straßen. Der Herbst ist eine zu Gemüte gehende Jahreszeit. Ich will mir gerade eine Tasse heiße Schokolade machen, als ich sie erblicke. Die Autos. Sie stehen auf der anderen Straßenseite, aneinandergereiht, eine lange Wagenschlange. Und alle rot. Ohne Ausnahme. Eben fange ich an, mich darüber zu wundern, da bemerke ich ein kleines Mädchen, das auf den Eingang des gegenüber liegenden Hauses zueilt, mit einer Schultasche auf dem Rücken. Diese ist rot. Ich sehe ihr nach, wie sie den Bürgersteig entlanggeht, dann verschwindet sie in der Tür und entzieht sich meinem Blick. Ein Mann im grauen Trenchcoat überquert die überschwemmte Straße, er trägt eine dunkle Aktentasche. Mit der anderen Hand öffnet er einen großen, leuchtendroten Regenschirm. In diesem Augenblick höre ich auf nachzudenken. Ich wende den Blick zur Seite, wo ein einsamer Kombi, ein Familienauto, vor dem Eingang zum Nachbarwohnblock parkt. Auch er ist rot. Vor dem Eingang macht sich eine Frau zu schaffen, in einen ebenso roten Regenumhang gehüllt. Und das ist noch nicht alles. Im Korridor, liederlich verteilt, ein Paar rote Damenschuhe. Mit Absätzen. Daria.
Später stelle ich fest, dass die Sitze im Bus des öffentlichen Nahverkehrs ausgewechselt wurden. Die neuen sind rot. Wie das Armaturenbrett. Neben mir wühlt ein junges Mädchen mit Kopfhörern auf den Ohren in ihrer Handtasche nach dem Fahrschein. Sie hat lange, zarte Finger, große Hände, die Nägel wirken matt vom roten Lack. Ihr Gesicht kann ich nicht sehen, es ist in das lange, rote Haar gehüllt, während sie gebeugt dasteht, den Blick unverwandt in die Tasche gerichtet. Ich hebe den Kopf und starre durch das Fenster. Auf der anderen Seite ragt an der Ecke einer Nebenstraße grell und unerschütterlich ein »Betreten verboten«-Schild. Alles ist rot. Wir stehen im Stau, die Bremslichter der Autos leuchten im grauen Nebel. Das kann nicht alles an einem Tag passieren, denke ich, oder ich habe vielleicht den Faden verloren, doch andererseits erscheint mir alles so natürlich, alles ganz normal, so wie vorher. Wie es sein muss und immer war. Es gibt einen richtigen, sicheren Blickpunkt, der immer wieder entgleitet, stets außen vor bleibt, dort, wo das Leben zusammenläuft, und doch – bei aller Absurdität der Tatsachen bin ich mir sicher, gerade jetzt genau auf ihm zu stehen. Alles ist wahr.
Ich steige die Stufen der Universität empor, und als ich in den zweiten Stock gelange, überkommt mich ein merkwürdiges, schreckliches Gefühl, das unmerklich in einen süßen Taumel übergeht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Habe ich diesen Korridor schon einmal gesehen? Der dunkle Marmor, die Quadrate auf dem Boden, der Geschmack nach Karamellbonbons. Schwarze Schirme und Frauenstimmen. Meine barfüßigen Schritte auf dem kalten Stein. Ich laufe. Ich laufe und atme hastig. Ich spüre meine gesamte, kaum wahrgenommene Kraft. Sie strömt in meinen Venen und ich lache. Ein Kinderlachen. Mein Kinderlachen. Ich mag Karamellbonbons. Ich bin nicht in der Universität. Diese Stufen führen anderswo hin. Wie ein Buch, das plötzlich in ein anderes Buch geraten ist, man muss nur umblättern und liest weiter.
Ich stehe am offenen Fenster, der blaue Vorhang kräuselt sich zusammen mit dem Meer, dem Himmel, dem Wind. Es ist Sommer. Blauer Sommer. Sie kommt vom anderen Ende des Zimmers langsam auf mich zu, sie lächelt, wendet den Blick nicht von mir. Sie sagt nichts. Ihr langes schwarzes Haar fällt gerade am Hals vorbei am Körper hinab, auf der hellen Haut, im Halbdunkel. Ihr Körper ist zierlich, sie bewegt sich wie ein Panther, ihre Finger sind lang und schmal. Sie schaut mir unentwegt in die Augen. Sommernächte wie diese sind blau wie die Bilder van Goghs – ein öliges, dichtes, wild gewordenes Blau in einer leichten und zarten Linienführung. Leichte Nächte. So fällt das Atmen leichter. Wenn Sophie in der bläulichen Dämmerung neben mir einschläft, beobachte ich sie im Dunkeln, und der Geschmack von reifen Brombeeren, aus der Kindheit aufgetaucht, erhellt plötzlich meinen Halbschlaf. Das Fenster ist offen und die nächtliche Brise erfüllt das Hotelzimmer wellenförmig mit blau-schlaftrunkenen Düften.
Als ich das Hotel verlasse, geht Daria neben mir. Sie ist blond, hat stechende Augen und trägt eine Jacke. Es ist kalt. Die Regen-Jahreszeit. »Komm zurück«, sagt sie. Es ist still. Der Wind raunt in den Pappeln, man hört einen Vogel schreien.
Was hat das zu bedeuten? Das Leben gleicht einem Buch, in dem man wahllos liest, weil der Text monoton und unübersichtlich wird, der Stoff sich wiederholt, dann blättert man verzweifelt vorwärts, rückwärts, springt insgeheim gleich zur Auflösung, kehrt dann zum Anfang zurück, liest von Neuem, liest ein anderes Buch. Man liest es noch einmal. Blättert. Ein erbarmungsloses Spiel von Vorstellungskraft und Gedächtnis.
Ich sitze im Museumscafé, habe eine Tasse heiße Schokolade bestellt. Am Fenster hängen Eissterne, draußen schichtet sich der Schnee zu dicken Haufen. Die Wände sind blassblau; während mein Blick umherschweift, stößt er auf verschiedene gerahmte Plakate. In der Ecke führt ein Pärchen ein kaum hörbares Gespräch, eher ein Flüstern, am Fenster liest ein leicht ergrauter Mann mittleren Alters ein Buch. Da geht die Tür auf. Ein hoch gewachsenes, schlankes Mädchen kommt herein, setzt sich an den Nebentisch und stützt den Kopf in die Handflächen. Sie bestellt nichts, ihr Blick verschwindet irgendwo direkt vor ihr, einige Minuten lang rührt sie sich nicht. Plötzlich dreht sie sich um und starrt mich an. Sie schweigt. Sie hat dunkle Augen und einen lila Schal. Es dauert eine Weile, bis ich bemerke, dass sie lächelt. Sie wendet ihre Augen nicht von mir ab. Es riecht nach Kakao. Natürlich, das kommt von meiner Tasse. Jäh komme ich zu mir und bestelle noch eine. Die Schokolade ist ein wunderbarer Anlass. Für alles Mögliche. Ich hatte das Mädchen einige Male in der Galerie gesehen, während wir lässig Glasköpfe an den Wänden betrachteten. Deshalb kommt das Gespräch leicht in Gang, wir reden über moderne Kunst, die Köpfe, den Winter und die Farbe Lila. Das ist Sophie. Angenehm, sage ich, und habe einen bitteren Geschmack nach Süßem im Mund. Von der Schokolade. Das Mädchen scheint mir ein wenig traurig zu sein, wie unter Wasser, deshalb höre ich nicht auf zu reden. Ich erzähle von meiner Arbeit, den Sternen, Sternbildern, Himmelskörpern und himmlischen Körpern, ich erzähle ihr, wie sehr ich Astronomie liebe – die Kunst, das Unerreichbare beim Namen zu nennen. Wie sehr ich den Orion liebe, der in blauen Sommernächten erscheint.
Oder war es vielleicht ganz anders?
Ich gehe ins Museumscafé. Drinnen ist es leer, keine Gäste, nur ein Mädchen sitzt mit dem Rücken zur Tür, ihr Blick wandert durch das Fenster. Es ist Spätsommer oder Frühherbst. Sonnenuntergangszeit. Die Wände des Cafés sind nackt, karminrot, in weichen Farben. Sie sitzt am Fenstertisch und schaut weiter nach draußen, in die Abendröte gebadet. Sie hat dunkle Augen und einen lila Schal. Das ist Sophie. Ich setze mich neben sie und sage nichts. Ich bestelle eine Tasse heiße Schokolade. Es ist ein verabredetes Treffen. Ich habe hier zu tun, sie auch. Wie sprechen nicht über moderne Kunst, den beginnenden Herbst oder die Farbe Lila. Sie übergibt mir eine kleine, graue Aktentasche, stützt den Kopf in die Handflächen und lächelt. Wir schweigen beide. Stille, kaltblütige, unverwüstliche Stille. Ein kleiner Hollywood-Auftritt. Und es duftet nach Schokolade. Ich will ihr vom Orion erzählen.
Daria habe ich kennengelernt, kurz nachdem ich bei der Polizei angefangen hatte. Zwei Jahre, bevor ich den Fall »Sophie« übernahm. Sie ist ein heiteres Mädchen mit vollen Lippen, ihre Augen wirken irgendwie stechend. Wenn sie spricht, ist sie sehr genau, kein überflüssiges Wort. Sie ist die unmögliche Blondine, das Mädchen, das weiß und immer im Klaren ist. Sie hat die Intuition einer Schweizer Uhr und trägt gern Hüte. Sie ist von hyperboreischer, nordischdämonischer Schönheit. Goldenes Haar, ein Körper, den man wohl am besten als sinnlich bezeichnen kann, lange Beine, wie die eines Tieres in Form gegossen, Knie, in die ich gern beiße, wenn ich sie vögle. Und blaue Augen, Augen wie der Ozean, das Meer, Augen zum Ertrinken. Sie lacht gern, strahlt Leichtigkeit aus, doch in ihrem Kern ist dieses Wesen ernst, stets geheimnisvoll, unsichtbar. Weiß der Teufel, was in den Abgründen dieses Engels vorgeht.