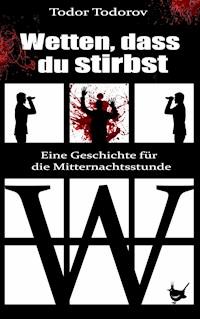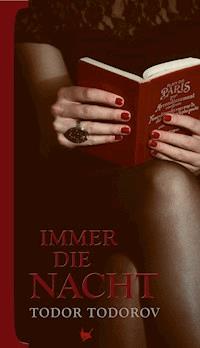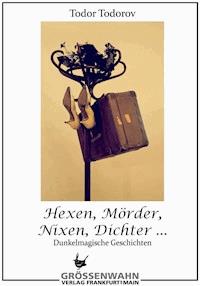
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Größenwahn Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Am Rande der Realität, wo Normalität in Wahnsinn umschlägt, wo Märchen und Mythen Wirklichkeit werden, wandeln jene 19 Erzählungen, die sich geradewegs in den Verstand des Lesers bohren. Jede Geschichte entführt den Leser an die unterschiedlichsten Schauplätze: vom Paris des 19. Jahrhunderts, über den Dondukov-Boulevard in Sofia, bis ans Ende der Welt. Hexen, Mörder, Nixen und Dichter kreuzen ihre Wege. Durch Van Goghs Liebes- und Malgeheimnisse oder Dantes Bart, von dem sich magere Vögel ernährten, wird der Alltag umgestülpt; der Blick hinter den Vorhang liefert die Erkenntnis, dass hinter der vertrauten Realität das Unfassbare lauert und nur ein geringer Anstoß nötig ist, um die Normalität zum Einsturz zu bringen. "Die Augen. Offen und zu. Im Schlaf. Im Schmerz und in Tränen. In Angst. Und weit aufgerissen. Einatmende Augen. Ausgedehnte Pupillen. Schmerzhaft und berauschend farbig. Errötet oder türkisblau, grün, sich versinkend verzehrende Augen, eines Träumers, eines Wahnsinnigen ..." Zum ersten Mal in deutscher Sprache, Todor Todorov, der neue Autorenstern aus Bulgarien. Einzigartige, verstörende Mysterie à la David Lynch. Ein poetischer Akt in Prosa, für schlaflose Nächte und helle Geister, für Leser die Sex, Schrecken und Thriller lieben und für Ritter, "die kühn herkommen, mit leichtem, aber heißem Herzen". Ganz besonders ist dieses Buch zu empfehlen für diejenigen "die nachts in den Waldestiefen umher wandern, dort, wo Menschen nichts zu suchen haben, mit allen Hexen schlafen, böse Nachtgespenster in den Augen sehen, und ..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hexen, Mörder, Nixen, Dichter … | Reihe: Via Egnatia
Die Deutsche Nationalbibliothek – CIP-Einheitsaufnahme.Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet dieses Buch in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Erste deutsche Auflage 2012© Größenwahn Verlag Frankfurt am Main Sewastos Sampsounis, Frankfurt 2012www.groessenwahn-verlag.deAlle Rechte Vorbehalten.ISBN: 978-3-942223-17-1eISBN: 978-3-942223-52-2
Todor Todorov
Hexen, Mörder, Nixen, Dichter …
Dunkelmagische Geschichten
Aus dem Bulgarischen vonSvetlana Petrova
IMPRESSUM
Hexen, Mörder, Nixen, Dichter …Reihe: Via Egnatia
AutorTodor Todorov
Erschienen 2010 beiИздателство Сиела (Verlag Ciela), Sofia, BGOriginalausgabe:›Приказки за меланхолични деца‹Der Text wurde für die deutsche Fassung mit dem Autor abgestimmt.
ÜbersetzerinSvetlana Petrova
SeitengestaltungGrößenwahn Verlag Frankfurt am Main
SchriftenConstantia und Lucida Calligraphy
CovergestaltungPeter Sarowy
CoverbildTodor Todorov: ›Es war ein Mal‹
LektoratMichael Fröhlich
Größenwahn Verlag Frankfurt am MainSeptember 2012
ISBN: 978-3-942223-17-1eISBN: 978-3-942223-52-2
I N H A L T
DANTES BART
VAN GOGH IN PARIS
DER MENSCH, DER DIE VÖGEL FÜTTERTE
FOOD DROP
ES
BIS ANS ENDE DER WELT
DIE KLOSTERNIXE
WANDERFLUCH
WOLFSBRAUT
SCHWEIGENDES MÄRCHEN
DER WIND
MONDSÜCHTIG
WENN DER KUCKUCK DREI MAL RUFT
GEHT NICHT, PURPURROTE!
VERGUS
IN VAKUUM
DIE AUGEN
ENTGEGENVERSCHWINDEN
DIE NACHTLESUNG
QUELLENANGABEN
BIOGRAPHISCHES
DANTES BART
«Dieser sah nicht mehr den letzten Tag,Doch war er ihm nah, so vom Wahn verblendet,Dass er ihm gewiss in kurzer Frist erlag.»
Dante, Purgatorio I, 1
Der Bart ist vor allem Geschichte, dachte Dante und holte mit dem Rasiermesser aus. Er keimt wie eine Traube, angeschwollen von der Vergangenheit, von der sich nur magere Vögel ernähren. Fest ins Gesicht gepresst, reift er langsam, wird schwer und wird geschnitten, bevor er Früchte trägt.
Dantes Geschichte begann nach seinem Treffen mit Abulafia. Dieser unruhige Jude, sachkundig im Unverständlichen, hatte ihm die Geheimnisse der Alchemie und der Kabbala enthüllt. Er hatte ihm beigebracht, wie er nach Nord und Süd träumen konnte und auch nach West und Ost und er hatte ihn ermahnt, dass in manchen Nächten, in eine bestimmte Richtung zu träumen, nicht ungefährlich war. Seine Erscheinung setzte der heimischen Gemütlichkeit ein Ende, inmitten derer Dante unzählige Nachmittage vor seinen lateinischen Bänden verbrachte, wenn draußen der Hahn auf Italienisch krähte. Sie verwandelten sich in Wanderer. Kuckucksvögel bauten Nester in ihren Bärten, solange sie die staubigen Wege kehrten.
Sie landeten in einer jener Städte, wo die Zungen hinter jeder Ecke sprachen. Sie erzählten ihnen von Blinden, die sich im Geheimen versammelt hätten, aber immer an ein und derselben Stelle und zu einer im Voraus vereinbarten Stunde, um über die Welt zu lästern und zu freveln. Wenn etwas Unheimliches oder einfach eine Unannehmlichkeit geschah, sagten die Leute: Es sind sicher die Blinden gewesen! Und wenn mit den Kindern etwas Schlimmes passierte, warnten die Mütter: Sicher sind die Blinden dort gewesen!
Diese Menschen trugen breitkrempige Hüte und verschiedene seltsame Verbände über ihren Augen, überhaupt verdeckten sie immer ihre Blindheit. Sie sagten, wenn jemand in das Weiße ihrer Augen blicke, verliere er seinen Verstand und ihm sei ein grausames Verhängnis vorbestimmt. Man nannte sie Malooculi – die bösartigen Augen. Man sagte auch, dass jeder einer von ihnen sein könne – vom Bettler auf der Straße bis zu dem alten, eines Nachts vor Entsetzen erblindeten Bischof. Aber das waren nicht einfach Blinde. Sie wollten nicht sehen. Die Welt schmerzte sie wie ein lästiges Geschwür und sie spuckten auf sie in ihren Träumen und in ihrer endlosen Blindheit. Die zwei bärtigen Männer spuckten auch und gingen ihren Weg weiter.
Dann sah Dante die Katzen. Ganze Katzenarmeen durchquerten die Städte an der Adria. Sie hatten kein Ziel. Sie waren Nomaden, Wanderer, Prügelhelden, Straßenbanditen. Sogar Mörder. Immer unterschiedlich. Dreckig, zerzaust, nass, meist mager. Und zäh. Unbekannt. Sie waren eine Bande Taugenichtse. Heruntergekommen und mit gesträubtem Fell, mit atemlosen Augen, als ob sie geradezu aus der Hölle hervorkommen waren.
Sie kamen von überall her. Es führte sie irgendein schwarzer langer Kater, der mit seinem Schwanz arabisch schreiben konnte und den die Menschen flüsternd Il Carnefice nannten – den Kopfabschneider. Er hielt nicht an. Niemals. Sie hatten genagt und alles gekaut, was man auf den schlammigen Straßen und Schluchten der Toskana kauen konnte. Ja, sie paarten sich sogar auf den Straßen … lange und laute Orgien. Alles war erlaubt. Jeder wie er es mochte. Es erregte sie der Geruch von Blut, es spannte ihren ganzen Körper an. Fleisch. Vielleicht bereits ein wenig faul und abstoßend … aber Fleisch. Und Hunger. Orgien aus Hunger. Ja, der Trieb stieß sie, warf sie in seltsame Genüsse, sich vergessend und betäubt vom Hunger, haben sie gefickt. Ja, gefickt. Lange und erschöpfend. Und manchmal grausam. Fleisch und Hunger.
Sie gingen ihren Weg weiter, während Abulafia erzählte, wie die Geschichten der Städte aus ihren Katzenperioden entstanden sind. So die Dynastie Ju Dsin – haarige und kugelförmige Katzen – die mehr als tausend Jahre Peking beherrscht hatte, und den Tod einiger Herrschergeschlechter gesehen hatte. »Den Katzen in Rom und Konstantinopel wachsen Bärte«, sagte Abulafia. »Und jetzt verändern wieder die Katzen die italienischen Städte«, endete er, während der Wind und die Nacht sie auf dem Weg zusammen mit dem Katzengeheul einholten.
Am nächsten Tag sah Dante Beatricia. Ihr goldenes Haar lockte den blauen Morgen wie ein Segel. Sie trug einen alten römischen Namen und mit jeder Bewegung malte sie die Welt aufs Neue. Sie war das lebendigste Etwas, das Dante je gesehen hatte.
Neben ihr sah alles alt aus, klebrig und träge.
Man hatte sie einem Herzog versprochen, der der Meinung war, dass die Welt im Allgemeinen unbeweglich sei. Totgeboren. Und er fürchtete sich vor dieser Paralyse. Er fürchtete sich sehr. Er bevorzugte die Unruhe im Traum, deshalb hatte er sein Schloss so gebaut, dass sein Schlafzimmer sich zusammen mit dem Lauf der Himmelskörper drehte, damit sein Schlaf möglichst lange anhielt. Außerdem sammelte er Dinge, die seiner Meinung nach die Blasphemie des Seins, in so einer Welt wie dieser, aufbewahrten. Man sagte, er besitze einen Vogel, Phönix, der ganz blau sei wie ein persisches Fresko, und dass in seinem Schloss eine Jungfrau aus Afrika wohne, wild wie die Nacht, die all seinen Untergebenen den Wahnsinn gebracht habe. Der Herzog schützte mit diesen Sachen sein Leben.
Beatricia war das lebendigste Etwas, das er jemals sehen würde.
Dante ging nach Hause, Abulafia in der Tiefe des Waldes verlassend, als die Nacht sie umhegte und in ihre Bärte eindrang. Ihr Weg nahm ein Ende und Dante wusste – dort aus der Nacht und aus dem Wald gab es allein nur einen Ausgang.
Er war müde. Der Speichel der alten Männer floss langsam wie ein Lokum von den Balkons herab, und die Fliegen schlummerten auf den erhitzten Dächern. Eine Eule, die ihr Nest neben seinem Fenster gebaut hatte, warnte ihn jeden Abend mit einem dumpfen Schrei.
Er wusste, dass der Geist von Abulafia ihm auflauerte, um ihn direkt durch die Tore der Unterwelt zu verschleppen. Dieser Mann hatte schon zu Lebzeiten unmenschliche Kräfte besessen.
Die Blasphemie des Seins – dachte Dante und rasierte sich. Einen Augenblick nachdem er das Messer neben das Fenster niederlegt hatte, klopfte es an der Tür. Er machte zwei Schritte und hielt inne, um noch einmal nach draußen zu schauen – dort, wo die Welt sich wie ein altes vergilbtes Papier zu krümmen begann. Er erinnerte sich an den Blinden und an die Katzen, die sich Städte erstritten. Er erinnerte sich auch an Abulafia, der sich in irgendeinem schlammigen sizilianischen Dorf zu einem Heiligen erklärt hatte. Und machte auf.
Ich war es.
Vergilius.
VAN GOGH IN PARIS
«La tristesse durera toujours.»
Die letzten Worte Van Goghs
Purpurrote Nächte. Und entzündete Augen. Saure Frauen, saurer Wein. Van Gogh erbrach. Aufs Neue. Schon den sechsten Tag schlief er unter der Brücke Saint Michelle und jeden Morgen sah er sein Spiegelbild in den Gewässern der Seine, wo die Stadt bleich auftauchte, schwarzweiß und gereinigt. Manchmal ernährte er sich von Ratten.
So ist es. Paris ist Epidemie, Ansteckung, ein Ort, wo der Körper gezwungen ist, zu träumen, zu zittern … zu schwitzen. Ein besonderes Delirium, erinnerungslos, und Fieber beherrschten den Holländer, seitdem er hier hergekommen war. Er fickte eine Äthiopierin auf der rue D’Assain, gekauft und wieder verkauft gegen die wundertätigen Reliquien eines einheimischen Heiligen von einem Mann mit trüben Augen und einer Wunde am Kopf in einer Grotte. In den Kanälen. An solchen Orten handelte man mit den Kostbarkeiten der Stadt.
Ja, Paris ist eine Krankheit, dachte Van Gogh, während der blassblaue Morgen seine Vergangenheit verwischte, ähnlich wie Tinte auf einem alten Blatt Papier. Dann war er wieder auf der rue D’Assain. Die Brust der Äthiopierin brachte ihn dazu, an Feigenöl zu denken, sie war feucht und fleischig, so wie er es manchmal auf dem Markt in den Hallen sah. Er ließ sich ausgehend von dem Öl langsam zwischen ihre Beine gleiten, dort, wo er mitten in weichen Kastanien und Olivenöl versank.
Als er in Paris ankam, fickte er alle Prostituierten in der Stadt. Ohne Ausnahme. Mehrere Male. Er spritzte Samen wie ein Teufel. Ja, Vincent kannte die Krankheiten. Und den Wahnsinn. Und jenseits des Wahnsinns schwebte ihm irgendein neuer Anfang vor, der dort stand und auf ihn wartete. Wie ein unsichtbarer Punkt, von dem aus gesehen, die Welt in eine Handfläche hineinpasste. Aber diese Stelle war nicht hier. Sie war nicht in Paris. Er würde sie Jahre später auf einem Feld bei Auvers-sur-Oise entdecken. Mit einem Revolver.
Er malte nicht. Er kannte alle Orte, an denen man Seelen kaufte. Für einen guten Preis. Und er verkaufte. Dann traf er diese schwarze Frau. Sie war wie eine reife Olive, wiederverkauft in den Kerkern von Paris, mit einer dunklen körnigen Negerhaut. Sie trank einen dicken Kaffee, türkisch, und erzählte ihm, wie alle Kater in dem lateinischen Viertel ihre Schnurrbärte an dem Tag rasiert hätten, an dem sie zum ersten Mal die Stadt betrat. Sie erzählte ihm auch, wie die Menschen in ihrer Heimat einmal im Jahr in einem Regen von Schmetterlingstränen badeten. Vincent hörte zu, wusste aber, dass diese Frau mit ihrer Vagina zaubern konnte, er wusste auch, dass auf ihren Oberschenkeln einige Symbolistenkreise Haschisch zusammengerollt hatten, und den Katern im lateinischen Viertel hatte er persönlich die Haare vom Schnurrbart aufgekauft. Wie malt man sonst eine Sternennacht?
Manchmal ließ sie ihn halbfaule Äpfel sammeln und bringen, Stücke vom Kürbis oder was man ohne Geld auf den Pariser Märkten finden konnte. Dann legte sie die Früchte in eine Schüssel vor dem Fenster und ließ sie so liegen. Oft blieben sie dort unberührt Tage lang, bis sie ganz verfaulten und ihr Geruch schmerzhaft wurde.
Diese Frau ist eine Hexe, dachte Van Gogh, und weil sie seine Anwesenheit nachts nicht wollte, stellte er sich ihre nackten Füße auf den Spitzen der Dächer von Paris vor, ihre leisen Schritte nach Mitternacht von Haus zu Haus, er stellte sie sich finster und tödlich vor wie die Gorgone. Paris ist eine Stadt von Monstern, dachte er. Aber der Gestank der überreifen Früchte und ihr tierischer, schwarzer Körper erregten ihn noch mehr und strengten seine Empfindungen an wie eine Flamme auf der Oberfläche von Absinth. Es gab etwas heidnisch Erstarrendes in diesem Wunsch, er spürte es in seinem Magen altertümlich und unklar wie die Zeit, die seine Liebe in eine gotteslästerliche Pilgerschaft verwandelte. Und das gefiel ihm.
Sie besaß aber etwas, was er nicht ahnte. Und nicht verstand. Diese Frau mit langen dunklen Fingern und weißen Fingernägeln, die wie Milch waren, hatte die Gabe. Sie konnte malen. Und sie konnte es gut. Manchmal malte sie ganze Nächte lang, malte Monde, blasse Gesichter, die sie auf der Straße bemerkte, malte die Mondsüchtigen aus dem Asyl und natürlich die vom Tod halbgegessenen Stillleben, die ihr der Holländer lieferte. Sie hatte eigenartige Augen. Solche, mit denen man die Sachen so sieht, als ob sie einer anderen Welt angehörten. Einmal hatte sie sogar die Nacht selbst gemalt. Mit Kreisbewegungen. Und in blau. Wenn ihr Pinsel das Leinen des Bildes berührte, tanzte sie. Sie tanzte gottlos und furchtbar wie eine afrikanische Nacht. Ja, sie hatte Talent. Sie hatte etwas von dem, was die Menschen Offenbarung nannten und was eine besondere Art von Wahnsinn war. Deshalb hatte man sie gegen die Reliquien eines Heiligen eingetauscht, deshalb wetteiferten die Symbolisten darum auf ihren Oberschenkeln Haschisch zusammenzurollen, deshalb erwachten sogar die Kater im lateinischen Viertel ohne Schnurrbärte. Die Schwestern in ›Sa. Augusta‹ erzählten von einer im Dunkeln unsichtbaren Frau, deren Silhouette manchmal unheimlich im Mondlicht strahle und die unbemerkt und auf Zehen gehend die Dächer der Häuser durchwandere und Katerschnurrbärte stähle, sie stähle auch die Träume und die Ruhe der Nichtschlafenden und den Samen der kleinen Jungen. Wenigstens ängstigte man so die Kinder im Asyl.
Aber mit diesem Körper und ihrem Namen, der wie ein Brandmal war, konnte sie nicht einmal ein Bild verkaufen. Ihr Name roch nach Afrika, die Buchstaben in ihm wirkten wie verhexte, verstummte Totems, die Konsonanten waren ausgedehnt und lang wie Savannen, durch die Löwen brüllten, und hier und da wechselten sie sich mit Vokalen ab, ähnlich der Wüsten und dem Kreischen von wilden Enten. Es war ein Name, der nach scharfen Gewürzen duftete. Ein Name, der nur auf der verfeinerten französischen Sprache brannte. Mit ihm war sie verdammt. Ihre Oberschenkel würden immer den Geschmack von Haschisch und französischen Gedichten haben und sie würde Stillleben in einem stickigen Zimmer auf der rue D’Assain bis an ihre letzten Tage malen.
Deshalb wollte sie seinen Namen. Sogar mehr – sie wollte er sein. Sie wollte Vincent van Gogh sein. Das war der Name eines Genies, den dieser Unglücksrabe trug ohne jegliches Verdienst. Eben deshalb würde sie ihn von ihm kaufen. Und das würde überhaupt nicht schwer sein. Sein Leben außerhalb ihrer Vagina hatte keinen Sinn und sie wusste das. Gegen eine Tagesration Absinth und das Wohlwollen zwischen ihre verschwitzten Schenkel zu sinken, schwarz und gesund, mit dem Duft eines wilden Tieres, nur dafür würde sie alles bekommen. Sie wollte seinen Namen, weil dieser mathematisch einfach und vollkommen war. In ihm gab es jenes, was die Italiener und Musikanten scherzo nennen – eine leichte, spielerische Bewegung, ein kleiner Scherz, flüchtig verschleierte Ironie – ein Sprung der Zunge von dem kehligen G durch das plötzlich hohe O