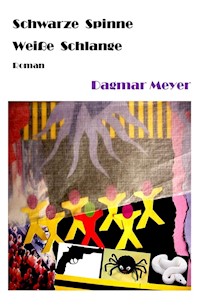2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Immer kommt dieser Tag ganz plötzlich. Der Mann an deiner Seite ist tot. Du aber lebst und fragst dich, wie das gehen kann, allein weiterzuleben. Doch der Rhythmus von Tag und Nacht hört nicht deinetwegen plötzlich auf, die Uhren bleiben nicht deinetwegen stehen. Der Puls des Lebens zwingt dich in sein Schema. Du lernst weiterzuleben, tust deine ersten Schritte in die unbekannte Zukunft, wie ein kleines Kind, das laufen lernt; unsicher und stolpernd zu Beginn, dann immer sicherer hinein in ein neues Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dagmar Meyer
Immer kommt der Tagganz plötzlich
oder
der blaue Elefant
Roman
Impressum
Text:
Dagmar Meyer
Gestaltung:
Martin Meyer
Copyright:
Dagmar Meyer 2021
ISBN 978-3-347-23425-3 (Paperback)
ISBN 978-3-347-23426-0 (Hardcover)
ISBN 978-3-347-23427-7 (e-Book)
Verlag: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Im Tal der Tränen. Der Tod ist unausweichlich. Ich weiß – und leide.
1 Januar
Das kannst du mir glauben. Es war das bitterste Jahr meines Lebens.
Es fing damit an, dass ich am letzten Tag des abgelaufenen Jahres allein an meinem Fenster stand und das Feuerwerk über der Stadt beobachtete.
Silvester allein, das gab es noch nie.
Silvester hieß Smoking und Ballkleid, ein festlich glänzender Saal, hieß heiße Musik und Tanz – Tanz, bis die Füße brannten und die Musiker irgendwann ihre Instrumente einpackten, bis der Tanzboden vor lauter Konfetti und Papierschlangen nicht mehr zu sehen war und die ersten Putzgeschwader anrückten. Erinnerst Du Dich an den verloren gegangenen, sehr wertvollen Manschettenknopf, der auf dem überfüllten Tanzparkett verloren gegangen war?
Am ersten Tag des neuen Jahres fanden wir das kostbare Schmuckstück in einem Staubsaugerbeutel wieder. Wir hatten uns die Beutel vom überraschten Hotelpersonal mit nach Hause geben lassen, wo ich sie akribisch mit zwei Gabeln durchsucht – und den verlorenen Schatz tatsächlich gefunden habe.
Damals fing das neue Jahr so gut an.
Nein, Silvester allein war ich nie. Doch jetzt schaute ich einsam und traurig in das neue Jahr, fühlte mich wie ein leckgeschlagenes Schiff mit gebrochenem Ruder.
Knallbunte Sterne explodierten am Himmel, Sirenengeheul, Pfeifen und Knallen, glückliche Menschen, die in den Himmel starrten, als würde es Goldtaler regnen. Raketen in allen Farben schossen in den Himmel und setzten Sterne frei, die sich bald in der qualmgeschwängerten Luft auflösten.
Ich stand ganz still und schaute von meinem Logenplatz mit tränennassen Augen auf die erleuchtete Stadt, nicht ahnend, was dieses Jahr von mir fordern würde, nicht wissend, wie ich den kommenden Tagen und Wochen entgegentreten sollte, allein. Leer war mein Kopf von klaren Gedanken, von chaotischen Gefühlen gehetzt das Herz. Nur Tränen gab es überreichlich. Das kannst du verstehen, oder?
Denn es war doch so: Die Veränderungen in meinem Leben würden radikal sein, nichts würde bleiben, wie es war, eine brutale, weil von außen erzwungene Rundumerneuerung meines Daseins. Und die sollte nicht in einem Beautytempel stattfinden, sondern mitten im Alltagsleben, dieser banalen Maschinerie, die in keiner Weise stehenblieb, schon gar nicht meinetwegen.
Dabei fand ich mich unversehens in einer Situation wieder, die für mich in diesem Ausmaß nie und nimmer vorhersehbar gewesen war. Nach einem halben Jahr habe ich mich gefragt, wie ich alles überhaupt bewältigt habe: Unsere gemeinsame Wohnung auflösen, die Renovierungen in der neuen in Auftrag geben, brauchbare Dinge und Kleidung verschenken, anderes entsorgen, empfindliche Gegenstände selbst vorab in den neuen Keller bringen, und und und ... Der Aufgabenkatalog wurde zunächst immer länger, erst nach Monaten fing er an zu schrumpfen.
Es war Schwerstarbeit.
Im Nachhinein denke ich, dass es gut so war. Oft fiel ich abends todmüde ins Bett, wenn der Tag geschafft war, und schlief erschöpft ein. Um irgendwann mitten in der Nacht aufzuwachen, dich zu vermissen, Probleme zu wälzen, dich zu vermissen, anstehende Arbeiten im Kopf zu sortieren, dich zu vermissen, erschöpft auf nassem Kissen in schweren Schlaf zu sinken.
Was habe ich gegessen und getrunken in den ersten Wochen, habe ich überhaupt gekocht? Ich weiß es nicht. Du warst nicht mehr da, um diskret auf deinen knurrenden Magen hinzuweisen und Wünsche nach deinen Lieblingsgerichten zu äußern, was du oft getan hast. Ich habe sie dir meistens gern erfüllt. Aber für mich allein ein Essen zubereiten? Nein, ich nehme, was im Kühlschrank ist oder in der Obstschale liegt. Essen macht keine Freude, es ist mir gleichgültig. Erst sehr viel später werde ich anfangen, gezielt und gesund einzukaufen und Gerichte zu kochen. Für mich allein.
Und dann diese Zumutungen.
„Die Küche kommt raus“, sagt der Vermieter, nachdem er meine Kündigung erhalten hat. Meine schöne Küche, blau-weiß, mit Geräten, die alle funktionieren; in der ich so gerne gekocht habe, weil alles so praktisch eingerichtet war; in der du Hilfskoch gespielt hast. Niemand konnte so akkurat Gemüse schneiden wie du, als ob du an jedes Gurkenstückchen ein Lineal angelegt hättest. So hast du immer gearbeitet: genau, sauber, übersichtlich. So sahen deine Listen mit den Karl-May-Bänden aus, so hast du deine Filme geschnitten, - und eben auch Gurken.
Und wir redeten und lachten.
Jetzt also alle Küchenmöbel und sämtliche Einbaugeräte auf den Sperrmüll, nachdem ich vergeblich mit Wohlfahrtsverbänden telefoniert habe. „Wir nehmen nur solche Möbel und Geräte, die nicht älter als fünf Jahre sind.“ So sieht es also aus. Nicht älter als fünf Jahre. Mir blutet das Herz, doch meine Kinder finden nichts dabei. In den kommenden Wochen und Monaten werden sie noch öfter sagen: „Tu das weg und kauf dir etwas Neues, heute funktionieren moderne Geräte viel besser und schneller.“ So werden in den kommenden Wochen und Monaten Laptop und Drucker, Handy, Haustelefon und GPS-Gerät ausgetauscht, obwohl alles noch funktioniert, nur eben viel langsamer und nicht so perfekt. So wie ich.
Als erstes packe ich die empfindlichen Gegenstände ein: Die zahlreichen, zierlichen Vögel und Schmetterlinge aus buntem Glas, die in deinem Fenster hängen; dazu den Uhu, das Blütenblatt, die kleinen Elefanten und Delfine, die in der Vitrine stehen.
Und den großen, blauweißen Elefanten aus schwerem Glas.
Auf ihn warst du besonders stolz. Ganz allein thronte er jahrelang auf einem Regal, glitzerte und funkelte, sobald ihn Sonnenstrahlen trafen, den Rüssel zum Trompetenstoß gen Himmel geschleudert. Er verkörpert nicht nur elegante Schönheit, sondern auch Stärke, körperliche und geistige. So haben wir ihn beide gesehen, nicht wahr? Umso mehr sollte ich mich jetzt daran erinnern und ihn mir zum Vorbild nehmen. Fühlte ich mich doch besonders in diesen ersten Wochen des neuen Jahres sowohl physisch als auch psychisch furchtbar schwach. Immer wieder stellte mir die Trauer ein Bein, und ich schlug der Länge nach hin. Folge: Ein Sturzbach von Tränen.
Der Elefant hat einen Ehrenplatz in meinem neuen Leben erhalten, dir zur Erinnerung, mir zur Mahnung.
Du weißt ja, dass ich die kleinen Kunstwerke aus Glas geliebt habe. Jedes Jahr habe ich mich tierisch gefreut, wenn du einen neuen Paradiesvogel vom Weihnachtsmarkt mitgebracht hast, die dort in großer Zahl verkauft wurden. Ich habe ihn zu den anderen ins Fenster gehängt. Wenn dann die Sonne darauf schien, war das ein einziges, buntes Glitzern.
Wie ein Kind Du hast dich daran gefreut. Deine Augen strahlten. Das lästige Abstauben hast du dagegen gerne mir überlassen, stimmt´s?
Das Schwerste war doch, deine Schränke auszuräumen. Jeden Pullover, jedes Hemd, jede Hose legte ich sorgfältig zusammen, sanft strich ich über deine Lieblingsstücke, während die Gedanken zurückkehrten zu diesem und jenem Einkaufstrip, an dem sie gekauft worden waren, zurück zu Kaffee und Kuchen im Straßencafé, zu so manchem Glas Sekt an der Bar des großen Einkauftempels, mit dem wir meistens eine Einkaufstour begonnen haben. Dann wird das Herz schwer und schwerer, die Augen laufen über. Ich lege ein Päckchen Papiertaschentücher neben mich.
Es war doch in deinem Sinne, dass ich deine Kleidung in eine soziale Einrichtung gebracht habe, nicht wahr? Die Frauen, die dort arbeiten, waren freundlich und einfühlsam. Schweigend nahmen sie mir die Kleiderkartons ab. Sie kennen viele Frauen wie mich, ältere zwischen sechzig und achtzig, die mit Männerkleidung in Koffern und Plastiktüten vor der Tür stehen, das Gesicht blass mit tiefen Falten, die sich über Nacht eingegraben haben, die Lider rot gerändert vom vielen Weinen, stumm vor Angst, dass die Tränen wieder fließen, wenn sie zu reden beginnen.
Eine Dame in schwarzer Hose und schwarzem Pullover, mit dunklen Ringen unter den Augen, erzählte mir mit leiser Stimme von ihrer eigenen Trauer; sie gab mir das Gefühl, nicht alleine mit meinem Schmerz zu sein. In ihren Augen las ich Mitgefühl und Verständnis; die Tränen stiegen mir gleich wieder in die Augen. Was immer geschah, wenn mich jemand ansprach, der dich gekannt hat und um dich trauerte. Es brauchte so wenig in jenen Tagen, und auch heute noch, um den Damm zu durchlöchern, der den Tränensee zurückhielt. Er war gefüllt bis zum Limit und bereit, jederzeit unkontrolliert über die Ufer zu treten.
Die Bücherregale mussten abgeräumt werden. Viele deiner Bücher waren groß und schwer – und nicht mehr zu verschenken, keiner wollte sie haben. Im Zeitalter des Internets gibt es kein Interesse an einem zwölfbändigen Lexikon, auch liest heute niemand über vierzig Bände Karl May.
Jahrelang war es unser gemeinsames Vergnügen, und ganz besonders meines, inmitten von Menschenmassen über Flohmärkte zu schlendern, unzählige Stände mit antiquarischen Büchern auf der Suche nach Karl May zu begutachten. Du schautest nach altem Porzellan, ich hatte mein Vergnügen darin gefunden, in großen Kartons zu wühlen und mit Händlernzu fachsimpeln. Meine Liste hatte ich immer in der Hand, auf der die Nummer des Bandes in meinem Besitz, sein Erscheinungsjahr und Erhaltungszustand genau vermerkt waren; so mancher Händler staunte nicht schlecht, und ich war glücklich über jede Neuerwerbung, die ich meiner Sammlung hinzufügen konnte.
Es sind unvergessene Stunden, in denen wir in der Stadt unterwegs waren. Wir haben sie beide sehr genossen.
Als wir dann unsere Radtour an der Elbe entlang in Dresden begannen, war es Ehrensache, dass wir das Karl-May-Museum in Radebeul besuchten.
Wohin jetzt mit den Büchern? Ich habe es ja kommen sehen. Sei froh, dass du meine Bemühungen, sie irgendwo unterzubringen, nicht miterleben musstest. Am Ende nahmen Filmfreunde von dir sie schließlich mit in der Hoffnung, sie eines Tages doch versilbern zu können. Ich habe nie wieder etwas von ihnen gehört.
Zwei oder drei Exemplare gingen allerdings, zu meiner großen Freude, in den Besitz einer Enkelin über.
Wie auch die riesige Bibel mit Goldschnitt, kunstvoll handgeschrieben und mit wunderbar verzierten Initialen, von uns oft mit Ehrfurcht betrachtet. Das hätte dich gefreut, mich hat es getröstet.
Nach deinem Tod starb mit dem Aufgeben der Wohnung ein weiterer Teil unseres gemeinsamen Lebens. In die neue Wohnung zogen die Fotos, Filme, Bilder und einzelne Erinnerungsstücke ein, von denen ich mich auf gar keinen Fall trennen wollte.
Packen, Trage, Fortbringen – alle Aktivitäten halfen, nicht nachzudenken, nicht zu sitzen und zu grübeln, nicht Tage und Stunden vergangenen Daseins wieder und wieder vor meinem inneren Auge abzuspulen. Ein Leben im Hamsterrad wollte ich nicht.
Viele Male fuhr ich zwischen den beiden Wohnungen hin und her und transportierte selber, was ich dem Umzugsunternehmen nicht anvertrauen wollte, verstaute alles im neuen Keller. Je mehr gepackte Kartons sich in den Zimmern stapelten, desto leichter konnte ich mich losreißen und gedanklich der neuen Wohnung zuwenden. Zum Sitzen und Weinen blieb zunächst wenig Zeit. `Gut so´, sagten die Söhne.
Küchenschränke und -geräte wurden hinausgetragen zu ihrer letzten Fahrt zum Schrottplatz, an ihnen haftete noch der Geruch von Bratkartoffeln, Kuchen und Kaffee aus vielen Jahren.
Dann war die Wohnung leer. Die letzten Nägel wurden aus der Wand gezogen, alle Fußböden gefegt. Unser Leben landete auf dem Müll, ich verließ es für immer, nachdem du es schon vor Wochen verlassen hattest. Zum letzten Mal fiel die Wohnungstür hinter mir zu, ich stieg ins Auto, blickte mich nicht um.
Ich fuhr in ein neues Leben.
Die alte Welt draußen machte dagegen ungerührt weiter. In den USA wurde Donald Trump nach einem mit harten Bandagen geführten Wahlkampf als Präsident eingeführt, und seine Absicht, eine Mauer zu Mexiko zu bauen und sie von den Mexikanern auch noch bezahlen zu lassen, verursachte weltweiten Aufruhr. Auch sein Einreisestopp für Menschen aus muslimischen Ländern wurde zum aufregenden Gesprächsstoff vieler Menschen. Ungläubig schauten die Europäer nach Nordamerika. Verständnislos. Mein Blick in die neue Welt war aber zunächst nur ein sehr flüchtiger; eigentlich bin ich politisch interessiert, aber die großen, aktuellen Dramen der Weltgeschichte berührten mich in diesen Wochen nur wie durch einen Schleier. Meine eigene Situation empfand ich als dramatisch genug, mehr Drama konnte ich nicht verkraften.
Auch Krimis strich ich ab sofort aus meinem persönlichen Fernsehprogramm, und alles andere Brutale, Katastrophale. Stattdessen suchte ich in den Programmen nach Natur- und Tierfilmen, die mit ihren friedlichen Bildern mein verätztes Gemüt sanft streichelten. So ist es bis heute geblieben.
Schon in den letzten Wochen des alten Jahres, als es dir zunehmend schlechter ging, nahm ich die Schlagzeilen der Welt nur noch am Rande wahr. Der zerstörerische Weg des Hurrikans „Matthew“ über die Karibik bewegte viele Menschen, die Fernsehbilder erzeugten Gänsehaut, aber unterschwellig auch eine gewisse Erleichterung, dass die Katastrophe weit weg schien, und Dankbarkeit dafür, selbst von einem Unglück dieses Ausmaßes verschont zu sein. Auch die Reaktion von Bob Dylan auf die Verleihung des Nobelpreises an ihn sorgte für erregte Debatten bei uns. Wie konnte er nur! In Großbritannien und ganz Europa wirbelte die Diskussion um den Brexit Staub auf für unabsehbare Zeit.
Doch um meine Person schlugen diese Ereignisse einen mehr oder weniger großen Bogen. Du wirst es verstehen.
Die Terroranschläge in aller Welt, Türkei, Afghanistan, Belgien, und besonders der auf den Berliner Weihnachtsmarkt machten mich allerdings sehr betroffen. So viel brutale Kälte! So viele unschuldige Tote!
Dein Tod war der ultimative Terroranschlag auf mein Leben.
Mit meinen alten Möbeln landete ich in der neu hergerichteten Wohnung, und durch die Fenster steckten Tage und Nächte ihre Köpfe und sahen mich fragend an: Was nun?
Ja, was nun? Ich saß auf meinem vertrauten Sofa und saß doch im unbekannten Nichts. Um mich herum war kein Rahmen, keine Struktur, an die ich mich halten konnte; nach der Wohnung musste ich jetzt mein Leben renovieren; nach „wir“ hieß es nun „ich“, statt „unser“ „mein; denn alles, was uns früher erfüllte, hat der Wind verweht, als du von mir gegangen bist: Tanzen und Trekking, Reisen und Radtouren, Feste und Veranstaltungen, die stillschweigend das Auftreten eines Paares voraussetzten. Doch ich war nur noch ein halbes Paar. Du verstehst.
Dein Name wird auf keiner Einladung mehr stehen. In meinen Kalender für das gerade begonnene Jahr brauche ich keinen Ball mehr einzutragen; keinen Termin für eine andere Tanzveranstaltung; keinen für eine Weihnachts- oder Osterfeier, an denen wir gemeinsam teilgenommen haben, viele Jahre lang. Ich brauchte zunächst überhaupt keinen Termin mehr einzutragen. Die leeren Kalenderseiten glotzten mich herausfordernd an. Das konnte ich nicht ertragen. Was soll ich denn machen? schrie ich sie an, wo soll ich denn hingehen! Ich schleuderte das Buch in die Schublade. Tränen der Hoffnungslosigkeit lösten Zorn und Verzweiflung ab.
Meine Blicke wandern von den Glasvögeln zu den Bildern an den Wänden, die Geschichten erzählen, unsere Geschichten, von Reisen und Menschen in aller Welt. Immer fangen sie an mit den drei Buchstaben „wir“. Doch das letzte Kapitel vom wir-Leben ist zu Ende geschrieben, das erste des ich-Buches noch nicht aufgeschlagen.
Unsichtbar schwebt dein Name meinen Augen voran vom Fensterbrett, auf dem einige Häuser deines Weihnachtsdorfes stehen, zum Regal mit deinen Glasvögeln, zur Vitrine mit Gläsern und Kerzenständern, die du angeschafft hast, zur Wand mit den Bildern, die du so gemocht hast. Und zum gläsernen Elefanten. Er wird mir Halt geben auf der Reise in ein noch unbekanntes Leben.
Ich werde mit dir reden, innerlich, das wird wie Salbe sein auf mein verwundetes Herz; immer wieder aufgetragen, hoffe ich auf Heilung, früher oder später, so dass ich eines Tages ohne Schmerzen in Erinnerungen eintauchen kann.
Wenn ich allerdings deinen Namen geschrieben lesen will, gehe ich auf den Friedhof.
Tage, Wochen, Monate später werde ich erfahren haben, wie wohltuend es ist, den vertrauten Namen des verstorbenen Partners auf einem Kreuz oder Stein geschrieben zu sehen. Anonyme Gräber? Dein Name ist doch sichtbarer Teil Deiner Identität und kommt mir vor wie ein Medium, über das ich mit Dir kommunizieren kann. Lache mich bitte nicht aus, ich werde nicht der schwarzen Magie anheimfallen.
Aber manchmal klammere ich mich an deinen Namen wie an ein rettendes Stück Holz.
Weiß sind die Felder, Träume von Freuden im Schnee. Gestern war´s – nicht heut´.
2 Februar
„Liebste, was tun wir hier? Komm, lass uns nach Hause gehen.“
Ich schrecke hoch und knipse die Lampe an. Die Nacht hält die Welt noch fest umklammert.
Ganz deutlich habe ich deine Stimme gehört, so wie ich sie im Krankenhaus gehört habe, als ich die Tür zu deinem Zimmer öffnete, du schräg auf der Bettkante saßest, schwanktest und ich zu dir stürzte, um dich vor dem Herausfallen zu bewahren. Du konntest dich aus eigener Kraft nicht mehr bequem zurücklegen. In höchster Not rief ich nach der Schwester, gemeinsam schoben wir dich zurück in die Waagerechte. Aufstehen wolltest du, das Gehen üben, mit dem Ziel, bald nach Hause zu kommen.
Liebste, lass uns nach Hause gehen.
Deine Stimme nur noch ein leises Flüstern. Mir blutete das Herz. Nein, du würdest nie mehr nach Hause gehen. Ich wusste es.
Oft höre ich dich diese Wörter sagen, wenn Alpträume mich nachts aus dem Schlaf reißen und in eine Realität zwingen, die ich nicht wahrhaben, ja, nicht haben will.
Es ist nicht wahr, dass ich nun allein bin. Es ist nicht wahr, dass ich umgezogen bin. Es ist nicht wahr, dass ich dich nie mehr umarmen kann, dass du mich nie mehr küssen wirst, dass deine Arme mich nie mehr warmhalten werden, wenn ich, wie so oft, friere. Es ist alles nicht wahr, und „nie mehr“ gibt es nicht. Gleich wirst du zur Tür hereinkommen und „halli hallo“ rufen, wie du es beim Heimkommen immer getan hast. Es kann nicht anders sein. Bis die Wirklichkeit sich durchsetzt. Dann ist der Absturz brutal, mit schmerzhaftem Druck auf der Brust und tränennassen Kissen. Immer wieder.
Nein, die Eine-Person-Welt will ich nicht.
Dabei kenne ich Ort und Umgebung meiner Wohnung aus einer Zeit, bevor unser gemeinsames Leben begann, das sich jetzt auch Vergangenheit nennen lassen muss und sich zur vergangenen Vergangenheit gesellt. Ich erinnere mich an Wälder und Wege, die ich vor vielen Jahren gegangen und gejoggt bin, an Menschen, die die gleichen Wege gegangen und gejoggt sind, am selben Tag und um die gleiche Zeit: Wir waren eine Gruppe, du und ich waren ein Teil von ihr; du gehörtest zum Trainerteam, blaugraue Augen unter buschigen Brauen, schmales, gebräuntes Gesicht, gut hast du ausgesehen.
Sooft sind wir dort gelaufen, dass ich heute meine, jeden Baum und Strauch rechts und links des Weges noch zu kennen. Von der Firma, in der du gearbeitet hast, hast du mir auf der Joggingrunde erzählt, von deiner Arbeit als Papieringenieur und von dem neuen Job als Qualitätsmanager, der in jenen Tagen gerade installiert worden war.
Stell dir das bitte einmal vor. Ich sitze vor einem leeren Schreibtisch, nur mit meinem Computer und Terminkalender darauf, und meiner Kaffeetasse natürlich, mit einer ganz neuen Aufgabe: Qualitätsmanagement. Buchstäblich bei null fing ich wieder an.
Qualitätsmanagement, was soll das denn sein? Wozu ist das gut?
Du hast es mir erklärt, ich hörte dir zu und bewunderte dich im Stillen. Im Laufe der nächsten Jahre habe ich gesehen, wie maßgeschneidert der neue Job für dich war, wie er zu deinem logischen Denkvermögen, zum dir gegebenen Perfektionismus in Organisation und Darstellung von Abläufen passte; deine Grafiken und Schriftstücke waren vollkommen in Inhalt und Ausführung, die Einladungen zu deinen Filmabenden perfekt.
Doch nicht nur solche bedeutenden, auch die kleinen Ereignisse sind mir im Gedächtnis geblieben, denn hier im Wald nahm das „Uns“ seinen Anfang.
Da war die Blindschleiche, die sich urplötzlich vor meinen Schuhen krümmte und mich vor Schreck zu einem Satz ins Gestrüpp zwang, das den schmalen Weg zu beiden Seiten säumte; da war die abschüssige Stelle auf dem Weg, an der ich aus Unachtsamkeit über eine Baumwurzel stolperte und heftig hinschlug.
Ins Krankenhaus musste ich dich fahren zum Nähen der klaffenden Wunde am Unterarm. Zwei Tage später gingen wir dann den ganzen Laufweg noch einmal ab.
Du mit einer großen, gefährlich aussehenden Axt bewaffnet, du, der friedliebendste Mensch, den ich je kannte. Und ein Sicherheitsfanatiker warst du auch. Du hast alle Wurzeln, die zu weiteren Stolperfallen für Jogger und Spaziergänger hätten werden können, kurz und klein gehauen. Wir redeten die ganze Zeit über dies und das, spürend, dass da mehr war als sportliche Verbundenheit, dass die Nähe immer näherkam, dass da zwei Pole waren, die sich anzogen. Diesen Marsch durch den gewitterschwangeren Wald habe ich nie vergessen, wenn auch das grüne Blümchenkleid, das ich damals trug, längst im Altkleidercontainer gelandet ist. Kann ich den vertrauten Weg jemals gehen, ohne dich als Axt schwingenden Rübezahl vor mir zu sehen?
Dabei warst du von deiner Figur her gewiss nicht Rübezahl, eher mittelgroß, schlank und sehr sportlich.
Wo sind sie geblieben, die Lauffreunde von damals? Die Gesichter der Läufer von heute sind mir fremd und naturgemäß viel jünger. Die Sportler von damals sind alt, sagt man mir, die ich auch alt bin, sie wollen oder können nicht mehr joggen, sind krank oder verstorben. Ich verstumme.
So gehe ich nun die alten Wege allein, bleibe an dem Gedenkstein stehen, der damals gesetzt worden war für deinen Freund, der das Leben nicht mehr ertragen und freiwillig verlassen hatte. Schuldgefühle blieben dir dein Leben lang.
Warum habe ich nicht gemerkt, dass es ihm so schlecht ging, dass er sich mit Selbstmordgedanken trug? Warum nicht? Wir waren doch sooft zusammen.
Jeder Mensch hat doch auch ein eigenes Leben und du mit deinem neuen Arbeitsfeld ...
Das war schwach. Ich fühlte mich hilflos und schwieg.
Ich habe seine Sorgen nicht ernst genug genommen, ich hätte aufmerksamer sein müssen.
Ich weiß, sein selbst gewählter Tod hat dich dein Leben lang belastet.
Und jetzt läufst du allein im Wald herum, das gefällt mir auch nicht, du als Frau ...
Und ich frage dich: Was soll ich denn machen? Sag es mir bitte! Im Moment sehe ich keine Alternative. Entweder allein oder gar nicht. Ich kann doch nicht irgendjemand bitten: Geh mal mit mir spazieren. Das siehst du doch ein? Den ganzen Tag zu Hause sitzen, das kann ich nicht. Schon Großmutter und Mutter waren ausgeprägte Naturläufer, das innere Bedürfnis nach dem Draußen sein habe ich wohl geerbt. Das bedeutet logischerweise, dass ich mich daran gewöhnen muss, Wege allein zu gehen. Basta.
So spaziere ich oft hinaus durch die Felder, die gleich am Haus beginnen, bis zum höchsten Punkt der Umgebung, von dem aus man einen herrlichen Rundblick hat über Wiesen und Hecken, Dörfer und Straßen bis dort, wo die dunkle Linie des Schwarzwaldes meine Augen ausbremst. Oben stehen Bänke und Liegen aus Holz zum Ausruhen. Am Himmel schweben vereinzelt Raubvögel und beäugen mich misstrauisch, sitzen auf extra für sie eingerammten Stangen und halten nach herumlaufendem