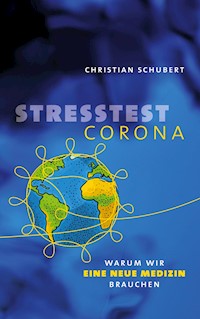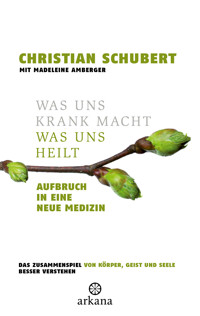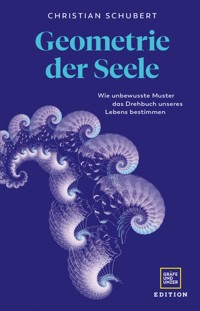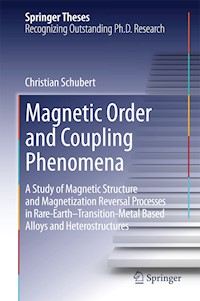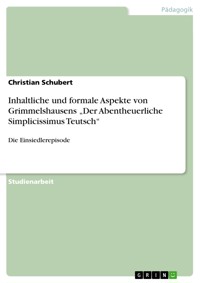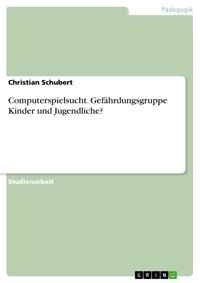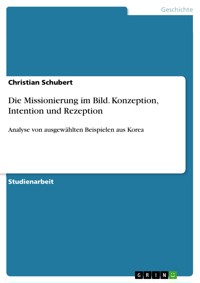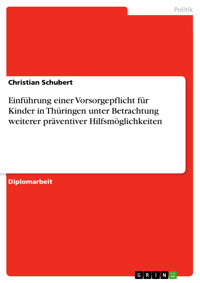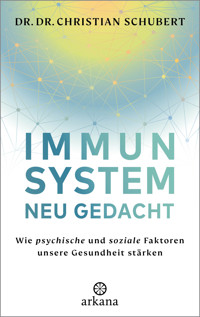
17,99 €
Mehr erfahren.
Ganzheitlich gesund durch einen bio-psycho-sozialen Blick auf das Immunsystem
Unser Immunsystem schützt uns vor Viren und Bakterien, heilt Wunden und kann uns vor Krebs und Autoimmunkrankheiten bewahren. Was meist übersehen wird: Es umfasst weit mehr als die biologische Ebene, denn auch psychische und soziale Abwehrkräfte spielen eine entscheidende Rolle.
Der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert offenbart eine ganzheitliche Sicht auf das Immunsystem, die nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für das Miteinander und die Interaktion in der Gesellschaft relevant ist. Er zeigt auf, wie wir auf unser natürliches und ganzheitliches Immunsystem vertrauen, sodass wir im Alltag umsichtiger, nachhaltiger und gesünder agieren können.
Eine revolutionäre Perspektive für ein gesünderes Leben – im Alltag der einzelnen Menschen ebenso wie in der Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Unser Immunsystem schützt uns vor Viren und Bakterien, heilt Wunden und kann uns vor Krebs und Autoimmunkrankheiten bewahren. Was meist übersehen wird: Es umfasst weit mehr als die biologische Ebene, denn auch psychische und soziale Abwehrkräfte spielen eine entscheidende Rolle. Der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert offenbart eine ganzheitliche Sicht auf das Immunsystem, die nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für das Miteinander und die Interaktion in der Gesellschaft relevant ist. Er zeigt auf, wie wir auf unser natürliches und ganzheitliches Immunsystem vertrauen, sodass wir im Alltag umsichtiger, nachhaltiger und gesünder agieren können.
Autor
Dr. Dr. Christian Schubert ist Psychoneuroimmunologe und Universitätsprofessor am Department für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Zwischen 2005 und 2021 leitete er die Arbeitsgruppe für Psychoneuroimmunologie des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin (DKPM). Von 2013 bis 2020 war er Vorstandsmitglied der Thure von Uexküll-Akademie für Integrierte Medizin (AIM). Sein wissenschaftlicher Schwerpunkt in der Psychosomatik liegt auf der Entwicklung eines Untersuchungsansatzes zur Analyse biopsychosozialer Komplexität. Die von ihm designten und erprobten »integrativen Einzelfallstudien« bieten eine völlig neue Herangehensweise an den Menschen in seiner Lebenswirklichkeit und erschließen ganz neue Wege zum Verständnis von Krankheit und zur Heilung.
Außerdem von Dr. Dr. Christian Schubert im Programm
Was uns krank macht – Was uns heilt (134/34569)
DR. DR. CHRISTIANSCHUBERT
mit Diane Zilliges
Immunsystem
neu gedacht
Wie psychische und soziale Faktoren unsere Gesundheit stärken
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2025: Arkana Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Redaktionelle Mitarbeit: Diane Zilliges
Lektorat: Ralf Lay
Abbildungen: S. 195 © AdobeStock / Michael
Umschlag: ki 36 Editorial Design, München, Stephanie Reindl
Umschlagmotiv: Covermotiv: Illustration/Verlauf © Anika Neudert / ki36
Autorenporträt: © Siri Schrott-Schubert
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-32963-1V001
www.arkana-verlag.de
Inhalt
Vorwort
Das biologische Immunsystem
Wenn uns der typisch medizinische Blick tief in den Körper und am Ende doch in eine Scheinrealität führt
Von Makrophagen, Lymphozyten und anderen tapferen Kämpfern für Ihr Wohl
Ist damit alles erklärt und geklärt? Erkenntnistheoretische Fallstricke
Was Sie für Ihr (biologisches) Immunsystem tun können
Sickness Behavior
Wenn das Immunsystem unser Erleben und Verhalten steuert
Ein hilfreicher Trick vom Immunsystem
Stichwort »Behavioral«
Das Go nach der Genesung: Health Behavior
Was Sie (im Sinne des Sickness Behavior) für Ihr Immunsystem tun können
Das behaviorale Immunsystem
Wenn wir lieber die Straßenseite wechseln
Bewusste und unbewusste Verhaltensweisen als Immunschutz
Biologie über allem?
Was Sie für Ihr (biobehaviorales) Immunsystem tun können
Weltbilder mit Folgen
Wenn Medizin neu gedacht wird
Biomedizinisches Paradigma – Stein der Weisen oder gefährliche Scheinrealität?
Das Fachgebiet der Psychoneuroimmunologie (PNI)
Das biopsychosoziale Modell
Was bedeutet das alles für Ihr Immunsystem?
Das psychische Immunsystem
Wenn es bedeutsam wird
Psychische Infektionsherde
Berührung und Bedeutung als Medizin
Positive Psychologie: Resilienz und Selbstwirksamkeit
Ein Ausflug zur »Geometrie der Seele«
Was Sie für Ihr (biopsychologisches) Immunsystem tun können
Das soziale Immunsystem
Wenn Beziehung zur Basis der medizinischen Betrachtung wird
Psychosoziale Abwehrmechanismen
Autoimmunerkrankungen neu verstehen
Als Mensch in der Maschinenmedizin: ein Fallbeispiel
Psychosoziale Infektionsherde
Wie Politik und Medizin in der Coronazeit so desaströs versagten
»Die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles« – auch auf Hawaii
Was Sie für Ihr (biopsychosoziales) Immunsystem tun können
Neues Menschenbild, neue Medizin, neue Welt
Register
Anmerkungen
Vorwort
Dieses Buch wirft einen völlig neuen Blick auf die Medizin. Es hat das Potenzial, Verkrustungen in unserem Denken und Handeln aufzubrechen und unser Verständnis von Medizin im wirklichen, eigentlichen Sinne nicht nur enorm auszuweiten, sondern so zu inspirieren und zu wandeln, dass es wieder zu unserer komplexen Lebenswirklichkeit passt. Zu Ihrer Lebenswirklichkeit. Denn vielleicht geht es Ihnen so wie unzähligen anderen Menschen, ob es nun medizinische Laien oder Fachleute sind: Was da geforscht und wie da diagnostiziert und behandelt wird, erscheint Ihnen weitab von Ihrer persönlichen Realität und dem, wie Sie das Leben wahrnehmen. Und oftmals leider auch weitab von dem, was tatsächlich hilfreich sein könnte und nicht nur vorübergehend symptomlos, sondern wirklich gesund macht.
Dass sich die Medizin in vielen Bereichen richtiggehend verrannt zu haben scheint, ist kein Wunder, denn zunehmend herrschte in den letzten Jahrzehnten in unserer Kultur ein Menschenbild vor, das Gesundheit und Krankheit und letztlich Leben auf simple Materie reduziert. Ausgehend vom Immunsystem, möchte ich Sie aber zu einem Denken auf mehreren miteinander verflochtenen Ebenen anregen – denn unsere Welt und darin eingebettet auch unser Menschsein und das, was wir »Immunsystem« nennen, ist weit mehr als bloße Materie. Es ist viel komplexer, als wir es meist dargestellt finden. So hat unser Immunsystem nicht nur mit spezialisierten Körperzellen zu tun, die fein orchestriert gegen Mikroben unterschiedlichster Art ankämpfen, sobald diese den Organismus bedrohen. Es wird unweigerlich immer auch von psychischen Faktoren und sozialen, ja gesamtgesellschaftlichen und kulturellen Dynamiken mitbestimmt, die vom gegenwärtigen Medizinsystem aber weitestgehend ausgeklammert werden. Und damit nicht genug: Wenn wir genauer hinsehen, erkennen wir sogar ein eigenes psychologisches und ein soziales Immunsystem, die Beachtung finden müssen, wenn wir dem Phänomen gerecht werden wollen.
Die Kapitel in diesem Buch können nicht nur Ihren Blick auf das Immunsystem erweitern. Sie können und wollen Sie zu einer neuartigen Haltung dem Sein, dem Lebendigen, der Existenz gegenüber führen, wie ich sie mir für immer mehr Menschen wünsche. Das schließt auch den längst überfälligen Abschied von der lange vorherrschenden Reduktion des Lebendigen auf Materielles, auf Zellen und Moleküle, Neuronen und Genabschnitte mit ein. Dieser Reduktionismus ist so offensichtlich an seine Grenzen gekommen, dass es Zeit wird, sich neue Felder des Denkens, Forschens und auch Heilens zu erschließen. Felder, die von Ganzheitlichkeit, Tiefenverständnis und einer geradezu demütigen Akzeptanz der Komplexität des Lebens geprägt sind und uns nicht nur gesünder werden lassen dürften, sondern auch im besten Sinne kommunikativer, ehrlicher, »echter«, verbundener mit anderen Menschen und der Natur.
In diesem Buch möchte ich Ihnen das Immunsystem – Ihr Immunsystem – auf eine sicherlich ungewohnte und deutlich erweiterte Weise nahebringen. Eine Weise, die Ihnen in Ihrer Lebenswirklichkeit begegnet und diese nicht zuletzt um eine gute Menge Bewusstheit in Sachen Gesundheitspflege und gelingender Lebensführung bereichert.
Das Immunsystem bio-psycho-sozial gedacht
Unser biologisches Immunsystem ist eine wahre »Wunderwaffe« gegen nahezu alles, was den Menschen gesundheitlich schädigen kann. Über Jahrmillionen gereift, kann es spielend leicht Viren, Bakterien, Parasiten, Pilzen & Co. den Garaus machen. Aber nicht nur das. Es hilft uns auch, Wunden zu heilen und den Körper vor schädlichen Entwicklungen zu schützen, die uns langfristig krank machen, die zu Krebs, Autoimmunkrankheiten und Ähnlichem führen können.
Aber ist das schon alles, wenn wir von unserem Immunsystem sprechen? Ist es wirklich nur biologisch, stofflich, materiell? Oder haben wir nicht auch Abwehrkräfte, die uns bereits schützen, bevor das stoffliche Immunsystem eingreifen muss? Und werden wir nicht auch von Gegnern attackiert, die aus weit mehr bestehen als die genannten Mikroorganismen? Die Psychoneuroimmunologie (PNI), ein hochmoderner Wissenschaftszweig der Medizin, sagt hier ganz klar: Natürlich! Diese relativ junge Disziplin, die sich mit den komplexen Wechselwirkungen zwischen Psyche, Nerven- und Immunsystem auseinandersetzt, zeigt, dass auch unsere Psyche, ja selbst das soziale Miteinander Abwehrkräfte aufweist, die man unbedingt zum Immunsystem zählen muss, will man den Menschen in seiner Ganzheit erfassen. Biologisches, Psychisches und Soziales interagieren in einer komplexen Einheit, die zu durchdringen äußerst hilfreich für unsere eigene Gesundheit und auch für den gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Gesundheit ist.
Immunsystem ist so viel mehr, als wir gemeinhin glauben. Denken Sie daran, wenn Sie von Weitem bereits sehen, dass jemand nichts Gutes im Schilde führt. Oder Sie hören verdächtige Geräusche, die Gefahr verheißen. Oder Sie grausen sich vor einem bestimmten Essen, das wohl verdorben ist. Was machen Sie? Sie rennen entweder weg und bringen sich in Sicherheit. Oder Sie ekeln sich und spucken das Verdorbene aus oder lassen es gleich stehen. Mit diesen Erlebens- und Verhaltensweisen machen Sie eines: Sie schützen sich psychologisch und sozial vor schädlichen Angreifern und Substanzen, Sie wehren sie ab, noch bevor das stofflich-biologische Immunsystem eingreifen muss.
Und wie ist es mit unserer Umwelt, mit dem, was wir mit unserer Wunderwaffe Immunsystem abwehren? Können wir nicht auch dort zwischen biologisch-stofflichen, psychologischen und sozialen Bedrohungen unterscheiden? Denken Sie an einen Fremden, der Sie mit einem Messer (stofflich) bedroht, der Sie aber auch mit Worten (psychologisch) verletzen kann. Und wie oft müssen wir als Patient erleben, dass uns Ärzte durch unbedachte Äußerungen Angst machen? Und wie reagieren wir darauf? Mit allen unseren Abwehrkräften, also mit einer biopsychosozialen Stressreaktion, indem wir (biologisch) Immunstoffe freisetzen, (psychologisch) Angst oder Wut spüren und von nun an (sozial) diese unangenehmen Einflüsse zu meiden versuchen oder sie bekämpfen.
Unzählige weitere Beispiele ließen sich anführen, um zu verdeutlichen, dass unser Immunsystem (wie wir selbst) weit mehr ist als das, was uns die allzu einseitig agierende schulmedizinische Wissenschaft weiszumachen versucht. Würden wir mehr auf unser natürliches ganzheitliches Immunsystem vertrauen, würden wir sicher einiges im Alltag und ganz sicher vieles in Epidemiephasen anders machen – umsichtiger, nachhaltiger, gesünder. Wir wüssten beispielsweise, wie wichtig das soziale Miteinander für ein starkes Immunsystem ist. Und dass ein Krankheitsgefühl im Zusammenhang mit einer Infektion und der damit verbundene Drang, sich zu schonen, überlebensnotwendige immunologische Aktivitäten sind, um uns und andere auf natürliche Weise zu schützen, uns wieder gesunden zu lassen und die Ansteckungsrate in unserem Umfeld zu verringern. Auch hier hilft es uns, das Immunsystem erweitert zu sehen – im Sinne des gut erforschten Sickness Behavior.
Zum Gesundbleiben gehört aber auch, dass wir mögliche psychosoziale Infektionsherde kennen. Denn auch der Begriff »Infektion« muss erweiterten Überlegungen zufolge ganzheitlich gesehen werden. Wir infizieren uns nicht nur, wenn ein Virus in uns eindringt, sondern auch, wenn wir eine krank machende Information unbedacht aufnehmen. Denken Sie an den unreflektierten Umgang mit den Medien. Infizieren wir uns da nicht auch tagtäglich und reagieren mit einem oft ungünstig veränderten Erleben und Verhalten, ja (un)sozialen Miteinander? Und werden sogar mitunter krank, wenn wir zu viele beunruhigende Nachrichten konsumieren?
Alle diese biopsychosozialen Wechselwirkungen sind bereits gut untersucht, wie die von meiner Forschungsgruppe in Innsbruck entwickelten »Integrativen Einzelfallstudien« zeigen. Diese Studien machten in den letzten Jahrzehnten deutlich, dass es in der medizinischen Wissenschaft eine Alternative zu den Forschungsdesigns der Schulmedizin gibt. Diese nämlich stammen zumeist aus alltagsbefreiten Laboren, lebensfernen Experimenten und entfremdeten Gruppenuntersuchungen, die eines nicht können: verlässliches Wissen und belastbare Erkenntnisse zur natürlichen Lebenswelt des Menschen liefern, wie wir alle sie für unsere Gesundheit brauchen. Das Wissenschaftsdesaster während der Coronazeit beruhte nicht zuletzt auf diesem fragwürdigen Medizin- und Menschenbild und einem viel zu engen Blick auf das Immunsystem.
Zu diesem Buch
Für eine Revolutionierung der Medizin, wie ich sie eingangs angesprochen habe, braucht es zunächst Bewusstheit. Ihre Bewusstheit. Unser aller Bewusstheit. Es braucht eine tiefgreifende Verwandlung der Art, wie wir den Menschen und das Leben sehen. Genau dafür kann dieses Buch eine tragfähige Basis liefern und gezielt zum weiteren Nachdenken, Diskutieren und Umsetzen, wo immer es möglich ist, anregen.
Dieses Buch will Sie in die faszinierende Welt des Immunsystems aus meiner psychoneuroimmunologischen Sicht entführen und dabei auch als Ratgeber für eine neue natürliche Gesundheit dienen – weg von den schalen technischen Tipps der Medizinindustrie, hin zu einer ganzheitlichen menschlicheren Medizin und Alltagspraxis. Wir werden uns ansehen, warum wir Infektion und Abwehr, warum wir Gesundheit auch psychisch und sozial denken müssen – und was das für Ihr Leben bedeuten könnte. Es ist mein Anliegen, dass Sie das Immunsystem in Ihrem eigenen Leben erfahren können, statt abstrakte und mechanistische Details zu lesen, die Sie letztlich nur zur Kenntnis nehmen können. Ich möchte Ihnen das Grundgefühl vermitteln, dass Sie Ihrem Immunsystem vertrauen können, dem biologischen und dem erweiterten. Es hat sich über Jahrmillionen anhand von biologischen, genauso aber auch psychosozialen Herausforderungen des Lebens entwickelt und weiß, was es tut – wenn wir es lassen und es in unserer heutigen, nicht mehr sehr natürlichen Welt sinnvoll unterstützen.
In diesem Sinne werde ich Ihnen auch sagen, was meiner Kenntnis nach die höchste Form der selbstfürsorglichen Unterstützung des Immunsystems darstellt. Sie liegt – so viel kann ich bereits verraten – nicht da, wo die meisten sie vermuten werden. Und genau das scheint mir ein Kernthema unserer Zeit zu sein: Sehr vieles ist nicht so, wie die meisten es vermuten oder es zu wissen meinen. Sehr vieles ist nicht so, wie die Zeitungen es schreiben und wie der Fernseher es verkündet. Die Dinge sind vielschichtiger, sie müssen tiefer durchleuchtet und mehrdimensional betrachtet werden. Anderenfalls landen wir in Scheinrealitäten – einem zuweilen sogar brandgefährlichen Phänomen, um das es in den folgenden Kapiteln ebenfalls gehen wird.
Es ist, als würde ich in diesem Buch versuchen, das Netz des Lebens über das Mittel der Sprache so nachzuzeichnen, wie es sich mir nach meiner Kenntnis und meinem Empfinden nach Jahrzehnten des Forschens und Nachdenkens darstellt. Wir beginnen auf der materiellen und wahrscheinlich am einfachsten zu verstehenden Ebene, im biologisch-physiologischen Immunsystem, und verfolgen dieses Netz von dort aus in immer höhere Ebenen des Seins und in eine zunehmende Komplexität hinein. Nur so können wir der Realität näher kommen, die eben nicht eindimensional ist.
Eben weil die Dinge so komplex, vielschichtig und in weiten Teilen doch anders sind, als wir es gelernt und verinnerlicht haben, ist es uns kaum vorstellbar, wie eine Welt aussehen würde, in der wir das neueste und ganzheitlich fortschrittliche Wissen auch tatsächlich kollektiv nutzen. Dieses Buch will daher auch einen Ausblick auf eine Gesellschaft wagen, die das Immunsystem biopsychosozial versteht und sich danach ausrichtet – es wäre eine komplett andere Welt für uns alle, in der Lebenserwartung und Lebensfreude deutlich ansteigen dürften. Um einen Beitrag zu genau dieser Welt zu leisten, habe ich dieses Buch geschrieben.
Das biologische Immunsystem
Wenn uns der typisch medizinische Blick tief in den Körper und am Ende doch in eine Scheinrealität führt
Als Sie zu diesem Buch gegriffen haben, hatten Sie bewusst oder unbewusst eine Erwartung der Welt, in die es Sie führen dürfte. Da der Titel zentral das Wort »Immunsystem« enthält, ist es sehr wahrscheinlich, dass in Ihnen ein irgendwie geartetes Bild dessen aufkam, was Sie bislang dazu gehört, gelesen, erklärt bekommen (oder sogar studiert) und sich selbst dazu überlegt haben. Es ist anzunehmen, dass dies ein biologisches Bild war, das auf Immunabwehr spezialisierte Zellen des Körpers und ihre täglichen Kämpfe gegen Viren, Bakterien und andere winzige, aber potenziell gefährliche Feinde zeigt. Vielleicht dachten Sie, hier zu erfahren, wie Ihr Körper mit respiratorischen Erkrankungen wie Grippe und SARS-CoV-2 oder mit lästigen Magen-Darm-Infekten umgeht und wie Sie ihn dabei bestmöglich unterstützen können. Möglicherweise kamen Ihnen auch die Abwehr von entarteten Krebszellen oder lästige Allergien in den Sinn, die Sie gern loswürden.
Das Buch wird diese Art von Erwartung nicht enttäuschen. Es wird sie weit übertreffen, wenn auch ziemlich sicher in einer ganz anderen Weise, als Sie es sich momentan vorstellen. Es wird das Bild dessen, was wir »Immunsystem« nennen, deutlich größer zeichnen. Das typische und gängige Bild eines rein biologisch-physiologischen Immunsystems ist in diesem Buch und in meiner Forschung (und ich würde sagen: in der Realität) wie ein kleiner, wenn auch wichtiger, faszinierender und in sich bereits komplexer Fleck, von dem ausgehend wir aber eine ungleich größere Welt von faszinierenden Zusammenhängen entdecken können, die alle mit zum Immunsystem gehören. Es ist eine Welt, die immer vielschichtiger wird, je genauer wir hinschauen. Von dem kleinen Fleck aus entspinnt sich dieses gesamte Netz des Lebens, von dem ich im Vorwort gesprochen hatte. Fassen wir das Immunsystem in dieser weiteren, ganzheitlichen Weise, dann reicht es plötzlich weit über Makrophagen und dendritische Zellen, T- und B-Lymphozyten und ihre Botenmoleküle hinaus. Es reicht damit auch wieder an Ihre alltägliche Lebenswirklichkeit heran – viel mehr, als es kampfbereite Abwehrzellen mit unterschiedlichen lateinischen Namen je könnten.
Dieser Fleck, um im Bild zu bleiben, ist ohne Zweifel sehr bedeutsam und lebensnotwendig für uns. Er allein ist bereits fantastisch, ein Wunderwerk der Natur (wenngleich wir bei seiner Betrachtung Zweifel daran bekommen können, ob er wirklich real beschrieben wurde und jemals real beschrieben werden kann). Alles ist er ganz sicher nicht, auch wenn viele, die wissenschaftlich zum Immunsystem arbeiten, niemals über diesen Fleck hinausblicken.
Zahllose Forscher sind diesem kleinen Bereich des biologischen Immunsystems über Jahrzehnte sehr genau nachgegangen, haben ihn bis in winzigste Details erforscht und allem, was sie dabei entdeckt haben, bestimmte Begriffe zugeordnet. Aus dieser Begriffswelt dürfte Ihnen einiges bekannt sein und ich möchte mit Ihnen dort zunächst einmal kurz eintauchen, bevor wir dann weit darüber hinausgehen werden. Das, was wir üblicherweise unter »Immunsystem« verstehen, macht in diesem Buch zwar nur ein paar Seiten aus, wird aber in allem mitschwingen, was ich dann weiter beschreibe. Wir werden bereits hier im ersten Kapitel, in dem es »nur« um das biologische Immunsystem geht, schnell merken, dass die Dinge deutlich vielschichtiger sind und immer das Leben in seiner Gesamtheit umfassen. So wie es auch die Wissenschaft tun sollte.
Von Makrophagen, Lymphozyten und anderen tapferen Kämpfern für Ihr Wohl
»Jeder Organismus, also auch der menschliche, ist eine an sich unwahrscheinliche Ansammlung energiereicher organischer Verbindungen und muss sich daher ständig gegen Versuche der Umwelt, ihn als ›Futter‹ zu verwenden, zur Wehr setzen«, meint mein geschätzter Kollege Arno Helmberg von der Medizinischen Universität Innsbruck. »Die Fähigkeit, solchen Versuchen etwas entgegenzusetzen, ergibt automatisch einen Selektionsvorteil. In der Evolution hat diese Auseinandersetzung seit der Entwicklung vielzelliger Organismen zu hochkomplexen Abwehrsystemen geführt«1 – zu Immunsystemen der unterschiedlichen Ausprägung.
Das Immunsystem wird stets an der Grenze von Selbst und Nicht-Selbst benötigt, wo es entscheiden muss: Was ist Nicht-Selbst und könnte dem Selbst gefährlich werden? Genau dieser Aufgabe geht auf der körperlichen Ebene das physiologische Immunsystem nach. Es dient der Abwehr pathogener Faktoren in stofflicher Form, die uns krank machen könnten. Sie kommen entweder von außen, beispielsweise Viren, Bakterien oder Pilze, oder entstehen im Körper selbst, insbesondere entartete Zellen, die zu Krebserkrankungen führen könnten. Auch an der Heilung von Wunden ist das Immunsystem zentral beteiligt, nicht zuletzt, weil Verletzungen meist Schmutz und Bakterien, also Pathogene, in den Körper bringen. Wie aber unterscheidet das Immunsystem zwischen Selbst und Nicht-Selbst?
Der Feind muss zunächst »sichtbar« sein
Das Nicht-Selbst auf biologischer Ebene ist das Antigen. Unter diesen Begriff fällt jeder Fremdstoff, der eine adaptive Immunreaktion beziehungsweise Entzündung auslösen kann. Die Entzündung ist die Antwort des Körpers auf das Antigen, auf das biologische Nicht-Selbst. Die chemische Zusammensetzung des Antigens ist dabei weniger von Bedeutung als die Größe. Denn nur ab einer bestimmten Größe können sie von den Immunzellen ausgemacht werden. Sehr kleine Antigene werden nur entdeckt, wenn sie an ein größeres Trägermolekül gekoppelt sind, die sogenannten Haptene.
Aber wie bemerkt eine Immunzelle ein Nicht-Selbst? Eine Form der Identifizierung basiert auf dem MHC, dem Major Histocompatibility Complex, einer Gruppe von Genen, die ein Abbild dessen zeigen, was in der Zelle produziert wird. Der MHC fungiert wie ein Identitätsausweis der Zelle. Erkennt eine natürliche Killerzelle eine Körperzelle mit natürlichem MHC-Besatz, lässt sie diese in Ruhe. Ist der MHC verändert, weil ein Virus in der Zelle ist, oder ist gar kein MHC vorhanden (typisch für eine Krebszelle), dann wird die Zelle zerstört. So wird vom angeborenen Immunsystem zwischen Selbst und Nicht-Selbst unterschieden, noch bevor das erworbene Immunsystem mit seinen spezifischen Zellen und Molekülen auf den Plan tritt.
Daneben gibt es die Toll-like-Rezeptoren (TLR) auf den Immunzellen. Sie erkennen bestimmte Muster auf den Zielzellen, die dort normalerweise nicht hingehören. Dazu zählen Pathogen associated molecular patterns (PAMPS) und Damage associated molecular patterns (DAMPS). PAMPS sind Signaturen auf Mikroben (wie Bakterien, Pilzen oder Parasiten) oder auf virusinfizierten Körperzellen – es sind also Erkennungszeichen an der Oberfläche. Die PAMPS haben sich im Laufe von Millionen von Jahren nicht wesentlich verändert, und während wir Menschen uns im Tandem mit diesen Strukturen entwickelten, bildeten unsere Immunzellen auch »Sinne« aus, um die PAMPS zu erkennen – eben die TLR. Die Immunzellen schwirren mit diesen TLR durch den Organismus, und sobald sie ein PAMPS auf einer Zelle ausmachen, kommt es zu einer Aktivierung des angeborenen Immunsystems und zu einer akuten Entzündung. Eine solche Entzündung kann allerdings auch aufgrund einer Zellschädigung entstehen und dann entdecken die TLRDAMPS. Bei einer Chemotherapie beispielsweise werden sehr viele Zellen geschädigt, zeigen daraufhin DAMPS und werden von den TLR identifiziert und entsorgt.
Da effiziente Immunantworten überlebensnotwendig für den Organismus sind, gibt es mehrere Wege, über die er erkennt, dass er in Gefahr ist. Was dann geschieht, geht immer mit einer Entzündung einher.
Entzündung
Wesentlich für das Verständnis von Immungeschehen ist die Entzündung, die dabei im Körper entsteht. An ihr merken wir, dass »da etwas ist«. Ob es eine sich heiß anfühlende, rot gefärbte Schwellung rund um eine Wunde ist oder der entzündlich kratzende Hals bei der Infektion mit einem Rhino- oder Coronavirus.
»Entzündung« ist ein Übergangszustand, der eine erfolgreiche Abwehr erst ermöglichen kann. Dazu gehören neben den zellulären Elementen wie Makrophagen, dendritischen Zellen, natürlichen Killerzellen, Mastzellen, Thrombozyten und Endothelzellen auch Mediatoren. Das sind Moleküle, die die Entzündung einleiten und regulieren. Es gibt sie präformiert – dann geht es um vasoaktive Amine und lysosomale Enzyme – und bei Bedarf neu gebildet – dann sprechen wir von Prostaglandinen und Leukotrienen, plättchenaktivierenden Faktoren, aktiven Sauerstoffverbindungen, Zytokinen und Typ-I-Interferonen. Sie alle helfen auf ihre Weise dabei, das Immunsystem zu aktivieren und beispielsweise die Blutgefäße in den betroffenen Bereichen zu erweitern, was die Durchblutung erhöht und Sauerstoff, Nährstoffe sowie Immunzellen leichter zum Entzündungsherd bringt. Sie führen Makrophagen und Neutrophile an den Ort des Geschehens, wo diese dann Bakterien oder Viren zerstören.
Entzündung ist wesentlich, sie unterstützt den Heilungsprozess und die Reparatur von verletztem Gewebe. Allerdings darf sie weder übermäßig noch chronisch werden, da sie dann körpereigenes Gewebe zu sehr schädigt. Die genannten Mediatoren wirken daher nicht nur proinflammatorisch (entzündungsfördernd), sondern auch antiinflammatorisch (entzündungshemmend), um die Entzündungsreaktion nach der Bekämpfung einer Infektion wieder zu dämpfen.
Unspezifisch und angeboren versus spezifisch und erworben
Unterschieden wird zwischen dem angeborenen und dem erworbenen Immunsystem. Schnell, innerhalb von Minuten und Stunden, wird die angeborene unspezifische Immunabwehr aktiv, was zu einer Entzündung führt. Die erworbene spezifische Immunabwehr ist hingegen erst innerhalb von Tagen einsatzbereit und lernt ständig dazu, um sich weiter zu spezialisieren. Beide Teilbereiche des Immunsystems sind durch unterschiedliche Zelltypen charakterisiert und sie alle gehören zu den weißen Blutkörperchen, den Leukozyten. Weitere zelluläre Bestandteile des Blutes sind die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die vor allem die Aufgabe haben, den über die Lunge gewonnenen Sauerstoff zu den Organen und Zellen zu transportieren. Außerdem gibt es im Blut die Blutplättchen, die Thrombozyten, die bei einer Verletzung an der Blutgerinnung beteiligt sind – letztlich auch eine Form von Abwehr gegen Pathogene von außen, die leichter in den Körper eindringen könnten, wenn eine Wunde lange offen bliebe. Zudem schützt diese Gerinnung natürlich vor zu hohen Blutverlusten. Gebildet werden all die Blutbestandteile aus den sogenannten Stammzellen im Knochenmark, das als ein netzartiges Gebilde die Hohlräume in den Knochen ausfüllt.
Zum angeborenen Immunsystem gehören die Makrophagen, die Granulozyten, die natürlichen Killerzellen und die dendritischen Zellen. Mit ihnen reagiert der Körper sehr schnell auf potenziell gefährliches Nicht-Selbst. Aus Monozyten, sehr großen, im Knochenmark gebildeten Zellen im Blut, werden Makrophagen, sobald sie ins Gewebe übergehen, um dort beispielsweise Bakterien zu vernichten. Die Monozyten warten regelrecht im Knochenmark, bis sie von bereits ausgereiften Makrophagen, die im Gewebe an der Entzündung beteiligt sind, über eine akute Gefahr informiert werden. Sofort schwärmen sie aus und werden beim Austritt aus der Blutbahn ins Gewebe selbst zu Makrophagen, die ihre Kollegen unterstützen können.
Makrophagen sind ziemlich groß und können die Bakterien daher amöbenartig umfließen und schließlich ganz in sich aufnehmen, um sie dort zu zerlegen und zu verdauen. Sie werden deshalb auch »Fresszellen« genannt – in der Fachsprache sagt man statt »fressen« natürlich eleganter »phagozytieren«. Unspezifisch töten die Makrophagen alle potenziellen Feinde, ob diese nun leben oder nur als Zelltrümmer und Fremdstoffe umherschwimmen.
Ähnlich gehen die Granulozyten vor, die aber nicht nur phagozytieren, sondern auch chemische Stoffe aussenden – ihre toxischen Granula –, mithilfe derer Mikroben abgetötet werden. Natürliche Killerzellen nun wieder gehören auch zum unspezifischen, angeborenen Immunsystem, handeln also schnell und gehen dabei aber vor allem gegen Viren und Krebszellen vor. Sie durchlöchern deren Zellmembran, schleusen Enzyme in die Zelle ein, und das führt schließlich zum kontrollierten Zelltod (Apoptose).
Die dendritischen Zellen, die vierten in diesem Bunde, haben eher vermittelnde Aufgaben und holen für den jeweils aktuellen Erregerbefall exakt passende Unterstützer aus dem Heer der spezifischen Immunzellen herbei. Sie agieren damit am Übergang zwischen dem unspezifischen und spezifischen Immunsystem.
Zum spezifischen oder erworbenen Immunsystem gehören die Lymphozyten, bei denen wiederum die T- von den B-Lymphozyten unterschieden werden. Das »T« der T-Lymphozyten kommt von »Thymus«, einem Organ hinter dem Brustbein, in dem die T-Lymphozyten reifen, nachdem sie im Knochenmark gebildet wurden. Das B der B-Lymphozyten stammt von bone marrow, also von »Knochenmark«. B-Lymphozyten verlassen im Gegensatz zu den T-Lymphozyten das Knochenmark zur Reifung nicht, verbleiben also an dem Ort, an dem sie gebildet wurden. Von den T-Lymphozyten und den B-Lymphozyten gibt es immer nur einzelne Spezialisten für ganz bestimmte immunologisch relevante Angreifer, die sich schnell bis in Millionenzahl klonen, sobald sie von dendritischen Zellen entsprechend aufgespürt, informiert und aktiviert werden.
Während die Zellen des unspezifischen Immunsystems unser Leben lang immer das Gleiche tun, nämlich Pathogene abtöten und unschädlich machen (oder den Kollegen dabei helfen), sind die Zellen des spezifischen Immunsystems extrem spezialisiert. So gibt es T- und B-Lymphozyten für so ziemlich jede Art von Antigenen und Erregern. T-Lymphozyten sind eher für intrazelluläre Erreger zuständig, also beispielsweise für Viren. Viren sind mehr oder weniger nichts anderes als genetisches Material, das in den Zellkern des Menschen einzudringen versucht, um dort seine Informationen einzubringen und sich mithilfe der infizierten Zelle zu vermehren. Da virusinfizierte Zellen mit einem MHC markiert sind, können sie gut ausfindig gemacht und direkt im Zell-zu-Zell-Kontakt eliminiert werden. Bakterien und andere extrazelluläre Erreger wie Pilze und Parasiten, die, wie der Name schon verrät, außerhalb von Zellen ihr Unwesen treiben, werden hingegen auf andere Weise zur Strecke gebracht. Hierfür sind insbesondere B-Lymphozyten zuständig, die bei Antigenkontakt zu Plasmazellen differenzieren und große Mengen an Antikörpern produzieren. Diese setzen sich auf die extrazellulären Erreger und markieren sie damit für andere Zellen wie die Fresszellen des unspezifischen Immunsystems und die T-Lymphozyten des spezifischen Immunsystems. Die unspezifischen Fresszellen erkennen den mit Antikörpern besetzten Eindringling als körperfremd, nehmen ihn auf und verdauen ihn. Die zytotoxischen T-Lymphozyten des spezifischen Immunsystems hingegen töten den markierten Eindringling direkt ab. Der Zwischenschritt über die Antikörper ist notwendig, damit die eigentlichen »Immunkämpfer« die schädigenden Nicht-Selbst-Zellen überhaupt wahrnehmen können.
Das spezifische oder erworbene Immunsystem lernt unentwegt weiter dazu. Schließlich sind wir pausenlos von Milliarden dieser winzigen Einflussfaktoren umgeben, die an Einfallstoren zwischen Selbst und Umwelt, wie Schleimhäuten oder Verletzungen, in unseren Körper eindringen könnten. Sie alle können von den Helden des unspezifischen Immunsystems vernichtet werden. Für sie alle warten aber auch einzelne T- und B-Lymphozyten im spezifischen Immunsystem, die die exakt passende Waffe für exakt dieses Bakterium oder diesen Virus oder diesen Pilz zum Einsatz bringen können.
Selbst wehrt Nicht-Selbst ab
Geht es um das Immunsystem, denken viele spontan an die typische Grippeabwehr. Vielleicht ging es Ihnen bislang auch so. Aber es ist natürlich sehr viel mehr. Betrachten wir es von einer Meta-Ebene aus, hat »immun« zunächst allgemein mit Abwehr zu tun, die auf einer Unterscheidung von Selbst und Nicht-Selbst (oder Wir und Nicht-Wir) und der Bewahrung der Grenzen des Selbst (oder Wir) beruht. Auch ein Baum schützt sich auf differenzierte Weise vor Parasiten und Schädlingen, die ihn krank machen und sogar sterben lassen könnten. Jedes lebendige Wesen hat dies im Laufe der Evolution gelernt, anderenfalls wäre es heute nicht mehr da.
Was wir oft nicht mit in den Blick nehmen, ist, dass sich dieses Geschehen nicht nur auf die biologische Abwehr unterschiedlicher Krankheitserreger begrenzt, denn auch dann wären wir wohl alle nicht mehr da. Behaviorale (also das Verhalten betreffende), psychologische und soziale Faktoren spielen ebenfalls in unsere Immunität hinein und verweben sich zu einem komplexen Gebilde purer Lebendigkeit. Kommunikation, Austausch, Lernen, Sterben und Werden, vielfältigst verästelt – wir werden es uns nach und nach genauer anschauen.
Der Begriff »immun« hat seinen Ursprung übrigens in diesem erweiterten Sinne. Munera waren nämlich die Abgaben, die die Römer früher an den Staat zahlen mussten. Als das Römische Reich expandierte, kamen viele weitere Städte hinzu, sogenannte civitates liberae et immunes, sie waren von den Abgaben, die nur echte Römer zahlen mussten, ausgenommen. »Immun« sein heißt also, sich in einer Welt befinden und ihr doch fremd sein«.
Die Immunaktivität im Falle einer Wunde
Am Beispiel einer Wunde lässt sich die Zusammenarbeit des unspezifischen und des spezifischen, angeborenen Immunsystems gut verstehen. Auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Kratzer ist, bedeutet jede Verletzung für die Zellen des Immunsystems einen Kampf um Leben und Tod. Hat irgendein Gegenstand die Haut verwundet, beginnt an dieser Stelle eine enorme Aktivität. Vielleicht hat ein scharfer Dorn beim Brombeerpflücken die Epithelbarriere überwunden und ist ins Bindegewebe eingedrungen. Könnten wir die Stelle mit dem Mikroskop heranzoomen, würden wir sehen, dass einige Körperzellen verletzt oder tot sind und dass nicht nur Schmutz durch die Wunde in unseren Körper eindringt, sondern auch eine große Zahl an Bakterien. Diese Fremdkörper könnten uns gefährlich werden. Sie vermehren sich sehr schnell, da sie ideale Überlebensbedingungen vorfinden, insbesondere die richtige Umgebungstemperatur und ausreichend Nahrungsstoffe. Deshalb geben die umliegenden Körperzellen schnellstmöglich chemische Alarmsignale ab, die das Immunsystem aktivieren. Die Makrophagen reagieren zuerst. Diese großen Zellen kommen in Sekundenschnelle an die Stelle der Verletzung und verleiben sich wie Schaufelbagger so viele Bakterien ein, wie sie schaffen können, um sie unschädlich zu machen – sie agieren als Fresszellen. Im günstigsten Falle reicht ihre Tätigkeit bereits aus. Sind aber zu viele Bakterien in den Körper eingedrungen, rufen die Makrophagen wiederum über biochemische Signale – in Form von Zytokinen, Immunproteinen – nach Verstärkung.
Diese taucht nun in Form von neutrophilen Granulozyten auf. Das ist eine für Bakterien zuständige Unterform der Granulozyten, die chemische Stoffe absondern, mit deren Hilfe die Bakterien umkommen. Oftmals verenden sie dabei selbst und reißen weitere Bakterien mit in den Tod. An der Wunde, die mittlerweile alle Anzeichen einer Entzündung zeigt, entsteht auf diese Weise Eiter. Die Entzündung ist nicht nur wichtig, weil sie das Gewebe erwärmt und die Durchblutung verstärkt – beides unterstützt die Arbeit der Immunzellen –, sie sorgt über die Freisetzung einer Reihe von Botenmolekülen mit Schmerz und Schwellung auch dafür, dass wir diesem Körperbereich Ruhe gönnen und nicht einfach in unserer Handlung fortfahren, was uns möglicherweise weiterhin der Verletzungsgefahr aussetzt.
Abb. 1: Schon bei einer leichten Verletzung der Hautoberfläche kommt es zu einem emsigen Geschehen mit vielen beteiligten Immunzellen, um die Wunde zu versorgen und den Körper zu schützen.
Die bisher in unserer Wunde aktiv gewordenen Makrophagen und Granulozyten unterscheiden nur zwischen Selbst und Nicht-Selbst. Alles, was sie als Nicht-Selbst einstufen, wird zerstört – schnell und möglichst effektiv. Ein bisschen denke ich, wenn ich das schreibe, an einen Freund, der Polizeikommandant bei mir in der Gegend war und einmal erklärte: Wenn jemand gekidnappt wurde oder ein Terroranschlag droht, dann kann man nicht herumphilosophieren, dann muss man das Haus stürmen, dann muss man schnell und effizient aktiv werden. So sehen das auch die Zellen des unspezifischen Immunsystems, die wir ja nicht von ungefähr gern auch als »Kämpfer«, »Soldaten« oder eben »Polizisten« bezeichnen.
Differenzierter – und damit auch langsamer – wird die Immunarbeit, wenn eine dritte Art von Abwehrzellen ins Spiel kommt, die den Übergang vom bis hierhin aktiven unspezifischen hin zum spezifischen Immunsystem markiert: die dendritischen Zellen. Ihre Aufgabe ist es nicht direkt, die gefährlichen Eindringlinge zu beseitigen. Vielmehr nehmen sie Teile der Bakterien in sich auf, »zerhacken« sie in kleine Teile und präsentieren diese an ihrer Oberfläche – sie werden also zu antigenpräsentierenden Zellen. Sie reisen mit diesen Teilen durch die Lymphgefäße zu den nächsten Lymphknoten, die immunologische Zentralen im Organismus darstellen.
Das Ziel der dendritischen Zellen ist es, im Lymphknoten einen bestimmten B-Lymphozyten zu finden, der Teil des spezifischen Immunsystems ist. Und zwar brauchen sie aus dem riesigen Meer an B-Lymphozyten genau den einen, der auf die aktuell angreifenden Bakterien spezialisiert ist. Es kann ein paar Stunden dauern, bis die dendritischen Zellen diesen speziellen B-Lymphozyten ausgemacht haben. Sie bieten, während sie im Lymphknoten unterwegs sind, immer wieder die Bauteile des Bakteriums an ihrer Oberfläche an – wie einen Schlüssel –, bis es bei einem dieser B-Lymphozyten klick macht und der Schlüssel ins Schloss passt.
Durch das Zusammentreffen der dendritischen Zellen samt den bakteriellen Teilen und dem genau passenden B-Lymphozyten wird dieser zunächst entsichert wie eine Pistole. Nun muss er noch aktiviert werden, um sich millionenfach vermehren zu können und die Bakterien zu vernichten. Diese Aktivierung übernehmen die T-Zellen: Mit den Bakterien und den dendritischen Zellen kommen nämlich auch sogenannte naive T-Zellen in die Lymphknoten. Und hier ist ebenfalls eine spezifische T-Zelle dabei, die mit ihrem T-Zellrezeptor genau auf das bakterielle Antigen passt. Daraufhin differenziert die T-Zelle zu einer T-Helfer-Typ-2-(TH2-)Zelle, vermehrt sich (klonale Selektion) und trifft irgendwann auf die entsicherte B-Zelle, die sie nun über bestimmte TH2-Zytokine aktiviert. Jetzt kann sich die B-Zelle vermehren und ihre Klone schütten eine Menge an spezifischen Antikörpern aus, durch die das Bakterium für das zelluläre Immunsystem sichtbar gemacht wird und – endlich – zerstört werden kann.
Sind die Eindringlinge besiegt, kann die Wunde allmählich ausheilen. Bis dahin haben sich die benötigten Immunzellen enorm vermehrt, und da sie nun nicht mehr in dieser Zahl gebraucht werden, töten sie sich selbst. Von den T- und B-Lymphozyten allerdings bleiben so viele als Gedächtniszellen übrig, dass sie den Körper auch künftig vor genau diesen Bakterien, die ihm jetzt gefährlich geworden waren, schützen können. Sie kommen gewissermaßen ins Archiv.
Das perfekte Zusammenspiel zwischen dem angeborenen, unspezifischen und dem erworbenen, spezifischen Immunsystem ermöglicht es dem Organismus, sich gegen eindringende Pathogene der unterschiedlichsten Art effizient zu wehren und zu schützen. Die Zellen des unspezifischen Immunsystems können schnell aggressiv reagieren, während die Zellen des spezifischen Immunsystems etwas länger brauchen, dann aber ganz gezielt ihre spezifischen Waffen gegen genau die dazu passenden Eindringlinge einsetzen.
In diesem ausgeklügelten System – immerhin über Jahrmillionen weiterentwickelt und perfektioniert – gibt es aus Gründen der Energieeffizienz von all den potenziell benötigten Immunzellen immer nur so viele, dass Gefahren bemerkt werden und sich alle Bereiche gegenseitig informieren können. Es wäre sehr ineffektiv und auf Dauer nicht zu leisten, wenn ständig riesige Armeen aller am Immunsystem beteiligten Zellarten durch sämtliche Körperbereiche zögen. Es patrouillieren stets nur wenige, und sobald mehr Zellen einer bestimmten Art benötigt werden, setzt sich die Alarmierungskette in Betrieb und eine rasche Rekrutierung beginnt.
Lerneffekte seit der Schwangerschaft
Das biologische Immunsystem eines jeden Menschen lernt bereits in der Schwangerschaft, um sich nach der Geburt effizient gegen Pathogene wehren zu können. Auch der Weg durch den Geburtskanal ist eine wertvolle Gelegenheit für die Immunzellen, sich mit unterschiedlichen Mikroorganismen bekannt zu machen und sich entsprechend zu differenzieren. Durch die in der Muttermilch enthaltenen Antikörper erhält das Baby zudem einen »passiven Immunschutz«, der besonders in der ersten nachgeburtlichen Zeit wichtig ist, da das eigene Immunsystem des Kindes noch nicht vollständig ausgereift ist.
Die Hygienehypothese von David P. Strachan besagt, dass ein Zuviel an Hygiene und ein Mangel an frühkindlichen Infektionen das Risiko für Allergien und Autoimmunerkrankungen im späteren Leben erhöhen können.77 Kinder aus Großfamilien, die auf dem Land mit viel Kontakt mit Tieren, zu Erde und zu Schmutz groß werden, entwickeln ein leistungsfähigeres Immunsystem als Kinder, die in Kleinfamilien und in der Stadt heranwachsen. Diese sind oft hygienisch überbehütet und haben aufgrund des mangelnden Trainings ihres biologischen Immunsystems häufiger Krankheiten. Ihr spezifisches Immunsystem erhält weniger Chancen, sich gut auf das Leben vorzubereiten.
Schleimhäute als gut beschützte Eintrittspforten in den Körper
Natürlich muss das Immunsystem biologisch-physiologisch nicht nur dann aktiv werden, wenn wir uns verletzen. Mikroorganismen kommen auch auf anderen Wegen in unseren Körper – speziell über die Schleimhäute, die viel durchlässiger sind als die übrige Haut. Denn hier tauschen wir mit der Außenwelt Gase wie Sauerstoff und Kohlendioxid aus oder Festes wie Nahrungsbestandteile und Abfallstoffe. Da wir unentwegt von unzähligen potenziell gefährlichen Mikroorganismen umgeben sind, müssen wir im Bereich dieser Übergangsflächen zwischen Innen und Außen besonders gut geschützt sein. Dafür sorgen nicht nur die mikroskopisch kleinen Vertreter des Immunsystems, sondern auf der physiologischen Ebene beispielsweise bereits feine Härchen in den Schleimhäuten der Nase und später der Bronchien, an denen mögliche Krankheitserreger hängen bleiben und von denen sie gleich wieder nach außen befördert werden. Auch der Schleim, der diesen Häuten den Namen gibt, dient der frühzeitigen Abwehr. Er kann Viren und Bakterien mithilfe von in ihm enthaltenen antimikrobiellen Substanzen zur Strecke bringen – eine Form der Abwehr auf chemischer Ebene.
Typische Krankheiten der Atemwege oder der Verdauungsorgane entstehen, wenn sich Antigene trotz allem an diesen Schnittstellen zwischen Außen- und Innenwelt angesiedelt haben oder über diese Pforten bereits in den Körper gelangt sind und unsere Immunabwehr nicht so leicht damit fertigwird. Weil diese Bereiche so sensibel sind, finden sich hier Immunzellen häufig zu Immungeweben zusammen, in den Mandeln im Rachenraum beispielsweise und natürlich in den verschiedenen Lymphknoten. Milz und Thymusdrüse im Innern des Körpers sind sogar richtige Immunorgane, die große Mengen an Zellen des Immunsystems produzieren und speichern, damit sie im Bedarfsfall möglichst schnell einsatzbereit sind. In all diesen Geweben und Organen tauschen die unterschiedlichen Arten von Immunzellen ihre Informationen aus, damit jederzeit im ganzen Körper der jeweiligen Situation angemessen gehandelt werden kann. Auch an den Schleimhäuten wird zuerst das unspezifische Immunsystem kämpferisch aktiv und vermittelt zugleich an das spezifische Immunsystem.
Der Abwehrkampf an den Schleimhäuten lässt sich gut anhand einer Virusinfektion des Atemtrakts darstellen. Ist eine dort ansässige Schleimhautzelle mit einem Virus infiziert, erkennt das eine natürliche Killerzelle am Fehlen des MHC-Moleküls auf der Zelle. Daraufhin zerstört die Killerzelle die virusinfizierte Zelle, indem sie sie durchlöchert und in den Zelltod treibt. Gleichzeitig setzt die Killerzelle Interferon-gamma frei, das Makrophagen und dendritische Zellen aktiv werden lässt. Während Makrophagen die entzündliche Reaktion gegen das Virus weiter anfachen, stimulieren die dendritischen Zellen das erworbene Immunsystem, indem sie Virusantigene an ihrer Oberfläche präsentieren und damit naive T-Zellen aktivieren. Diese wiederum differenzieren zu T-Helfer-Typ-1-(TH1-)Zellen und setzen bestimmte TH1-Zytokine frei, die zytotoxische T-Zellen dazu bringen, die virusinfizierte Zelle direkt zu attackieren, und B-Zellen veranlassen, Antikörper gegen das Virus freizusetzen. Zusätzlich verhindern Immunglobulin-A-Antikörper, dass sich immer mehr Pathogene in der Schleimhaut einnisten können, und neutralisieren sie.
Es kommt zu einer Entzündungsreaktion, die hilfreich ist, weil eine mit Schwellung, Wärme, Schmerz, Rötung und Bewegungseinschränkung einhergehende Entzündung das Gefahrengebiet eingrenzt, die Heilung anstößt und den Menschen zu mehr Ruhe zwingt. Sie darf aber insbesondere im Bereich der Atemorgane nicht zu stark ausfallen, da sie die Atemwege gefährlich einengen könnte.
Mikroben als unsere Evolutionspartner
Viren sind schrecklich! Wirklich? Ja, sie befallen unseren Körper, entern die Zellen und können uns am Ende sogar umbringen. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Viren waren nämlich auch wesentlich für die Evolution und unsere Weiterentwicklung als Menschheit und sind es weiterhin. Sie bringen uns stetig Informationen der Außenwelt bis in unsere Zellen hinein und wir müssen darauf reagieren, indem wir uns anpassen. Ein erheblicher Teil unserer DNA – etwa ein Zehntel – stammt ursprünglich von Viren. Während wir uns wehren, entwickeln wir uns weiter und lernen dazu. Sie zwingen uns geradezu, die Evolution mit voranzutreiben. Und das betrifft nicht nur uns Menschen, auch die Tierwelt hat ihre genetische Vielfalt und spektakuläre Weiterentwicklung über Jahrmillionen unter anderem den Viren zu verdanken.
Von Viren abstammende Gene haben beispielsweise grundlegend zur evolutionären Entwicklung der menschlichen Plazenta beigetragen. Ein Retro-Virus-Gen (das Syncytin-Gen) ermöglicht die Bildung eines Proteins, das es dem Virus leichter macht, mit der Zellmembran des Wirts zu fusionieren und damit die Zelle zu infizieren. Nachdem dieses Gen in das menschliche Genom eingebaut wurde, hat es im Lauf der Zeit einen neuen Zweck bekommen. Nun sorgt es für ein Protein, das es möglich macht, dass sich Plazenta und Uterus miteinander verbinden.76
Schon immer haben Viren ihre genetischen Informationen in unser Erbgut eingebaut, wenn sie unsere Zellen eroberten, und so für einen Informationsaustausch mit der Umwelt und durch den entstehenden Anpassungsdruck für eine kreative Weiterentwicklung gesorgt. Ändern sich bestimmte Parameter in der Welt, sind die Viren ein Ausdruck davon. Indem wir uns infizieren, werden wir zugleich informiert – ob wir krank werden oder nicht, unser Immunsystem integriert das Neue in den Organismus.