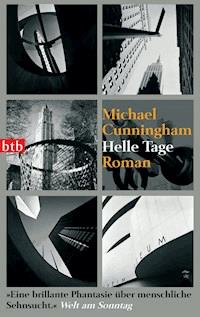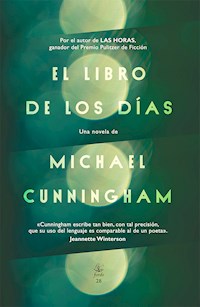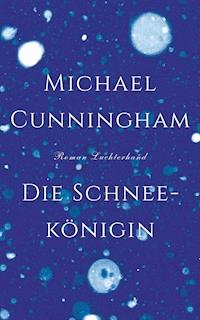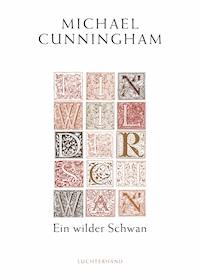Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel By Nightfall
bei Farrar, Straus and Giroux, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2010
Mare Vaporum Corp., in Übereinkunft mit dem Autor
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010
Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Satz: Greiner & Reichel, Köln
eISBN 978-3-641-05217-1
V003
www.luchterhand-literaturverlag.deBitte besuchen Sie unseren LiteraturBlogwww.transatlantik.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Inschrift
Eine Party
Das eherne Zeitalter
Ihr Bruder
Kunstgeschichte
Brudermord
Nachtstadt
Ein Objekt von unschätzbarem Wert
Kostbare Hühner
Im Traum
Danksagung
Copyright
Für Gail Hochman und Jonathan Galassi
Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang.
Rainer Maria Rilke
Eine Party
Das Missgeschick wird kommen und eine Weile bleiben.
»Bist du sauer wegen Missy?«, sagt Rebecca.
»Natürlich nicht«, antwortet Peter.
Eines der anachronistischen alten Pferde, die Touristenkutschen ziehen, ist irgendwo droben am Broadway von einem Auto erfasst worden, was den Verkehr bis runter zur Port Authority aufhielt, weshalb sich Peter und Rebecca verspäten.
»Vielleicht wird es Zeit, dass wir ihn Ethan nennen«, sagt Rebecca. »Wetten, dass ihn außer uns niemand mehr Missy nennt.«
Missy ist die Kurzform von Missgeschick.
Draußen trippeln Tauben über eine blau blinkende Sony-Reklame neben dem Taxi. Ein älterer bärtiger Mann in einem schmutzigen, bodenlangen Mantel, großartig auf seine Art (ein stattlicher und feister Buck Mulligan?), schiebt einen Einkaufswagen voll diverser Sachen in diversen Müllsäcken und kommt schneller voran als jedes Auto.
Im Taxi ist die Luft schwer von einem starken Raumduft, der leicht blumig ist, aber eigentlich auf nichts anderes als eine chemische Verbindung hindeutet, die als »süß« bezeichnet werden muss.
»Hat er dir gesagt, wie lange er bleiben will?«, fragt Peter.
»Ich bin mir nicht sicher.«
Ihre Augen werden sanft. Sich zu viele Sorgen um Missy (Ethan) zu machen ist eine Angewohnheit, die sie nicht loswird.
Peter hakt nicht nach. Wer will mitten in einem Streit zu einer Party gehen?
Er hat einen empfindlichen Magen, und ein Song geht ihm ständig durch den Kopf. I’m sailing away, set an open course for a virgin sea … Woher kommt das denn? Er hat Styx seit dem College nicht mehr gehört.
»Wir sollten eine Grenze setzen«, sagt er.
Sie seufzt, legt ihre Hand leicht auf sein Knie, blickt aus dem Fenster auf die Eighth Avenue, auf der sie jetzt überhaupt nicht mehr weiterkommen. Rebecca ist eine Frau mit kräftigen Zügen – die oft als schön bezeichnet wird, aber nie als hübsch. Sie mag diese kleinen Gesten wahrnehmen, mit denen sie Peter wegen seiner Knickrigkeit tröstet, oder auch nicht.
A gathering of angels appeared above my head.
Peter dreht sich um und blickt ebenfalls aus dem Fenster. Die Autos auf der Fahrspur neben ihnen kriechen voran. Etwas leicht verbeultes, blaues Toyotahaftes voller junger Männer schiebt sich auf gleiche Höhe; ausgelassene Jungs in den Zwanzigern, die so laut Musik spielen, dass Peter spürt, wie das Wummern in den Rahmen des Taxis dringt, als sie näher kommen. Sechs, nein, sieben sind in das Auto gezwängt, und alle schreien oder singen unhörbar; stramme Jungs, für den Samstagabend aufgebrezelt, die Haare zu Zacken gegelt, hier und da blitzen Piercings oder Ketten auf, wenn sie miteinander rangeln oder Kopfnüsse verteilen. Der Verkehr auf ihrer Spur wird schneller, und als sie vorbeiziehen, sieht Peter, meint er zu sehen, dass einer von ihnen, einer der vier, die auf dem Rücksitz herumtoben, ein alter Mann ist, der offenbar eine schwarze Stachelperücke trägt, mit den anderen schäkert und schreit, aber schmale Lippen und hohle Wangen hat. Er rubbelt den Kopf des Jungen, der neben ihm klemmt, schreit ihm ins Ohr (funkeln da Zahnverblendungen?), und dann sind sie weg, bewegen sich mit dem Verkehr. Kurz darauf ist die Soundwolke mit ihnen davongezogen. Jetzt bietet der braune Kasten eines Lieferwagens in blankem Gold den flügelfüßigen Gott von FTD dar. Blumen. Jemand bekommt Blumen.
Peter wendet sich wieder Rebecca zu. Ein alter Mann im Jungmännerfummel ist etwas, das man gemeinsam bemerken muss; es ist eigentlich keine Geschichte, die man ihr erzählen kann, oder? Außerdem, sind sie nicht gereizt und mitten in einem sich anbahnenden Streit? Wenn man lange verheiratet ist, lernt man, eine Vielzahl verschiedener Stimmungen und Witterungen zu erkennen.
Rebecca hat gespürt, dass Peter sich vom Fenster abgewandt hat. Sie schaut ihn verdutzt an, als hätte sie gar nicht erwartet, ihn zu sehen.
Wenn er vor ihr stirbt, wird sie dann seine körperlose Präsenz in einem Raum spüren können?
»Keine Sorge«, sagt er. »Wir werden ihn nicht auf die Straße setzen.«
Sie presst die Lippen zusammen. »Nein, wirklich, ein paar Grenzen sollten wir ihm setzen«, sagt sie. »Es ist nicht gut, wenn man ihm immer alles gibt, was er zu wollen meint.«
Was ist das? Auf einmal tadelt sie ihn wegen ihres verlorenen kleinen Bruders?
»Was hältst du für einen vernünftigen Zeitraum?«, fragt er und wundert sich, dass sie seinen ungehaltenen Tonfall anscheinend nicht bemerkt. Wie kann es sein, dass sie sich nach all der Zeit so schlecht kennen?
Sie schweigt, denkt nach, und dann, so als hätte sie einen dringenden Auftrag vergessen, beugt sie sich vor und fragt den Fahrer: »Woher wissen Sie, dass es ein Unfall mit einem Pferd ist?«
Trotz seiner Gereiztheit kann Peter die Fähigkeit der Frauen bewundern, Männern direkte Fragen zu stellen, ohne dass es so wirkt, als wollten sie einen Streit anzetteln.
»Anruf von der Zentrale«, sagt der Fahrer und deutet auf seinen Ohrhörer. Sein kahler Kopf sitzt erhaben auf dem braunen Sockel seines Halses. Er hat natürlich seine eigene Geschichte, und die hat mit einem gut gekleideten Paar mittleren Alters im Fond seines Taxis überhaupt nichts zu tun. Sein Name ist dem Schild an der Rückseite des Vordersitzes zufolge Rana Saleem. Ein Inder? Iraner? Er hätte dort, wo er herkommt, ein Arzt gewesen sein können. Oder ein Arbeiter. Oder ein Dieb. Man kann nie wissen.
Rebecca nickt, lehnt sich wieder zurück. »Ich denke eher an andere Grenzen«, sagt sie.
»Was für welche?«
»Er kann sich nicht ewig auf andere verlassen. Und, du weißt schon.Wir machen uns immer noch Sorgen wegen der anderen Sache.«
»Meinst du, seine große Schwester kann ihm dabei helfen?«
Sie schließt die Augen, ist jetzt eingeschnappt, jetzt, als er mitfühlend sein wollte.
»Ich meine damit«, sagt Peter, »nun ja. Du kannst ihm vermutlich nicht dabei helfen, sein Leben zu ändern, wenn er es nicht von sich aus will. Ich meine, ein Drogenabhängiger ist irgendwie unberechenbar.«
Sie lässt die Augen geschlossen. »Er war ein ganzes Jahr clean. Wann hören wir endlich auf, ihn als Drogenabhängigen zu bezeichnen?«
»Ich bin mir nicht sicher, ob wir das jemals tun.«
Wird er allmählich scheinheilig? Faselt er einfach Zwölf-Stufen-Platitüden daher, die er weiß Gott wo aufgeschnappt hat?
Das Problem mit der Wahrheit ist, dass sie so oft lau und klischeebehaftet ist.
Sie sagt: »Vielleicht ist er bereit für eine gewisse Stabilität im Leben.«
Ja, vielleicht. Missy hat ihnen per E-Mail mitgeteilt, dass er beschlossen hat, »irgendetwas mit Kunst« machen zu wollen. Das wäre dann Irgendetwas mit Kunst, eine Beschäftigung ohne triftigen Grund, ohne Vorsätze. Spielt keine Rolle. Die Menschen (manche Menschen) sind froh, wenn Missy überhaupt irgendwelche sinnvollen Neigungen äußert.
Peter sagt: »Dann werden wir tun, was wir können, um ihm eine gewisse Stabilität zu geben.«
Rebecca drückt liebevoll sein Knie. Er ist brav gewesen.
Hinter ihnen hupt jemand. Was genau glaubt er damit bewirken zu können?
»Vielleicht sollten wir hier aussteigen und die U-Bahn nehmen«, sagt sie.
»Wir haben so eine perfekte Entschuldigung dafür, dass wir zu spät kommen.«
»Meinst du, das heißt, dass wir lange bleiben müssen?«
»Auf keinen Fall. Ich verspreche dir, dass ich dich loseise, bevor Mike so betrunken ist, dass er anfängt, dich anzubaggern.«
»Das wäre zauberhaft.«
Schließlich kommen sie zur Ecke Eighth Avenue und Central Park South, wo die Überreste des Unfalls noch nicht ganz beseitigt sind. Dort, hinter Warnleuchten und tragbaren Absperrpfosten, hinter den beiden Polizisten, die den Verkehr zum Columbus Circle umleiten, ist das beschädigte Auto, ein weißer Mercedes, der schräg auf der Fifty-ninth Street steht und im Schein der Warnlichter rosa schimmert. Dort muss der Leichnam des Pferdes sein, mit einer schwarzen Plane bedeckt. Unter der Plane, teerartig und schwer, zeichnet sich das Hinterteil des Pferdes ab. Der übrige Körper könnte irgendetwas sein.
»Mein Gott«, flüstert Rebecca.
Peter weiß: Jeder Unfall, jede Erinnerung daran, dass einem auf dieser Welt etwas zustoßen kann, versetzt sie, versetzt sie beide kurz in Panik – wegen Bea. Ist sie irgendwie nach New York gekommen, ohne ihnen Bescheid zu sagen? Könnte sie womöglich mit einer Pferdekutsche gefahren sein, obwohl sie so etwas nie tun würde?
Die Elternschaft, so scheint es, macht einen ein Leben lang nervös. Selbst wenn die Tochter zwanzig ist und voller fröhlicher, undurchdringlicher Wut und es ihr in Boston, 240 Meilen entfernt, nicht ganz so gut geht.Vor allem dann.
Er sagt: »Man denkt nie daran, dass diese Pferde von Autos erfasst werden können. Man denkt kaum daran, dass sie Tiere sind.«
»Es gibt sogar eine … Bewegung. Gegen die Art und Weise, wie diese Pferde behandelt werden.«
Natürlich. Rana Saleem hier fährt ein Nachttaxi. Auf den Straßen sind mittellose Männer und Frauen unterwegs, deren Füße mit Lumpen umwickelt sind. Die Kutschenpferde müssen ein trostloses Leben haben, ihre Hufe sind vom Asphalt vermutlich rissig und gespalten. Wie monströs ist es, trotzdem seinen Geschäften nachzugehen?
»Dann wird das hier gut für die Pferdeschützer sein«, sagt er.
Warum klingt er so herzlos? Er möchte streng sein, nicht hart; er ist selbst darüber erschrocken, wie er klingen kann. Manchmal kommt es ihm so vor, als hätte er den Dialekt seiner eigenen Sprache nicht ganz gemeistert – als beherrschte er mit seinen vierundvierzig Jahren das Peterische noch nicht fließend.
Nein, noch ist er erst dreiundvierzig. Warum will er ständig ein Jahr dazuzählen?
Nein, Moment, er ist letzten Monat vierundvierzig geworden.
»Dann ist das arme Ding vielleicht nicht umsonst gestorben«, sagt Rebecca. Tröstend streicht sie mit einer Fingerspitze über Peters Kinnlade.
In welcher Ehe kommt es nicht zu unzähligen Verkrustungen, einer Gebärdensprache, einem Gefühl des Wiedererkennens, scharf wie Zahnschmerzen? Unglücklich, klar. Welches Paar ist nicht unglücklich, zumindest zeitweise? Aber wie kann es sein,dass die Scheidungsrate,wie es heißt, in die Höhe schießt? Wie elend muss man sich fühlen, damit man die tatsächliche Trennung ertragen, weggehen und ein so völlig unerkanntes Leben führen kann?
»Eine Schweinerei«, sagt der Fahrer.
»Ja.«
Und dennoch ist Peter natürlich fasziniert von dem Auto und dem Kadaver des Pferdes. Ist das hier nicht eines der bitteren Vergnügen von New York City? Es ist eine Schweinerei, so wie Courbets Paris eine war. Es ist schmutzig und übelriechend, es ist schädlich. Es stinkt nach Sterblichkeit.
Wenn überhaupt, dann bedauert er, dass das Pferd zugedeckt worden ist. Er möchte es sehen: die gebleckten gelben Zähne, die heraushängende Zunge, das schwarze Blut auf dem Straßenbelag. Aus den üblichen morbiden Gründen, aber auch … der Gewissheit wegen.Wegen des Gefühls, dass ihm und Rebecca durch den Tod eines Tieres nicht nur Unannehmlichkeiten bereitet wurden, sondern dass sie auf eine geringfügige Art und Weise auch daran teilhatten, dass das Ableben des Pferdes sie einbezieht, ihre Bereitschaft, es wahrzunehmen. Wollen wir nicht immer die Leiche sehen? Als Dan und er Matthews Leichnam wuschen (mein Gott, das war vor fast fünfundzwanzig Jahren), hatte er da nicht ein gewisses Hochgefühl, das er hinterher weder gegenüber Dan noch sonst jemandem erwähnte?
Das Taxi kriecht in den Columbus Circle und beschleunigt dann. Die Statue von Christoph Columbus (der, wie sich herausstellt, eine Art Massenmörder war, stimmt’s?) oben auf der Granitsäule ist durch die Warnleuchten, die das tote Pferd bewachen, in einen rosigen Hauch getaucht.
I thought that they were angels, but to my surprise, we irgendwas irgendwas irgendwas, and headed for the skies …
Der Sinn einer Party ist, auf der Party gewesen zu sein. Die Belohnung ist, hinterher essen zu gehen, sie beide, und danach wieder nach Hause.
Die Einzelheiten variieren. Heute Abend ist da Elena Petrova, ihre Gastgeberin (ihr Mann ist immer irgendwo unterwegs, vermutlich sollte man lieber nicht fragen, was er macht), klug, laut und herausfordernd vulgär (ein ständiger Disput zwischen Peter und Rebecca – weiß sie um den Schmuck, den Lippenstift und die Brille, will sie damit etwas sagen, wie kann man so reich und intelligent sein und es nicht wissen?); da sind der kleine, sehr gute Artschwager, der große, ziemlich gute Marden und das Waschbecken von Gober, in das ein Gast – der nie identifiziert wurde – einmal einen Aschenbecher geleert hat; da ist Jack Johnson, der majestätisch steif auf einem Zweisitzer neben Linda Neilson thront, die angeregt zu der arktischen Topographie von Jacks Gesicht spricht; da ist der erste Drink (Wodka auf Eis; Elena serviert eine berühmte unbekannte Marke, die sie sich aus Moskau liefern lässt – wirklich, kann Peter oder irgendwer den Unterschied erkennen?), gefolgt von einem zweiten Drink, aber keinem dritten; da ist das beharrlich glitzernde Schwirren der Party, gewaltigen Reichtums, immer ein bisschen berauschend, egal, wie vertraut es wird; da ist der rasche Blick zu Rebecca (ihr geht es gut, sie redet mit Mona und Amy, Gott sei gedankt für eine Frau, die bei solchen Anlässen allein zurechtkommt); da ist das unvermeidliche Gespräch mit Bette Rice (er bedauert, dass er die Vernissage verpasst hat, er hat gehört, dass die Inksies phantastisch sind, er wird diese Woche vorbeikommen), mit Doug Petrie (Lunch, am Montag in einer Woche, unbedingt) und mit der anderen Linda Neilson – Ja, klar, ich rede mit deinen Studenten, ruf mich in der Galerie an, dann vereinbaren wir einen Termin; da ist das Pinkeln unter einer Ellsworth-Kelly-Zeichnung, die neuerdings im Badezimmer hängt (Elena kann es nicht wissen, oder – wenn sie so was über die Toilette hängt, muss sie es auch mit ihrer Brille ernst meinen); da ist der Entschluss, doch einen dritten Wodka zu trinken; da ist der Flirt mit Elena – Hey, ich liebe den Wodka; mein Engel, du weißt doch, dass du ihn hier jederzeit kriegen kannst (er weiß, er ist dafür bekannt und wird vermutlich deswegen verachtet, weil er es überstrapaziert, das ganze Hey-ich-würde-dich-ja-besuchen-wenn-ich Zeit-hätte); da ist der magere, hysterische Mike Forth, der mit Emmett bei dem Terence Koh steht und allmählich so betrunken wird, dass er sich bald an Rebecca ranmachen wird (Peter hat Verständnis für Mike, kann nicht anders, er hat es selbst erlebt – dreißig Jahre später ist er noch immer verblüfft, dass Joanna Hurst ihn nicht geliebt hat, nicht einmal ein bisschen); da ist der kurze Blick auf den unwahrscheinlich gut aussehenden Kellner, der in der Küche heimlich in sein Handy spricht (Freund, Freundin, käuflicher Sex – wenigstens haben die Kids, die bei solchen Anlässen bedienen, noch etwas Geheimnisvolles an sich); dann zurück ins Wohnzimmer, wo – ups – Mike es schließlich doch geschafft hat, Rebecca zu stellen; er redet wie wild auf sie ein, und sie nickt und hält Ausschau nach der Rettung, die Peter ihr versprochen hat; da ist Peters rascher Rundblick, um sich zu vergewissern, dass niemand übergangen wurde; da ist das Abschiedsgespräch mit Elena, die es bedauert, dass sie die Vincents nicht gesehen hat (Ruf mich an, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich dir gern zeigen würde); da ist der seltsam innige Abschied von Bette Rice (irgendwas stimmt nicht), die Rückeroberung von Rebecca (Sorry, ich muss sie jetzt entführen, ich hoffe, wir sehen uns bald), das panische Abschiedsgrinsen von Mike, und tschüs, tschüs, danke, bis nächste Woche, ja, unbedingt, ruf mich an, okay, tschüs.
Ein anderes Taxi, wieder nach Downtown. Peter meint manchmal, dass er sich am Ende, wann immer es kommt, an Taxifahrten viel lebhafter erinnern wird als an alles andere aus seinem irdischen Dasein. Egal, wie unangenehm die Gerüche sind (kein Raumduft diesmal, nur ein leichter Unterton von Gallenflüssigkeit und Motoröl) oder wie aggressiv und unfähig der Fahrer ist (diesmal einer dieser Typen, die ständig Gas geben und bremsen), stets ist da das Gefühl des abgekapselten Dahinschwebens, das Gefühl, sich unbehelligt durch die Straßen dieser unglaublichen Stadt zu bewegen.
Sie durchqueren den Central Park auf der Seventy-ninth Street, eine der schönsten aller nächtlichen Taxistrecken, wenn der Park in seinen grün-schwarzen Traum von sich selbst versunken ist und kleine, grün-goldene Lichter Kreise aus Gras und Asphalt auf den Boden malen. Natürlich sind hier verzweifelte Menschen unterwegs, manche davon Flüchtlinge, manche Kriminelle; wir kommen so gut wir können mit diesen unmöglichen Widersprüchen zurecht, diesem endlosen Streit zwischen Herrlichkeit und Mord.
Rebecca sagt: »Du hast mich nicht vor Hurrikan Mike gerettet.«
»Hey, ich habe dich losgerissen, sobald ich dich mit ihm gesehen habe.«
Sie sitzt nach innen gewandt und hat die Arme um die Schultern geschlungen, obwohl es nicht einmal andeutungsweise kalt ist.
Sie sagt: »Das weiß ich doch.«
Aber dennoch hat er sie enttäuscht, nicht wahr?
Er sagt: »Mit Bette scheint irgendetwas los zu sein.«
»Rice?«
Wie viele andere Bettes waren auf der Party? Wie viel Lebenszeit muss er für das Beantworten dieser überflüssigen Fragen opfern, wie viel näher rückt die Wahrscheinlichkeit, dass er eines Tages einen Schlaganfall bekommt, wenn er sich immer wieder aufregen muss, weil Rebecca nicht aufgepasst hat, nicht bei der gottverdammten Sache gewesen ist?
»M-hm.«
»Was ist es deiner Meinung nach?«
»Ich habe keine Ahnung. Irgendwas war da, als sie sich verabschiedet hat. Ich habe irgendwas gespürt. Ich rufe sie morgen an.«
»Bette ist in einem bestimmten Alter.«
»Meinst du die Menopause?«
»Unter anderem.«
Sie faszinieren ihn, diese kleinen Bekundungen weiblicher Gewissheit. Sie stammen geradewegs von Henry James und George Eliot, nicht wahr? Genau genommen sind wir aus dem gleichen Stoff gemacht wie ihre Heldinnen, wie Isabel Archer, wie Dorothea Brooke.
Das Taxi erreicht die Fifth Avenue, biegt rechts ab. Von der Fifth Avenue aus wirkt der Park wieder wie eine schlummernde nächtliche Gefahr, wie ein wartendes, sich zusammenbrauendes Etwas zwischen den schwarzen Bäumen. Haben die Milliardäre, die in diesen Häusern wohnen, jemals dieses Gefühl? Wenn ihre Fahrer sie nachts nach Hause bringen, werfen sie dann jemals einen Blick über die Straße und glauben, vorerst, gerade noch, vor dem Wilden, das sie mit großer, gieriger Geduld von den Bäumen aus beobachtet, sicher zu sein?
»Wann kommt Missy?«, fragt er.
»Er hat gesagt, nächste Woche. Du weißt ja, wie er ist.«
»Mm.«
Peter weiß in der Tat, wie er ist. Er ist einer dieser pfiffigen, unsteten jungen Menschen, der nach gewissen Überlegungen beschließt, dass er Irgendetwas mit Kunst machen will, aber nicht an einen wirklichen Job denkt, es möglicherweise gar nicht kann; der sich anscheinend vorstellt, dass Jugend, Köpfchen und Bereitwilligkeit einen Beruf heraufbeschwören, dessen genaue Beschaffenheit sich mit der Zeit erweisen wird.
Diese von Frauen dominierte Familie hat den armen Jungen kaputtgemacht, nicht wahr? Wer kann es überleben, so verzweifelt geliebt zu werden?
Rebecca wendet sich zu ihm, hat die Arme noch verschränkt. »Kommt es dir nicht manchmal lächerlich vor?«
»Was?«
»Diese Partys und Dinners, all diese schrecklichen Leute.«
»Sie sind nicht schrecklich.«
»Ich weiß. Ich habe es nur satt, all die Fragen zu stellen. Die Hälfte dieser Leute weiß nicht einmal, was ich mache.«
»Das stimmt nicht.«
Na ja, vielleicht stimmt es ein bisschen. Blue Light, Rebeccas Kunst- und Kulturmagazin, ist bei solchen Leuten nicht der große Knaller, ich meine, es ist nicht das Artforum oder Art in America. Es geht um Kunst, klar, aber auch um Lyrik und Belletristik, und gelegentlich enthält es auch – Schrecken aller Schrecken – eine Modestrecke.
Sie sagt: »Wenn es dir lieber ist, dass Missy nicht bei uns wohnt, suche ich eine andere Unterkunft für ihn.«
Ach, es geht immer noch um Missy, nicht wahr? Den kleinen Bruder, die Liebe ihres Lebens.
»Nein, es ist völlig okay. Ich habe ihn wie lange nicht mehr gesehen? Fünf Jahre? Sechs?«
»Ganz recht. Du bist damals nach Kalifornien nicht mitgekommen.«
Plötzlich ein schmerzliches und unverhofftes Schweigen. War sie wütend auf ihn, weil er nicht nach Kalifornien gekommen war? War er wütend auf sie, weil sie wütend war? Er kann sich nicht erinnern. Aber irgendetwas war schlecht in Bezug auf Kalifornien.Was?
Sie beugt sich vor und küsst ihn liebevoll auf die Lippen.
»Hey«, flüstert sie.
Sie vergräbt ihr Gesicht an seinem Hals. Er schlingt einen Arm um sie.
»Die Welt ist manchmal ermüdend, nicht wahr?«, sagt sie.
Frieden geschlossen. Und dennoch. Rebecca kann sich an jedes noch so geringfügige Verbrechen von Peter erinnern und es ihm monatelang vorhalten, wenn ein Streit hitzig wird. Hat er heute Abend einen Verstoß begangen, irgendetwas, das er im Juni oder Juli zu hören bekommen wird?
»M-hm«, sagt er.»Weißt du, ich glaube, wir können eindeutig sagen, dass es Elena ernst meint mit den Haaren und der Brille et cetera.«
»Ich hab’s dir doch gesagt.«
»Hast du nicht.«
»Du erinnerst dich bloß nicht.«
Das Taxi hält an der Ampel an der Sixty-fifth Street.
Hier sind sie: ein Paar mittleren Alters im Fond eines Taxis (diesmal heißt der Fahrer Abel Hibbert, ist jung und nervös, schweigsam, geladen). Hier sind Peter und seine Frau, seit einundzwanzig (fast zweiundzwanzig) Jahren verheiratet, mittlerweile freundschaftlich verbunden, zu Frotzeleien aufgelegt, haben nicht mehr oft Sex, kommen aber auch nicht ohne Sex aus, wie andere lange verheiratete Paare, die er beim Namen nennen könnte, und ja, in einem gewissen Alter kann man sich größere Errungenschaften vorstellen, eine tiefere und unerschütterlichere Zufriedenheit, aber was du für dich geschaffen hast, ist nicht schlecht, überhaupt nicht schlecht. Peter Harris, ein feindseliges Kind, ein furchtbarer Jugendlicher, Gewinner diverser zweiter Preise, ist an diesem gewöhnlichen Augenblick angelangt, hat Beziehungen, ist beschäftigt, wird geliebt, spürt den warmen Atem seiner Frau am Hals, fährt nach Hause.
Come sail away, come sail away, come sail away with me, dup-dup-di-dup …
Wieder dieser Song.
Die Ampel springt um. Der Fahrer gibt Gas.
Der Sinn beim Sex ist … Sex hat keinen Sinn.
Es ist nur so, dass es nach all den Jahren kompliziert werden kann. An manchen Abenden kommt man sich ein bisschen … Nun ja. Man will eigentlich gar keinen Sex, aber man will auch nicht die Hälfte eines Paars sein, das eine erwachsene Tochter hat, geheime Sorgen und eine gute, wenn auch leicht heikle Freundschaft, zu der nicht mehr unbedingt Sex an einem Samstagabend gehört, nach einer Party, leicht angesäuselt von Elena Petrovas vielgepriesenem persönlichem Wodka, dazu einer Flasche Wein beim Essen hinterher.
Er ist vierundvierzig. Erst vierundvierzig. Sie ist noch nicht einmal einundvierzig.
Dein empfindlicher Magen steigert die Lust auch nicht unbedingt. Was hat es damit auf sich? Was sind die ersten Symptome eines Geschwürs?
Im Bett trägt sie ein Höschen, ein Hanes-T-Shirt mit V-Ausschnitt und Baumwollsocken (sie bekommt bis zum Hochsommer kalte Füße). Er trägt eine weiße Unterhose. Sie sehen sich zehn Minuten lang CNN an (eine Autobombe in Pakistan, siebenunddreißig Tote; eine abgefackelte Kirche in Kenia, in der eine noch nicht bekannte Anzahl von Menschen war; ein Mann, der gerade seine vier kleinen Kinder von einer fünfundzwanzig Meter hohen Brücke in Alabama geworfen hat – nichts über das Pferd, aber das dürfte in den Lokalnachrichten kommen, wenn überhaupt), dann zappen sie herum, verweilen eine Zeitlang bei Vertigo, der Szene, in der James Stewart Kim Novak (in diesem Fall Madeleine) zu der Missionsstation mitnimmt, um sie davon zu überzeugen, dass sie nicht die Reinkarnation einer toten Kurtisane ist.
»Wir sollten es ausmachen«, sagt Rebecca.
»Wie spät ist es?«
»Nach Mitternacht.«
»Den habe ich seit Jahren nicht gesehen.«
»Das Pferd ist noch da.«
»Was?«
»Das Pferd.«
Kurz darauf sitzen James Stewart und Kim Novak tatsächlich in einer alten Kutsche hinter einem lebensgroßen Pferd aus Plastik oder so etwas Ähnlichem.
»Ich dachte, du meinst das Pferd von vorhin«, sagt Peter.
»Oh. Nein. Komisch, wie diese Sachen auftauchen, nicht wahr? Wie lautet das Wort?«
»Synchronizität. Woher weißt du, dass das Pferd noch da ist?«
»Ich war dort. Bei dieser Missionsstation. Im College. Es sieht genauso aus wie im Film.«
»Aber das Pferd könnte jetzt natürlich weg sein.«
»Wir sollten wirklich ausmachen.«
»Warum?«
»Ich bin zu müde.«
»Morgen ist Sonntag.«
»Du weißt doch, wie es ausgeht.«
»Wie was ausgeht?«
»Der Film.«
»Sicher weiß ich, wie er ausgeht. Ich weiß auch, dass Anna Karenina von einem Zug überfahren wird.«
»Schau ihn dir an, wenn du willst.«
»Nicht, wenn du es nicht willst.«
»Ich bin zu müde. Sonst bin ich morgen unleidlich. Mach ruhig.«
»Du kannst nicht schlafen, wenn der Fernseher läuft.«
»Ich kann’s versuchen.«
»Nein. Ist schon okay.«
Sie bleiben bei dem Film, bis James Stewart sieht – zu sehen meint -, wie Kim Novak vom Turm fällt. Dann stellen sie ab und schalten das Licht aus.
»Wir sollten ihn irgendwann ausleihen«, sagt Rebecca.
»Das sollten wir. Er ist großartig. Ich habe irgendwie vergessen, wie großartig er ist.«
»Er ist sogar noch besser als Das Fenster zum Hof.«
»Findest du?«
»Ich weiß es nicht, ich habe sie so lange nicht mehr gesehen.«
Beide zögern. Wäre sie auch froh, wenn sie gleich schlafen könnte? Vielleicht. Der eine küsst immer, der andere wird immer geküsst. Danke, Proust. Er merkt, dass sie genauso froh wäre, wenn sie den Sex ausließen.Warum wird sie ihm gegenüber so kühl? Okay, er hat ein paar Pfunde zu viel um die Taille, und ja, sein Arsch ist nicht mehr der strammste. Was ist, wenn sie ihn tatsächlich nicht mehr liebt? Wäre das tragisch oder befreiend? Wie wäre es, wenn sie ihn freigäbe?
Es wäre undenkbar. Mit wem sollte er reden, wie sollte er Lebensmittel einkaufen oder fernsehen?
Heute Nacht wird Peter derjenige sein, der küsst. Sobald sie damit anfangen, wird sie froh sein. Nicht wahr?
Er küsst sie. Sie erwidert den Kuss bereitwillig. Wirkt jedenfalls bereitwillig.
Inzwischen könnte er das Gefühl, sie zu küssen, nicht mehr beschreiben, den Geschmack ihres Mundes – er ist dem Geschmack in seinem eigenen Mund zu nahe. Er berührt ihre Haare, nimmt eine Handvoll und zieht behutsam. In den ersten paar Jahren war er ein bisschen grober mit ihr, bis ihm klar wurde, dass sie es nicht mehr mochte und möglicherweise nie gemocht hatte. Es gibt noch diese verbliebenen Gesten, sanfte Neuinszenierungen von alten, als sie neuer zusammen waren, als sie ständig gevögelt haben, obwohl Peter schon damals wusste, dass sein Verlangen nach ihr Teil eines größeren Bildes war; dass er intensiveren (wenn auch weniger wunderbaren) Sex mit genau drei anderen Frauen hatte: eine, die in seinen Zimmergenossen vernarrt war, eine, die in die Fauvisten vernarrt war, und eine, die schlichtweg lächerlich war. Sex mit Rebecca war von Anfang an etwas Außergewöhnliches, weil es Sex mit Rebecca war, mit ihrem wachen Verstand, ihrer wissenden Zärtlichkeit und, als sie einander besser kennenlernten, den Andeutungen dessen, was er nur als ihr Wesen bezeichnen kann.
Sie streicht mit der Hand leicht an seinem Rückgrat hinab, lässt sie auf seinem Arsch ruhen. Er lässt ihre Haare los, umschließt ihre Schultern mit der Armbeuge, was sie mag, wie er weiß – das Gefühl, kraftvoll festgehalten zu werden (eine seiner Phantasien über ihre Phantasien: er hält sie hoch, das Bett ist verschwunden). Mit der freien Hand, mit ihrer Hilfe, zieht er das T-Shirt hoch. Ihre Brüste sind rund und klein (wann hat er die Sektschale über eine gedrückt, um zu beweisen, dass sie passt – war das in der Sommerhütte in Truro oder in der Pension in Marin?). Ihre Nippel mögen ein bisschen dicker und dunkler geworden sein – sie sind jetzt genauso groß wie die Spitze seines kleinen Fingers und haben die gleiche Farbe wie Radiergummi. Waren sie einst etwas kleiner, ein bisschen rosiger? Wahrscheinlich. Er ist tatsächlich einer von den wenigen Männern, die nicht von jüngeren Frauen träumen, was sie nicht glauben will.
Wir machen uns immer Sorgen über die falschen Sachen, nicht wahr?
Er legt die Lippen an ihren linken Nippel, stupst ihn mit der Zunge an. Sie murmelt etwas. Es wird einzigartig, sein Mund an ihrer Brust und ihre Reaktion darauf, das gehauchte Murmeln, das leichte Verkrampfen ihres Körpers, das er spüren kann, als könne sie nicht ganz glauben, dass das hier, das hier, wieder passiert. Er hat jetzt einen Ständer. Er kann es nicht immer unterscheiden, aber es ist ihm eigentlich auch egal, wann er von sich aus erregt ist und wann er erregt ist, weil sie es ist. Sie umklammert seinen Rücken, sie erreicht seinen Arsch nicht mehr; es gefällt ihm, dass sie seinen Arsch mag. Er umkreist ihren steif werdenden Nippel mit der Zungenspitze, tippt den anderen leicht mit dem Finger an. Heute Nacht wird es hauptsächlich darum gehen, dass sie kommt. Das geschieht oft, seit Jahren schon – es ergibt sich in jeder Nacht (wann haben sie zum letzten Mal irgendwo und irgendwann anders gevögelt als bei Nacht, im Bett?), entscheidet sich für gewöhnlich im Voraus dadurch, wer wen küsst. Das hier ist also für sie. Das ist das Sinnliche dabei.
Sie hat eine Fleischfalte am Bauch, ist etwas füllig um die Hüfte. Okay. Peter, du bist auch nicht gerade ein Pornostar.
Er schiebt seinen Mund an ihrem Bauch hinab, streichelt, ein bisschen fester jetzt, mit dem Finger noch immer ihren Nippel. Sie gibt einen leisen, erstaunten Laut von sich. Sie begreift es, sie beide begreifen es, sie beide wissen es jetzt, das ist das Wunder. Er hört auf, sie mit dem Finger zu streicheln, lässt ihn kreisen. Er beißt in den Gummizug ihres Höschens, schiebt dann die Zunge darunter, leckt nicht hart, aber auch nicht behutsam an ihrem Schamhaar. Sie hebt das Becken an. Ihre Finger fahren durch seine Haare.
Jetzt wird es Zeit, dass sie sich voneinander lösen und ausziehen. Eine der Freuden der Ehe – es muss nicht mehr mühelos gehen. Das langsame Ausziehen ist nicht mehr nötig. Man kann einfach aufhören, ablegen, was abgelegt werden muss, und weitermachen. Er schiebt die Unterhose über seinen Ständer, wirft sie weg. Weil das hier Rebeccas Nacht ist, taucht er sofort wieder hinein, bevor sie dazu kommt, ihre Socken auszuziehen, was sie zum Lachen bringt. Er macht da weiter, wo er war, bezüngelt ihr Schamhaar, umkreist ihren rechten Nippel. Es ist eine Momentaufnahme – mit einem Mal sind sie nackt (bis auf die Socken, alte weiße aus Baumwolle, die an der Sohle leicht vergilbt sind, sie sollte sich neue besorgen). Sie drückt mit den Schenkeln von beiden Seiten an seinen Kopf, als er sich küssend über das V aus Haaren hinabbewegt, und dann ist er da, er weiß es genau, er ist ein Klitorisexperte, und das ist sexy, seine falkengleiche Genauigkeit und ihr ekstatisches Einatmen, weil es einen Moment lang zu viel ist, und dann ihr Loslassen, weil es nie zu viel sein kann. Ihre Schenkel entspannen sich, ruhen fester auf seinen Schultern, und sie wispert oh-oh-oh-oh-oh. Hier ist ihr ureigener Geruch, der leichte Hauch von frischen Shrimps, hier ist das, was er am meisten an ihrem Körper liebt, was ihn am meisten fasziniert, wovor er sich vielleicht auch ein bisschen fürchtet, wahrscheinlich geht es ihr mit seinem Schwanz genauso, obwohl sie nie darüber geredet haben, vielleicht sollten sie es, aber jetzt ist es zu spät, um damit anzufangen, nicht wahr? Er hat sie jetzt, zupft mit Daumen und Zeigefinger an ihrem Nippel, leckt mit der Zunge an ihrer Klitoris, immer wieder, er weiß (er weiß es einfach), dass es auf die Beharrlichkeit ankommt, darauf, dass Zunge und Lippen und Finger nicht aufhören, unter keinen Umständen, dass sie sie finden werden, wo immer sie auch hingeht; genau das ist es (und wer weiß, was sonst noch?), was sie so weit bringt – es hat etwas damit zu tun, dass man sich eingesteht, nirgendwohin zu können, dass es zu spät ist, keinen Sinn hat, sich zu widersetzen, dass es nicht aufhören wird. Sie sagt oh-oh-oh-oh-oh, lauter jetzt, kein Wispern mehr, sie ist auf dem Weg, es klappt immer (täuscht sie es jemals vor? Das will man lieber nicht wissen), auf diese Weise wird er sie heute Nacht kommen lassen, sie sind zu müde, um wirklich zu vögeln, und danach wird sie sich um ihn kümmern, auch sie ist Expertin darin; sie sind beide auf ihrem Weg, sie sind auf dem Weg, und danach können sie schlafen, und dann ist Sonntag.
Sie haben zwei Katzen, die Lucy und Berlin heißen.
Was?
Geträumt. Wo ist das hier? Im Schlafzimmer. Seinem. Rebecca liegt neben ihm und atmet ruhig.
Es ist zehn nach drei. Er weiß, was das bedeutet.
Er schlüpft aus dem Bett, achtet darauf, sie nicht zu wecken. Es ist die fatale Stunde. Er wird bis mindestens fünf wach sein.
Er schiebt die Schlafzimmertür zu, gießt sich in der Küche einen Wodka ein (nein, er kann keinen Unterschied feststellen zwischen dem, den er im Kühlschrank hat, und dem, den Elena unter hohen Kosten von einer Bergwiese im Ural geschmuggelt hat). Er ist ein nackter Mann, der Wodka aus einem Saftglas trinkt, und er wohnt hier. Er geht ins Badezimmer und nimmt eine der blauen Pillen, schlendert dann ins Wohnzimmer, den Teil des Lofts, den sie Wohnzimmer nennen, obwohl alles eigentlich nur ein einziger großer Raum ist, von dem zwei Schlafzimmer und ein Bad abgeteilt wurden.
Es ist eine großartige Wohnung, wie die Leute sagen. Sie haben Glück gehabt, dass sie sie bekommen haben, bevor der Markt verrückt spielte. Wie die Leute sagen.
Er hat einen nächtlichen Ständer, der nicht vergehen will. Sagen Sie mal, Mr. Harris, wie lange hat Ihre Immobilie schon diese Auswirkungen auf Sie?
Die Chris-Lehrecke-Liege, der Eames-Couchtisch, der schmucklos-elegante Schaukelstuhl aus dem neunzehnten Jahrhundert, der Sputnik-inspirierte Kronleuchter aus den fünfziger Jahren, der verhindert (so hoffen sie), dass alles andere zu streng und selbstgefällig wirkt. Die Bücher, die Kerzenhalter, die Teppiche. Die Kunst.
Im Moment zwei Gemälde und ein Foto. Ein wunderschöner Bock Vincent (die Ausstellung hat sich nur zur Hälfte verkauft, was ist mit den Leuten los?), mit Papier und Schnur verpackt. Ein Lahkti, eine zauberhaft gemalte Szene vom Elend in Kalkutta (die haben sich verkauft, wer kann das jemals voraussagen?). Ein Rauchbrandbild von Howard, für nächsten Herbst geplant, Galeriefundus; es ist ganz nützlich, etwas zu haben, das ein bisschen weniger kostet, vor allem heutzutage. All the money’s gone, lord, where’d it go? Welcher Beatles-Song ist das?
Er geht ans Fenster, zieht die Jalousie hoch. Nach drei Uhr morgens ist niemand auf der Mercer Street, nur das fahle orange Licht der Straßenlaternen auf dem Pflaster, sieht aus, als hätte es ein bisschen geregnet. Dieses Fenster bietet, wie viele New Yorker Fenster, keine große Aussicht: ein Stück Mercer Street auf halber Höhe zwischen Spring und Broome Street, die nichtssagende braune Ziegelfassade des Hauses gegenüber (in manchen Nächten brennt dort im dritten Stock Licht; er stellt sich einen ebenso unruhigen Schläfer vor, hofft – und befürchtet -, dass dieser Mensch ans Fenster kommt und ihn sieht), ein Haufen schwarzer Müllsäcke, die auf den Gehsteig geworfen wurden, und zwei Glitzerkleider, eines grün und eines rotbraun, im Schaufenster des stratosphärisch teuren kleinen Ladens, der wahrscheinlich bald schließen wird; für Geschäfte von diesem Niveau ist die Mercer noch immer eine kleine Seitengasse. Wie die meisten Fenster in New York ist Peters ein lebendes Porträt. Tagsüber kann man die Fußgänger auf etwa zehn Metern ihres Lebenswegs sehen. Bei Nacht könnte die Straße ein hochauflösendes Bild ihrer selbst sein. Wenn man sie lange genug betrachtet, kann sie einem vorkommen wie ein Nauman, wie Mapping the Studio – die seltsame Faszination, die sich allmählich entwickelt, während man eine Katze betrachtet, einen Nachtfalter, eine Maus, die durch diese angeblich verlassenen nächtlichen Räume flitzt; das zunehmende Gefühl, dass Räume nie verlassen sind, dass immer etwas da ist, nicht nur heimliches tierisches Leben, sondern auch ihr unbeseeltes Eigenleben, die Papierhaufen und halbleeren Kaffeebecher, die alle zurückbleiben, nicht bewusst, aber auch nicht unbedingt ohne Bewusstsein – heimgesucht, könnte man sagen -, wenn die Menschen plötzlich verschwänden und die Räume genauso blieben wie in dem Augenblick, als alle aufstanden und weggingen. Wenn er stürbe, oder wenn er sich in diesem Moment anzöge, wegginge und nie wieder zurückkäme, würde dieser Raum etwas von ihm behalten, eine Mischung aus Bildnis und Wesen.
Nicht wahr? Eine Zeitlang jedenfalls?
Kein Wunder, dass man in viktorianischer Zeit Kränze aus den Haaren der toten Liebsten flocht.
Was würde ein Fremder denken, wenn er in diesen Raum käme, nachdem Peter weg war? Ein Makler würde denken, er hätte eine kluge Investition getätigt. Ein Künstler, die meisten Künstler, würde denken, er hätte lauter falsche Kunst. Die meisten anderen Menschen würden denken: Was ist das, ein verpacktes und verschnürtes Gemälde, warum machst du es nicht einfach auf?
Schlaflose wissen besser als jeder andere, wie es wäre, ein Haus heimzusuchen.
Halte mich, Dunkelheit.Was ist das? Ein alter Songtext oder ein Gefühl?
Das Problem ist …
Es gibt kein Problem. Wie könnte er, wie könnte irgendjemand aus den 0,00001 Prozent der wohlhabenden Bevölkerung es wagen, Probleme zu haben? Wer sagte zu Joseph McCarthy: »Schämen Sie sich nicht, Sir?« Man muss kein gehässiger rechtsgerichteter Fanatiker sein, um auf diese Frage zu kommen.
Dennoch.
Es ist dein Leben, höchstwahrscheinlich dein einziges. Dennoch ertappst du dich dabei, wie du um drei Uhr morgens einen Wodka trinkst, darauf wartest, dass deine Tablette wirkt, während die Zeit in dir verrinnt und dein eigener Geist bereits durch deine Räume streift.
Das Problem ist …
Er kann etwas spüren, das sich am Rand der Welt regt. Eine unstete Aufmerksamkeit, ein dunkler goldener Nimbus mit lebenden Lichtern, wie Fische im tiefen schwarzen Ozean, eine Kreuzung aus Galaxie, Sultansschatz und einer chaotischen, undurchschaubaren Gottheit. Obwohl er nicht religiös ist, bewundert er diese Ikonen aus der Zeit vor der Renaissance, diese vergoldeten Heiligen und mit Edelsteinen besetzten Reliquiare, ganz zu schweigen von Bellinis milchigen Madonnen und Michelangelos heißen Engeln. In einem anderen Zeitalter hätte er ein hingebungsvoller Diener der Kunst sein können, ein Mönch, dessen Lebenswerk darin bestanden hätte, eine einzige illuminierte Seite anzufertigen, sagen wir mal, die Flucht nach Ägypten, auf der zwei kleine Menschen und ein Kind unter einem lapislazuliblauen Firmament mit leuchtenden goldenen Sternen für alle Ewigkeit mitten im Schritt verharren. Er kann sie manchmal spüren – er kann sie heute Nacht spüren -, diese mittelalterliche Welt der Sünder und des gelegentlichen Heiligen, die unter einer gemalten himmlischen Unendlichkeit auf Reisen gehen. Er ist Kunsthistoriker, vielleicht hätte er … was? … Konservator werden sollen, einer dieser Leute, die in Museumskellern ihr Leben lang den Firnis und die Übermalungen abtupfen und sich (und irgendwann die Welt) daran erinnern, dass die Vergangenheit knallbunt und strahlend war – der Parthenon war vergoldet, Seurat verwendete grelle Farbtöne, aber seine billigen Farben sind zum typischen Dämmerlicht verblasst.
Peter jedoch wollte nicht in Kellern leben. Er wollte ein Geschäftemacher sein (wie manche ihn bezeichnen), ein Bewohner der Gegenwart, obwohl er auch in der Gegenwart nicht recht leben kann; er kann sich nicht davon abhalten, um eine verlorene Welt zu trauern, könnte zwar nicht sagen, um welche Welt genau, aber einen Ort, der nicht dieser ist, nicht mit den am Straßenrand aufgehäuften schwarzen Müllsäcken und den schrillen kleinen Boutiquen, die kommen und gehen. Es ist kitschig, es ist sentimental, er redet mit den Leuten nicht darüber, aber manchmal – jetzt zum Beispiel – hat er das Gefühl, dass dies seine wesentlichste Eigenschaft ist: seine Überzeugung, trotz aller Hinweise auf das Gegenteil, dass bald irgendeine schreckliche, blendende Schönheit niederfährt wie der Zorn Gottes und alles wegsaugt, uns zu Waisen macht, uns entbindet, uns mit der Frage zurücklässt, wie genau wir wieder von vorne anfangen wollen.
Das eherne Zeitalter
Das Schlafzimmer ist von dem grauen Halblicht erfüllt, das typisch für New York ist, ein Strömen, scheinbar ohne Ursprung, eine stete schattenlose Illuminierung, die ebenso gut von der Straße ausgestrahlt werden wie vom Himmel herabfallen könnte. Peter und Rebecca sind mit Kaffee und der Times im Bett.
Sie liegen nicht dicht nebeneinander. Rebecca ist in den Literaturteil vertieft. Hier ist sie, von einem taffen, klugen Mädchen zu einer ausgebufften und ziemlich kaltherzigen Frau herangewachsen, die es leid ist, Peter wegen, nun ja, fast allem zu beruhigen; herangewachsen zu einer strengen, wenn auch liebevollen Kritikerin. Hier ist ihre nüchterne Mädchenhaftigkeit, verwandelt in die weibliche Fähigkeit, in aller Ruhe eisige Urteile zu verkünden.
Peters Blackberry gibt seinen leisen, flötenartigen Ton von sich. Er und Rebecca wechseln einen Blick – wer ruft an einem Sonntagmorgen an?
»Hallo.«
»Peter? Bette hier. Ich hoffe, ich rufe nicht zu früh an.«
»Nein, wir sind auf.«
Er wirft Rebecca einen Blick zu, bildet mit dem Mund ein stummes »Bette«.
»Ist alles okay?«, fragt er.
»Mit mir ist alles okay. Wäre es vielleicht möglich, dass wir uns heute zum Lunch treffen?«
Ein zweiter Blick zu Rebecca. Der Sonntag sollte eigentlich ihr gemeinsamer Tag sein.
»Äh, ja«, sagt er. »Ich glaube schon.«
»Ich kann runterkommen.«
»Okay. Klar.Wann, gegen eins?«
»Gegen eins ist gut.«
»Wohin würdest du gern gehen?«
»Mir fällt nie ein Lokal ein.«
»Mir auch nicht.«
»Kommt es einem nicht immer so vor, als gäbe es ein perfektes, naheliegendes Restaurant, aber es fällt einem einfach nicht ein?«, sagt sie.
»Hinzu kommt, dass es am Sonntag viele Lokale gibt, in die wir nicht reinkommen. Das Prune zum Beispiel. Oder das Little Owl. Ich meine, wir könnten es versuchen.«
»Es ist meine Schuld.Wer ruft denn am Sonntag an und verabredet sich im letzten Moment zum Lunch?«
»Willst du mir sagen, was los ist?«
»Ich sage es dir lieber persönlich.«
»Was ist, wenn ich raufkomme?«
»Darum würde ich dich nie bitten.«
»Ich wollte schon lange den Hirst im Met sehen.«
»Ich auch. Aber wirklich, wie soll ich damit klarkommen, wenn ich dich nicht nur an deinem freien Tag anrufe, sondern dich auch noch nach Uptown zitiere?«
»Ich habe schon mehr für Leute getan, aus denen ich mir weniger mache.«
»Das Payard’s wird voll sein. Ich könnte vermutlich im Jojo einen Tisch kriegen. Es ist nicht so, du weißt schon. Brunchmäßig hier droben.«
»Gut.«
»Hast du etwas gegen das Jojo? Das Essen ist gut, und es gibt wirklich nichts in der Nähe vom Met …«
»Das Jojo ist okay.«
»Du, Peter Harris, bist ein guter Mensch.«
»Wohl wahr.«
»Ich rufe an. Wenn sie um eins keinen Platz für uns haben, rufe ich dich noch mal an.«
»Okay. Großartig.«
Er schaltet aus, wischt mit dem Rand des Betttuchs einen Flecken vom Display seines Blackberry.
»Das war Bette«, sagt er.
Ist es ein Verrat, wenn er sich an einem Sonntag zum Lunch verabredet? Es wäre ganz hilfreich, wenn er wüsste, wie ernst Bettes … Lage ist.
»Hat sie gesagt, worum es geht?«, fragt Rebecca.
»Sie will sich mit mir zum Lunch treffen.«
»Aber sie hat nichts gesagt.«
»Nein.«
Sie beide zögern. Natürlich kann es nichts Gutes sein. Bette ist Mitte sechzig. Ihre Mutter ist, wann, vor etwa zehn Jahren an Brustkrebs gestorben.