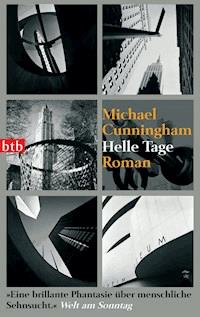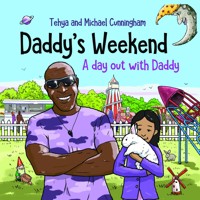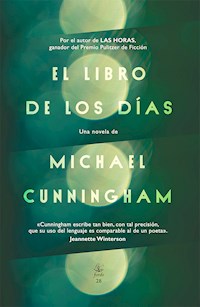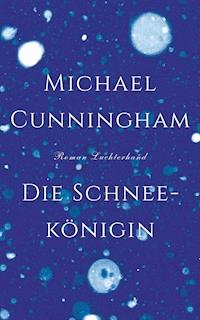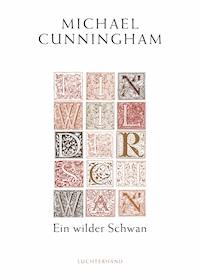18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über Kämpfe und Grenzen des modernen Familienlebens. Vom Autor des Bestsellers »Die Stunden/The Hours«. »Schlichtweg atemberaubend.« Ocean Vuong
5. April 2019: Dan und Isabel leben mit ihren beiden Kindern in Brooklyn. Doch die Fassade des häuslichen Glücks bekommt erste Risse. Während Violet, fünf Jahre alt, die wachsende Kluft zwischen ihren Eltern auszublenden versucht, unternimmt der zehnjährige Nathan seine ersten unsicheren Schritte in Richtung Unabhängigkeit. Und dann ist da noch Robbie, Isabels Bruder, der aus dem Dachgeschoss ausziehen soll. Und dessen Weggang die Familie auseinanderzureißen droht.
5. April 2020: Als die Welt im Lockdown ist, fühlt sich das Haus in Brooklyn eher wie ein Gefängnis an. Isabel und Dan umkreisen sich misstrauisch. Robbie ist derweil auf Island gestrandet, allein in einer Holzhütte, mit nichts als seinen Gedanken - und seinem geheimen Instagram-Leben - als Gesellschaft.
5. April 2021: Die Familie hat das Schlimmste der Krise überstanden und kommt zusammen, um sich mit einer neuen, ganz anderen Realität auseinanderzusetzen - mit dem, was sie gelernt und was sie verloren haben. Und wie es weitergehen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch
5. April 2019: Dan und Isabel leben mit ihren beiden Kindern in Brooklyn. Doch die Fassade des häuslichen Glücks bekommt erste Risse. Während Violet, fünf Jahre alt, die wachsende Kluft zwischen ihren Eltern auszublenden versucht, unternimmt der zehnjährige Nathan seine ersten unsicheren Schritte in Richtung Unabhängigkeit. Und dann ist da noch Robbie, Isabels Bruder, der aus dem Dachgeschoss ausziehen soll. Und dessen Weggang die Familie auseinanderzureißen droht.
5. April 2020: Als die Welt im Lockdown ist, fühlt sich das Haus in Brooklyn eher wie ein Gefängnis an. Isabel und Dan umkreisen sich misstrauisch. Robbie ist derweil auf Island gestrandet, allein in einer Holzhütte, mit nichts als seinen Gedanken – und seinem geheimen Instagram-Leben – als Gesellschaft.
5. April 2021: Die Familie hat das Schlimmste der Krise überstanden und kommt zusammen, um sich mit einer neuen, ganz anderen Realität auseinanderzusetzen – mit dem, was sie gelernt und was sie verloren haben. Und wie es weitergehen könnte.
»Michael Cunningham besitzt die große Gabe, einprägsame Charaktere zu schaffen, die Welt in all ihrer Seltsamkeit und Schönheit wahrzunehmen und über Liebe und Verlust in einem Ton zu schreiben, der sowohl schonungslos als auch zärtlich ist.« Colm Tóibín
Zum Autor
Michael Cunningham wurde 1952 in Cincinnati, Ohio, geboren und wuchs in Pasadena, Kalifornien, auf. Er lebt in New York City, lehrt an der Yale University und hat mehrere Romane und Erzählungen veröffentlicht. Sein Roman Die Stunden wurde vielfach preisgekrönt, u. a. mit dem Pulitzerpreis und dem PEN/Faulkner Award, und wurde in 22 Sprachen übersetzt. Die überaus erfolgreiche Verfilmung The Hours mit Meryl Streep, Julianne Moore und Nicole Kidman wurde mit einem Oscar ausgezeichnet.
Zur Übersetzerin
Eva Bonné übersetzt Literatur aus dem Englischen, u. a. von Rachel Cusk, Anne Enright, Claire-Louise Bennett und Abdulrazak Gurnah. Sie wurde mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis ausgezeichnet.
Michael Cunningham
Ein Tag im April
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Eva Bonné
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Day« bei Random House, einem Imprint von Penguin Random House LLC, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Michael Cunningham
Copyright © der deutschen Ausgabe 2025 Luchterhand Literaturverlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: buxdesign | Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von Bridgeman Images
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-31300-5V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Dieses Buch ist für Frances Coady.
Aus der Vergangenheit löst sich mein Schatten
Und kommt mir stumm entgegen.
Anna Achmatowa
5. April 2019
Vormittag
So früh am Morgen hängt über dem East River ein dünner, durchsichtiger Schleier. Als helle, stahlschimmernde Schicht bedeckt er den Fluss, während das Nachtschwarz des Wassers sich ins blickdichte Dunkelgrün eines neuen Tages verwandelt. Am Himmel darüber verblassen die Lichter der Brooklyn Bridge. Ein Schuhmacher schiebt den Metallrollladen seiner Werkstatt hoch. Eine junge Frau mit Pferdeschwanz joggt an einem Mann mittleren Alters vorbei; er trägt ein kurzes schwarzes Kleid und Springerstiefel und ist endlich auf dem Heimweg. In ein paar Wohnungen brennt schon Licht, so hell wie der Sichelmond.
Isabel steht nach einer schlaflosen Nacht am Fenster, das XXL-T-Shirt reicht ihr bis an die Oberschenkel. Die junge Frau mit Pferdeschwanz joggt genau in der Sekunde an dem Mann im Kleid vorbei, als er den Haustürschlüssel ins Schloss schiebt. Der Schuhmacher hat das Metallgitter in die Höhe geschoben. Warum öffnet er seinen Laden so früh, welcher Mensch bringt um fünf Uhr morgens seine Schuhe zur Reparatur?
Überall zeigen sich erste zaghafte Vorboten des Frühlings. Der Baum vor Isabels Haus (ein Silberahorn, laut Google ein »starkwachsender Flachwurzler«) hat feste, kleine Knospen gebildet, aus denen sich bald Blätter schieben werden, fünfzackig und nur so lange unscheinbar, bis der Wind hineinfährt und die silbrige Unterseite nach oben kehrt. In einem der Fenster gegenüber stehen Narzissen in einem Wasserglas. Das fahle, seit Monaten statische Winterlicht kommt in Bewegung, als hätte jemand die Luftmoleküle umgerührt.
Der Aprilanfang in Brooklyn mag laut Kalender ins Frühjahr fallen, aber der echte Frühling – dieser Hauch von Grün, das Erwachen der Stämme und Sprossen – ist noch Wochen entfernt. Die Knospen an den Bäumen sind stramme kleine Knoten, die des Aufplatzens harren. Die Narzissen im Fenster gegenüber bedeuten lediglich, dass der Laden an der Ecke Narzissen verkauft, die wieder einmal von woher auch immer herangekarrt wurden.
Isabel wendet sich vom Fenster ab und betrachtet Dan. Er schläft tief und fest und atmet schwer. Für einen Vierzigjährigen sieht er einem Kind im Schlaf erstaunlich ähnlich. Sein erschlaffter Mund ist leicht geöffnet, das weißblonde Haar ein heller Fleck im dunklen Zimmer.
Wie es sich wohl anfühlt, so schlafen zu können? Isabel beneidet Dan um sein Talent, gleichzeitig ist sie dankbar. Denn in den Stunden, in denen Dan und die Kinder im Bett liegen, hat sie, die immer nur kurz zur Ruhe kommt und viel träumt, das Gefühl, die Wohnung endlich für sich zu haben. Dann ist sie ganz in den Wachtraum des nächtlichen Alleinseins vertieft, und nur die grünen LED-Ziffern der Küchenuhr messen die Zeit.
Als Isabel sich wieder zum Fenster umdreht, entdeckt sie die Eule. Zunächst erscheint das Tier wie eine Verlängerung des Asts, auf dem es sitzt. Sein Gefieder ist perfekt an das stumpfe, fleckige Graubraun der Rinde angepasst. Isabel hätte die Eule fast übersehen, wären da nicht die Augen, zwei schwarz-goldene Kreise in der Größe von Zehncentmünzen, die einen nichtmenschlichen Blick auf sie richten. Anscheinend hat der Baum beschlossen, Isabel genau in diesem Moment darüber zu informieren, dass dort draußen eine Wächterin sitzt. Die Eule ist klein wie ein Gartenhandschuh. Als Isabel den Blick erwidern will, merkt sie, dass der Vogel lediglich in ihre Richtung schaut. Die Eule beobachtet nicht Isabel, sondern das Zimmer dahinter – den Nachttisch mit der ausgeschalteten Lampe und der Atlantic-Ausgabe vom letzten Monat; an der Wand darüber gerahmte Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen die Kinder so verstörend unschuldig aussehen wie gezähmte Versionen ihrer selbst. Die Eule richtet ihren starren Vogelblick auf alles, was sich hinter der Fensterscheibe befindet. Sie unterscheidet nicht zwischen Isabel, der Lampe und den Fotos, genauso wenig scheint sie zu verstehen, dass Isabel lebendig ist und die Gegenstände unbelebt. Die Frau und die Eule rühren sich nicht. Ganz kurz kreuzen sich ihre Blicke, und dann fliegt die Eule so mühelos davon, als bräuchte es dazu keine Flügelschläge, sondern nur den Wunsch zu fliegen. Sie steigt in einem Bogen auf und ist weg. Ihr Verschwinden hat etwas von einer Abdankung, als wäre ihre Anwesenheit auf dem Baum ein Irrtum gewesen, ein versehentlicher Riss im Stoff des Möglichen, der nun schnell und spurlos geflickt wurde. Der Vogel erscheint Isabel jetzt schon wie ein verblassender Traum, was verständlich wäre, schließlich konnte sie die ganze Nacht nicht schlafen (normalerweise schafft sie ein paar Stunden). Die Probleme des neuen Tages türmen sich vor ihr auf (Robbie hat immer noch keine Wohnung gefunden, Derrick wird weiterhin auf einem zusätzlichen Shooting bestehen). Bald wird sie gezwungen sein, sich alldem zu stellen und als möglichst überzeugende Verkörperung ihrer selbst aufzutreten, als eine Person, die alles schafft, was von ihr verlangt wird.
Die Eule ist verschwunden. Die Joggerin ist vorbeigejoggt. Der Mann im Kleid hat das Haus betreten. Bleibt nur noch der Schuhmacher, der inzwischen die Neonröhren an der Ladendecke eingeschaltet hat. Das Licht dringt nicht nach draußen auf den Gehweg. Isabel weiß nicht, ob der Schuhmacher, mit dem sie noch nie gesprochen hat (sie lässt ihre Schuhe in Midtown reparieren), den Laden so früh aufschließt, weil er vor einem häuslichen Dauerstreit flieht, oder ob er es einfach nicht erwarten konnte, die kleine Box zu betreten und erst das blaue Neonschild mit dem Schriftzug Schuhklinik einzuschalten (Isabel sollte sich wirklich angewöhnen, ihre Schuhe bei ihm abzugeben, und sei es nur, weil er eine Schuhklinik betreibt) und dann die einen Meter große, verblichene Tierpuppe – ein Fuchs? Ein Waschbär? –, die im Schaufenster auf einem Schusterbänkchen sitzt und einen winzigen Hammer schwingt, dessen Schlag nun, da der Ladeninhaber auf den Schalter gedrückt hat, da das Schuhklinik-Schild in einem gespenstischen Neonblau leuchtet und das Tier seine Arbeit wiederaufgenommen hat, zu einer Ankündigung wird: Er hat begonnen, der Tag.
Gäbe es Wolfe wirklich, wäre er die schwer zu fassende Figur im Zentrum der Geschichte. Der lebhafte, gesellige Typ, den du auf der Party knapp verpasst hast, der sportliche Fremde, den du aus den Augenwinkeln aus dem B Train steigen siehst, der Prinz, dessen Kuss alles in Ordnung bringen würde, könnte er dich, wenn du im tiefen Wald komatös im gläsernen Sarg liegst, nur finden.
Wolfes 3407 Follower haben ein mehr oder weniger einheitliches Bild von ihm. Er ist einer dieser Menschen, die offenbar nicht bloß immer bekommen, was sie wollen, sondern auch das wollen, was sie bekommen. Wolfes Follower versehen die Chronik seines Alltags mit vielen Likes. Sie mögen sein schwarz gestoppeltes, apartes Gesicht. Er sieht wahnsinnig gut aus und ist gleichzeitig nahbar, ein ganz normaler Typ, nur eben ein bisschen auffälliger. Ein ziemlich attraktiver Mann, der seine Vorhaben durchzieht, der dranbleibt und ein Auge hat für deine … für deine Einzigartigkeit, die andere immer nur kurzzeitig interessant finden oder komplett übersehen.
Wolfe ist von deiner hinreißenden Persönlichkeit fasziniert. Er ist um die dreißig. Er will sich binden. Er hat es nicht nötig, der hübscheste Kerl im Raum zu sein, kann aber wenig dagegen tun, dass er oft der anziehendste ist. Er strahlt und ist doch frei von jeder Eitelkeit. Der Kerl sieht scharf aus – er stemmt fast hundert Kilo, und wenn er aus der Dusche tritt, bemerkt er die Wassertropfen in seinen Locken genauso wenig wie seine Brust- und Bauchmuskeln, die andere in der Umkleide sehr wohl bemerken. Er pflegt auch keine vorauseilende Reue, nur weil er später vielleicht einmal kurzsichtig und ein bisschen übergewichtig sein wird; er ist ein netter Arzt, der sich pflichtbewusst um die Kranken kümmert und währenddessen an den nächsten gemeinsamen Abend mit dir denkt, an dich, denn du bist alles, was er will und was er braucht.
Seine Follower liken seinen Beruf. Er macht seinen Facharzt in Kinderheilkunde und hat noch ein Jahr an einer städtischen Klinik vor sich. Sie liken sein Apartment in Brooklyn, das er sich mit seiner Mitbewohnerin Lyla teilt und neuerdings auch mit Arlette, einem aus dem Tierheim geretteten Mischling, halb Beagle und halb was auch immer. Sie liken die nie offen ausgesprochene Tatsache, dass er schon ein paar feste Partner hatte, diese Beziehungen aber allesamt gescheitert sind und er nur darauf wartet, sich neu zu verlieben. Doch er hat es nicht eilig. Trotz der vielen Bettgeschichten, die er hinter sich hat, wirkt er auf eine fröhliche Weise keusch. Unmöglich zu sagen, wie viele seiner Follower in Wolfe verliebt oder davon überzeugt sind, sie würden sich, hätten sie nur die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen, als derjenige erweisen, auf den er so geduldig wartet.
Die Frage ist zu groß für diese Uhrzeit. Robbie muss noch ein gutes Dutzend Aufsätze benoten, sechste Klasse Geschichte. Das Thema lautete, wie die indigene Bevölkerung Christoph Kolumbus’ Ankunft wohl erlebt hat.
Während er über Wolfes ersten Post des Tages nachdenkt, kocht Robbie Kaffee, schluckt eine Paroxetin und eine Adderall und bleibt dann leicht orientierungslos unter der von irgendeinem früheren Mieter unfachmännisch eingebauten Küchendachluke stehen. Von oben leuchtet der graue, aufklarende Himmel herein. Die Luke macht die Wohnung tatsächlich heller, hat aber ein Leck, das sich nicht abdichten lässt. In diesem Moment hängt an der linken unteren Ecke des Fensterrahmens ein zitternder Tropfen, so licht wie der Himmel selbst, Tau vielleicht oder Kondenswasser, wer weiß. Es hat seit Wochen nicht geregnet.
Das Wasser scheint aus allen Richtungen in die Wohnung einzudringen. Der Hahn im Bad tropft unaufhörlich, und schon beim leichtesten Niederschlag sammelt sich unter den Glasschiebetüren, die auf eine Feuerleiter hinausgehen und vermutlich das Werk desselben wohlmeinenden, aber unfähigen Vormieters sind, eine dunkle Pfütze. Wenn Robbie etwas für morbiden Romantizismus übrig hätte, würde er das stete Triefen als den sich ergießenden Kummer früherer Dachgeschossbewohnerinnen deuten, junger Irinnen, die auf der Flucht vor der Hungersnot nach Amerika kamen und sich um eine Anstellung als Hausmädchen balgen mussten, Mädchen, die in Dublin vermutlich sehr begehrt waren und von denen alle Leute sagten: In ein paar Jahren kann sie sich einen aussuchen; aber hier in Brooklyn durften sie für zwei feuchte Dachkammern in einem Brownstone-Stadthaus dankbar sein.
Doch anders als die längst verstorbenen irischen Mädchen steht Robbie in einer langen Tradition von Leuten, die diese engen, dunklen Zimmer für einen Glücksfall hielten. Welcher seiner Vorgänger war der Optimist, der bei dem Versuch, mehr Licht hereinzulassen, den Regen und den Schneematsch des Brooklyner Winters ignorierte? Welcher davon (es muss mehr als einer gewesen sein) hat die Wände in einem trüben Orangebraun gestrichen, das später zwar weiß übermalt wurde, aber hinter der Spülenschranktür überdauerte wie ein trauriger Fluch? War der malende Vormieter vor oder nach jenem eingezogen, der das undichte Oberlicht in die Küchendecke einbaute?
Jetzt steht Robbie darunter, ein Lehrer mit einem Jahresgehalt von sechzigtausend Dollar, und das in New York, wo man keine Bleibe für unter dreitausend im Monat findet, Minimum, New York, wo man mit viel Glück eine Schwester hat, die den oberen Teil selbigen Brownstone-Stadthauses kauft und einem die Dachkammer zu einem Preis überlässt, der noch unter der Hypothekenrate liegt.
Man kann sich glücklich schätzen, bis das Glück irgendwann endet und die Schwester die Dachwohnung für sich braucht.
Und dann ist man plötzlich seines Glückes Schmied.
Das Adderall beginnt zu wirken, ein wahrer Segen, denn am Vorabend hat Robbie, statt zu arbeiten, fünf Folgen Fleabag geschaut, und nun stapeln sich die restlichen Aufsätze auf dem Küchentisch.
Er konnte das Korrigieren so lange aufschieben, weil die Schule heute ein paar Stunden später anfängt. Das Gebäude wird auf Asbest untersucht. Nach allgemeinem Dafürhalten wurde der letzte Asbest vor über zwanzig Jahren entfernt, doch neulich ist jemandem aufgefallen, dass in den Akten Hinweise auf eine derartige Sanierung fehlen, wie überhaupt alle Unterlagen aus dem Jahr 1998. Jetzt muss ein Team aus Experten – in Robbies Vorstellung tragen sie Schutzanzüge – in die Schule kommen, Löcher in die Wände bohren und nach Asbest suchen, den es dort wahrscheinlich nicht gibt, es sei denn, die Wände wurden nicht überprüft und die »Sanierung« in Wahrheit nie durchgeführt. Vielleicht haben alle immer bloß geglaubt, das Problem wäre gelöst.
Robbie nimmt einen Aufsatz vom Stapel und verdrängt nach Kräften die Vorstellung, er und seine Klasse könnten jeden Montag bis Freitag unsichtbare schwarze Angelhaken eingeatmet haben.
Er hält den Aufsatz von Sonia Thomas in der Hand. Sonia ist ein nachdenkliches, rothaariges Mädchen, das angeblich im Alter von sieben Jahren aus Rumänien adoptiert wurde. Die offenbar erfundene Geschichte dient der Erklärung einer Herkunft, nach der niemand sie je gefragt hat.
Sonias erster Satz: »Wir dachten, der Mann in dem großen Schiff bringt uns Magie.«
Robbie lässt den Aufsatz sinken. Er ist noch nicht bereit. Er spielt mit dem Gedanken, einen Tortillachip zu essen. Er staunt über etwas, das er, wie fast jeder Mensch, längst weiß: Da besteht ein kompliziertes Gewebe aus kaum erkennbaren Zusammenhängen, ein unterschwelliges Netzwerk, das jene Schiffe am Horizont mit Sklavenauktionen verbindet, mit Lewis’ und Clarks erstem Blick auf den Missouri, mit dem Krieg, der alle Kriege beendet, der Weltausstellung in Chicago, der Großen Depression und dem New Deal, mit einem weiteren Krieg, mit den uns vor langer Zeit versprochenen Raketengürteln und mit Amokläufen an scheinbar ungefährlichen Orten (Schulen, Kinos, Kleinstadtparks, die Liste ließe sich beliebig fortführen). Und gleichzeitig kommen Menschen um bei dem Versuch, eine Grenze zu überwinden und in ein Land zu gelangen, wo sie sich vielleicht als Hausangestellte oder Gärtner verdingen können; in unvorstellbar weiter Ferne tauchen ständig neue bewohnbare Planeten auf, während er, Robbie, sich Sorgen macht, weil er demnächst aus der Wohnung ausziehen muss, in der die längst verstorbenen Irinnen einst festsaßen wie in einem Gefängnis.
Er hofft, dass weder seine noch Sonias Lunge mit mikroskopisch kleinen, krebserregenden Widerhaken gespickt ist. Er fragt sich, ob er und Oliver es noch einmal versuchen sollten. Er fragt sich auch, ob er sein Schicksal selbst besiegelt hat, indem er sich von einer finanzschwachen öffentlichen Schule anstellen ließ, deren Räumlichkeiten höchstwahrscheinlich nie auf Asbest untersucht wurden. Ob es am Ende ein großer Fehler war, das Medizinstudium nicht angetreten zu haben. Er fragt sich, ob vielleicht nicht doch eine der bereits besichtigten Wohnungen infrage käme. Was ist mit dem Einzimmerapartment in Bushwick, das zwar hohe Decken hatte, aber leider nur ein einziges, bullaugenförmiges Fenster? Hat er das (in der Annonce so genannte) »Miniloft«, dessen Bad anteilig zum benachbarten Miniloft gehört, etwa vorschnell abgesagt?
Vielleicht sollte Wolfe zu einem Abenteuer aufbrechen, mal eine Weile rauskommen, einen Roadtrip wagen. Schließlich lebt er an der Ostküste eines riesigen Kontinents, wo Farmhäuser in wogenden Maisfeldern schwimmen, des Kontinents der Berge, Wälder und durchgängig geöffneten Diner, wo dir jemand Kaffee nachschenkt und dich dabei »Honey« nennt. Bestimmt wünschen seine Follower ihm all das. Sicher wollen sie sehen, dass er da draußen und in Bewegung ist. Vielleicht kreuzen sich eure Wege. Vielleicht bist du derjenige, auf den er die ganze Zeit gewartet hat.
Denn wer hofft nicht, dass am Horizont ein Magier auftaucht?
Als Robbie von seiner Wohnung zu Isabel und Dan hinuntergeht, sieht er Isabel im Hausflur auf der Treppe sitzen. Sie hält die angezogenen Knie mit beiden Armen umschlungen, wie um sich möglichst kleinzumachen.
»Guten Morgen«, sagt Robbie. Von oben betrachtet wirkt vor allem ihr Scheitel sehr markant. Isabels Haar ist vom Schlaf zerdrückt, hier und da schimmern weiße Zickzacklinien aus Kopfhaut durch.
Robbie und Isabel sehen sich nicht besonders ähnlich. Isabel hat die hellgrauen Augen und die buschigen Brauen ihrer Mutter geerbt, dazu eine knochig spitze Nase, die einen beeindruckenden Widerspruch zu ihrem (von keinem Elternteil geerbten) Schlägerkinn bildet. Sie hat schon früh im Leben gelernt, dass sie den Mangel an so genannter Schönheit durch Entschlossenheit ausgleichen muss: Ich werde begehrt sein, ich werde einen Freund haben, ich werde es in der Highschool bis zur Klassensprecherin bringen. Seit Robbie denken kann, pocht sie auf ihre Einzigartigkeit, allein indem sie so unverblümt wie sie selbst aussieht.
In Robbies Gesicht werden die greifvogelartigen Züge der Mutter – ein Falke in Frauengestalt, stets wachsam, hart im Verhandeln – durch das anglo-irische Ebenmaß des Vaters ausgeglichen: unauffällige Kinn- und Nasenpartie, Augen in der Farbe von Milchschokolade, harmlose Leutseligkeit.
In der Schule hat Isabel die Dummheit der anderen, der Sportler und der Ballköniginnen, zerlegt wie mit einer scharfen Klinge. Robbie war da schon weniger robust, er war immer der mit dem empfindsamen Gemüt. Seine erste Brille bekam er mit fünf (dass er mit zwanzig ein Jahr lang hellblaue Kontaktlinsen trug, möchte er lieber vergessen). Robbie war nachdenklich und introvertiert (danke, Mom, dass du ihn »grüblerisch« genannt hast, wie Heathcliff, selbst wenn du damit andeuten wolltest, dass Robbie eben kein Heathcliff war und sich einfach bloß mehr Mühe geben sollte). Robbie war wie gelähmt von den Kränkungen, die andere ihm in unverhohlener Absicht zufügten, schlimmer noch, er nahm auch jene Kränkungen wahr, die er nicht hören, sich aber denken konnte. Er sehnte sich verzweifelt nach Liebe, eine, wie er im Nachhinein einsehen muss, sehr effektive Strategie, um sicherzustellen, dass ihm fast alle Menschen ihre Liebe vorenthielten, alle außer seine engsten Verwandten.
»Guten Morgen«, sagt Isabel.
»Ja, da ist er. Der Morgen.«
»Wie läuft es mit den Aufsätzen über Kolumbus?«
»Sechs halten ihn für einen bösen Eindringling, und drei glauben, er hätte Amerika erfunden, angeblich eine hervorragende Idee. Ein Kind dachte, die Aufgabenstellung bezieht sich auf Kolumbus’ Kleidung.«
»Und, was hat er getragen?«
»Eine Art Robe, und auf dem Kopf eine Tiara.«
»Hübsch.«
»Ja. Und doch …«
»Und doch.«
»In letzter Zeit frage ich mich immer öfter, wie lange ich das noch aushalte. Ich bin so kaputt. Du hast ja keine Ahnung, wie es ist, jeden Tag in einem Raum mit denen zu sein.«
»Doch, habe ich.«
»Ja, natürlich. Aber allein die letzten beiden Wochen …«
»Ich muss dich was fragen. Bist du so kaputt, weil du ausziehen sollst?«
»Ich bitte dich ein letztes Mal, deswegen kein schlechtes Gewissen zu haben.«
»Bereust du das mit dem Medizinstudium?«, fragt Isabel.
»Nein, ich bereue das mit dem Medizinstudium kein bisschen. Aber ehrlich gesagt scheint sich das gesamte Kollegium zu wünschen, es hätte sich für was anderes entschieden. Alle außer Myrna.«
»Die streng genommen keine Lehrerin ist. Eigentlich ist sie gar nichts.«
»Sie könnte sich wenigstens mal eine neue Perücke anschaffen.«
»In letzter Zeit muss ich oft an Dad denken. Egal, was Dr. Meer sagt.«
»Ja, ja. Dr. Meer …«
»Hat Dad dir erzählt, dass Dr. Meer ihm eine Reise nach Lourdes vorgeschlagen hat? So nach dem Motto: Man kann es ja mal mit Wunderheilung versuchen.«
»Was wahrscheinlich genauso hilfreich wäre wie Dr. Meer. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Zeitschriften in seinem Wartezimmer mindestens ein Jahr alt sind? Und hast du die Schale mit den Bonbons gesehen? Die sind noch von Halloween.«
»Das ist kein Witz«, sagt Isabel. »Könntest du es vielleicht ernst nehmen?«
»Meinst du, ich nehme es nicht ernst?«
»Doch. Ich weiß. Steht da wirklich eine Schale mit Halloweensüßigkeiten? Wahrscheinlich habe ich mich einfach geweigert, sie zur Kenntnis zu nehmen.«
»Hör mal …«
»Ich höre. Ich höre immer.«
»Ich habe nicht deswegen nicht Medizin studiert, weil Dad es sich gewünscht hätte«, sagt er. »Ich wäre jetzt nicht der bessere Arzt für ihn. Hatten wir uns auf diese Tatsache nicht schon vor langer Zeit geeinigt?«
»Du weißt, was ich von Tatsachen halte.«
»Vielleicht ist eine Reise nach Lourdes gar keine schlechte Idee. Dann käme er wenigstens mal raus.«
»Heute Morgen habe ich eine Eule gesehen«, sagt Isabel. »In dem Baum.«
»In dem mickrigen Baum vor dem Haus?«
»Hm-hmm.«
»Unmöglich.«
»Im Central Park gibt es Eulen.«
»Ja. Im Central Park.«
»Na gut. Dann habe ich eben nur geträumt, ich hätte heute Morgen eine Eule gesehen. Hast du schon was für Wolfe gepostet?«
In gewisser Hinsicht ist Wolfe die erwachsene Version des großen Bruders, den die beiden sich als Kinder ausgedacht haben. Er war derjenige, der sie verteidigt und sich vor nichts und niemandem gefürchtet hat. Außerdem konnte er mit Tieren reden.
Isabel und Robbie tauften ihren ausgedachten Bruder Wolfe. Robbie hat nie zugegeben, dass er bis zu seinem sechsten Geburtstag glaubte, er hieße Wuff.
»Noch nicht«, sagt er. »Ich habe mit Christoph Kolumbus alle Hände voll zu tun.«
»Das mit der Tiara gefällt mir.«
Robbie setzt sich neben sie, auf die dritte Stufe von unten. Er nimmt ihren morgendlich-ungeduschten Geruch wahr, leichte Melonenfrische mit einem Hauch welker Blumen. Sie sind mit dem Duft des jeweils anderen aufgewachsen, aber so früh am Tag und so ungewaschen hat Robbie seine Schwester schon lange nicht mehr erlebt. Er kann nicht anders und nimmt einen tiefen Zug.
Dann sagt er: »Heute sehe ich mir eine Wohnung in Washington Heights an. Angeblich mit Flussblick.«
»Das wäre schön. Besser als mit Blick auf einen mickrigen Baum und eine Schuhklinik.«
»Ich hätte mich schon viel früher darum kümmern sollen.«
»Gestern Abend hat Violet mich gefragt, wozu Nathans Penis da ist.«
»Was hast du geantwortet?«
»Dass Jungen anders sind.«
»War die Sache damit geklärt?«
»Nein. Sie wollte den genauen Zweck wissen.«
»Ich bin stolz auf sie. Erst fünf und schon bereit für die Tatsachen.«
»Sagen wir es mal so … es hat mich daran erinnert, dass die beiden für ein gemeinsames Kinderzimmer viel zu alt sind. Ich verstehe nicht, wie Dan und ich das so lange ignorieren konnten. Wir sind beschissene Eltern.«
»Nein. Ihr seid Eltern mit einer Dreizimmerwohnung.«
»Ich muss ständig an das Haus auf dem Land denken, das wir immer kaufen wollten«, sagt sie.
»Wir waren Kinder.«
»Mit einem Dutzend Zimmern, einem Gemüsegarten und drei oder vier Hunden.«
»Es war Ms. Manley Idee«, sagt er. »Du hast sie von ihr, und ich habe sie von dir.«
»Sie war meine beste Lehrerin. Alle Fünftklässler sollten eine Ms. Manley haben.«
»Eine Hippielehrerin mit einem ziemlich verklärten Blick auf die Realität.«
»Aber manche Leute ziehen tatsächlich aufs Land. Es gibt da alle möglichen Häuser, und wie ich gehört habe, sind sie sogar bezahlbar.«
»Ja, und der nächste Schwule wohnt auch nur fünfzig Kilometer entfernt.«
»Das mit Oliver tut mir leid.«
»Oliver wäre niemals mit aufs Land gezogen.«
»Warum schenken wir Wolfe nicht ein Haus in Upstate New York?«, fragt Isabel.
»Keine Ahnung. Wünschen wir ihm das wirklich?«
»Warum nicht? Er arbeitet so viel.«
»Aber die Kinder in der Klinik brauchen ihn.«
Isabel boxt Robbie spielerisch in den Oberarm, wie früher, als sie … er kann sich an keine Zeit erinnern, in der sie ihn nicht geboxt hätte. Die Geste ist und war schon immer kameradschaftlich gemeint, aber sie findet (und fand) unter so viel Kraftaufwendung statt, dass er einen kurzen Schmerz spürt und sich daran erinnert, dass jeder Kameradschaft eine gewisse Wut innewohnt.
»Ich kann nicht glauben, dass du ihn auf kranke Kinder loslässt«, sagt Isabel.
»Er reibt es den Leuten ja nicht unter die Nase. Er erwähnt seinen Beruf fast nie.«
»Aus dir wäre ein guter Arzt geworden.«
»Hey«, sagt er, »ich bin kein schlechter Lehrer. Dass ich heute Morgen nicht gut drauf bin, schiebe ich auf Christoph Kolumbus.«
»Du wolltest nie Medizin studieren. Du bist eigentlich nur Lehrer geworden, um Dad zu ärgern.«
»Aber die einfachere Geschichte kommt immer am besten an, oder?«
»Glaubst du, Wolfe versteht sich gut mit seinem Vater?«, fragt sie.
»Wolfe besteht nur aus ein paar Posts auf Instagram. Wir improvisieren ihn. Er ist kein echter Mensch. Er ist ja kaum eine echte Vorstellung von einem Menschen.«
»Bin ich wieder zu rechthaberisch?«
»Ein bisschen.«
»Weißt du noch, wie ich deine Geburtstagstorte gegessen habe?«
»Du warst vier. Ich war zwei. Ich kann mich an nichts erinnern.«
»Mom hat die Geschichte hundertmal erzählt. Es war das offizielle Familienurteil über dich und mich, wie wir als Kinder waren.«
»Warum denkst du ausgerechnet jetzt daran?«
»Weil ich anscheinend jemand bin, der die Geburtstagstorten anderer Leute isst. Ich setze meinen Bruder vor die Tür. Bei der Arbeit wird alles immer blöder, und ich mache einfach mit.«
»Wie blöd ist es denn?«
»Heute muss ich Derrick davon abhalten, das Shooting in Astoria zu wiederholen. Wir haben kein Budget mehr. Außerdem kursieren wegen der Story über die queeren Familien Gerüchte. Die sich aber erst noch bewahrheiten müssen.«
»Soll ich reingehen und nach Dan und den Kindern sehen?«
»Würdest du das wirklich tun? Gegen ein paar Minuten allein hätte ich nichts einzuwenden. Auf der Treppe zu sitzen, hat irgendwie was von ›weder hier noch dort‹.«
»Alles wird gut.«
»Ja. Auf jeden Fall. Alles wird gut.«
Als die Wohnung von Isabel und Dan zur Hälfte eingerichtet war, kamen die Kinder zur Welt und machten sich daran, alles auseinanderzunehmen. Vor Nathans Geburt – eigentlich hatten sie mit der Familienplanung noch ein Jahr warten wollen – hatten Isabel und Dan genug Zeit und Geld, um die Wände in einem schillernden Grau zu streichen, den Hochglanz des Eichenparketts in einen matten, fast schwarzen Ebenholzton zu verwandeln sowie einen italienischen Sessel und dekorativ verwitterte Bücherregale aus dem neunzehnten Jahrhundert zu kaufen, die auf verschlungenen Wegen über Buenos Aires nach Brooklyn gelangt waren. Nathans Geburt hatte die Renovierungsarbeiten jäh gestoppt. Kurz vor seinem fünften Geburtstag, als sein Zerstörungstrieb endlich beherrschbar schien und Isabel und Dan angefangen hatten, sich nach neuen Sofas und Leuchten umzusehen, wurde Violet gezeugt und verzögerte alle wertigen Neuanschaffungen um weitere Jahre.
Und so leben Isabel, Dan und die Kinder bis heute in einer zu kleinen Wohnung, die eigentlich nur eine Übergangslösung sein sollte, ein Zwischenstopp auf dem Weg ins eigentliche Eigenheim. Unterdessen sind die Immobilienpreise durch die Decke gegangen, und Dans und Isabels Plan, das Erdgeschoss dazuzukaufen, wurde vom unfassbar langen Leben der uralten Zwillinge, die seit dem Zweiten Weltkrieg dort unten wohnten, erst aufgeschoben und dann endgültig zunichtegemacht, weil die Zwillinge in ein Altersheim umzogen und das Erdgeschoss prompt an einen Mann verkauft wurde, der eine Aktentasche mit eineinhalb Millionen Dollar in bar unterm Arm trug. Angeblich brauchte sein Sohn, wenn er in den Semesterferien aus Yale zu Besuch kam, etwas Eigenes.
Das Wohnzimmer, in dem Isabel und Dan bis heute leben, ist in einem ewigen Zustand des Weder-hier-noch-Dort erstarrt. Hier steht immer noch Isabels kaffeebraunes, vor Jahren in einem Antikladen gekauftes Sofa. Dort sind der Flickenteppich aus Guatemala, der früher in Dans alter Wohnung an der Avenue B lag, und ein wuchtiger Sofatisch im »spanischen Stil«, der aussieht wie ein mitten im Raum festgemachtes Piratenschiff. Der Tisch war ein Geschenk von Isabels und Robbies Vater, der nach dem Tod seiner Frau in einem Anfall von Verkleinerungswahn beschlossen hatte, sich von dem Stück zu trennen. Die Verkleinerung entpuppte sich im Laufe der Zeit als Vorsatz, dauerhaft in Trauer zu leben, nur eben mit weniger Möbeln und stärkerer Beleuchtung. Seit ihr Vater zum Witwer wurde, hat er keine Glühbirne unter fünfundsiebzig Watt mehr angeschafft, gerade so, als bräuchte er, um seine Einsamkeit richtig sehen zu können, möglichst helles Licht.
Isabel und Robbie sollten ihn anrufen; es wäre an der Zeit.
Robbie setzt sich ins Wohnzimmer und durchsucht Wolfes Ordner (#wolfe_man) nach einem geeigneten Foto.
Wolfe ist nicht irgendeine übertriebene Männerfantasie. Sein recht attraktives Gesicht und die braunen Augen gehören einem Fremden, den Robbie auf Depositphotos entdeckt hat. Wolfes Mitbewohnerin Lyla ist im echten Leben eine ebenso lässige wie elegante Schwarze, die sich auf Instagram Galatea2.2 nennt. Wolfes Apartment setzt sich aus drei verschiedenen Wohnungen zusammen, und der Hund wurde neulich von einer Userin namens Inezhere aus dem Tierheim geholt.
Robbie hofft, keinen Schaden anzurichten. Er hat die Fotos nicht nur aus dem Internet geklaut (er wundert sich selbst darüber, dass er noch nicht erwischt wurde), sondern daraus auch noch einen Menschen geschaffen, der gar nicht existiert beziehungsweise nur als Zusammenführung von Eigenschaften unterschiedlicher Leute.
Die Parallele zu Frankenstein ist unübersehbar.
Doch Wolfe ist keine Vergewaltigung ehemals lebendigen Gewebes, sondern nur die Vorstellung von einer Person. Er wird nicht eines Tages zum Leben erwachen und sich beschämt, verloren und einsam fühlen. Niemals wird er auf einem Eisberg auf ein kaltes Meer hinaustreiben. Er ist eine Fantasie, eine schöne und relativ kleine, die aber zufälligerweise von 3407 anderen Menschen geteilt wird.
Daran ist doch nichts verwerflich, oder?
Robbie wählt ein Foto aus und setzt den ersten Post des Tages ab.
Das Bild: eine Weide in Vermont, vielleicht auch New Hampshire. Solche Fotos sind schnell zu finden. Robbie hat jetzt schon ein halbes Dutzend oder mehr davon im Wolfe-Ordner gesammelt. Dieses hier zeigt eine weitläufige, grellgrüne Wiese, darauf einen Baum mit weißen, daumennagelgroßen Blüten. Links unten ragt ein Seitenspiegel ins Bild. Der Spiegel gehört zu einem Auto, aus dem heraus eine gewisse Horsefeather das Foto aufgenommen hat – ganz offensichtlich nicht dieses Jahr, denn für so viel Grünen und Blühen ist es noch zu früh. Aber um Glaubwürdigkeit macht Robbie sich keine Gedanken. Wolfe ist ein fiktionaler Charakter in einer fiktionalen Welt mit eigener Zeitrechnung und willkürlichen Jahreszeiten. Seine Follower scheinen nichts zu merken, oder es ist ihnen egal. Wahrscheinlich schwebte Robbie schon beim Sammeln der Fotos ein Ausflug aufs Land vor, eine Auszeit vom alltäglichen Glück, selbst wenn die Szenerie rein technisch betrachtet ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Die Bildunterschrift: Roadtrip! Nur für einen Tag. Der Frühling hier ist irre wollte das nicht verpassen.
Was sofort mit elf Likes quittiert wird.
Dan steht am Küchentresen und schlägt ein Ei in die Schüssel. Wie immer bleibt er sich treu: der ehemalige Rock ’n’ Roller als untersetzter, gebieterischer Vierzigjähriger – eine Figur, wie sie in der Kunstgeschichte fehlt. Die Griechen hatten eine Vorliebe für muskulöse Männer mittleren Alters, für Krieger, die mit vergehender Zeit immer furchteinflößender wurden. Doch in späteren Jahrhunderten tauchten mittelalte Männer als Motiv gar nicht erst auf (selbst Michelangelo bevorzugte jüngere Typen), und so fanden die heroischen Bilder der Griechen ihre direkte Fortsetzung in Francis Bacons ranzigen rosa Männerpuddings.
Die kollektive Vorstellung von maskuliner Ansehnlichkeit unterschlägt Gestalten wie Dan – den Mann, der irgendwann beleibt ist und auf eine sinnliche Weise weich, dem Zuneigung wichtiger geworden ist als Kampf, der sich mehr Gedanken um Ordnung und Ersparnisse macht als um seinen Auftritt in der Gladiatorenarena. Den Mann, der erste Schritte in die Richtung seiner eigenen Sterblichkeit tut, was in Robbies Augen viel mehr Mumm erfordert, als sich einzureden, man könnte durch genug Bewegung und kosmetische Anstrengungen bis zu seinem achtzigsten Geburtstag aussehen wie achtunddreißig.
Dan trägt eine graue Jogginghose und ein uraltes Ramones-T-Shirt. An seinem platinblonden Hinterkopf prangt ein unverdecktes Rund aus Haut. Wasserstoffperoxid ist das einzig verbliebene Zugeständnis an sein altes Leben, aber wer könnte ihm zum Vorwurf machen, dass er an den Überresten seiner jugendlichen Pracht festhalten will? Wie soll ein Mann verwinden, dass er mit zwanzig aussah wie ein Engel von Botticelli?
Trotz der Haarfarbe ist Dan ein pflichtbewusster, zu grenzenloser Hingabe fähiger Mensch. Seine Wut wurde durch heitere Akzeptanz ausgeschwemmt, zusammen mit all den Enttäuschungen und der Hoffnung auf eine Zukunft, die noch vor ihm liegt. Das Ei knackt er mit Präzision und Fingerspitzengefühl.
»Morgen, Robbie«, sagt er. Nach den vielen Jahren des Rauchens und der Auftritte in schummrigen Clubs ist seine Stimme dauerhaft um eine halbe Oktave gesunken.
»Hey, Danny.«
Robbie stupst Dans fleischige Schulter mit der Stirn an. »Wie geht’s?«, fragt Dan.
»Gut. Ganz okay. Hey, endlich Freitag.«
Das ist ein bisschen taktlos, oder? Für Robbie bedeutet das Wochenende Freiheit, für Dan hingegen, dass die Kinder nicht in der Schule, sondern den ganzen Tag zu Hause sind, und Isabel wird die meiste Zeit vor dem Laptop sitzen (seit ein Drittel der Angestellten entlassen wurde, arbeitet sie sieben Tage die Woche).
Robbie fragt sich, ob er nun, da er ausziehen muss, zum Sticheln neigt, oder ob er sich einfach nur der Tatsache bewusstwird, dass er Dan immer schon mit Sticheleien quält. Den herzensguten Dan, den heißgeliebten Dan, der inzwischen, niemand kann es leugnen, eine ziemlich jämmerliche Figur ist.
»Alles in Ordnung mit Isabel?«, fragt Dan.
»Ja. Sie braucht nur einen Moment für sich.«
»Ich habe einen neuen Song geschrieben. Ich war fast die ganze Nacht auf.«
»Sind die Kinder noch in ihrem Zimmer?«
»Ja«, sagt Dan. »Violet zieht sich an, und Nathan … tja, was Nathan macht, weiß ich nicht genau.«
»Ich werde mal nachsehen und Tempo machen. Du weißt, dass ich heute Vormittag frei habe, oder?«
»Kann sein. Warum noch mal?«
»Heute kommen irgendwelche Handwerker in die Schule und suchen nach Asbest.«
»Ich dachte, der Asbest wäre längst entfernt?«
»Wahrscheinlich. Aber sie sind sich nicht sicher. Sie wissen nicht mehr, ob es je überprüft wurde. Die Akten sind … stell dir einfach Kartons in einem Keller vor, und dann kommt Hurricane Sandy.«
»Dann hast du heute Vormittag also frei.«
»Ich sehe mal nach den Kindern.«
»Danke, Mann. Hab dich lieb.«
»Ich dich auch.«
Als Dan und Isabel vor zwei Jahrzehnten übers Heiraten diskutierten (sie hatte ihre Zweifel), lud Dan den siebzehnjährigen Robbie auf einen Ausflug zum »Größten Fadenknäuel der Welt« ein in der Hoffnung, er könnte den kleinen Bruder auf seine Seite ziehen und Isabel damit für sich gewinnen. An besonders nostalgischen Tagen betrachtet Robbie diese Zeit als die schönste seines Lebens: der zwanzigjährige Dan am Steuer des aus dritter Hand gebraucht gekauften Buick Skylark, dunkelblonde Locken und sehnige Arme, im Radio läuft »Sweet Thing« und sie singen mit, während sich ringsum die Weiden von Pennsylvania und Ohio erstrecken. Dan verkörperte alles, was Robbie unter dem Begriff »schön« verstand. Später würden Robbie und Dan immer wieder erzählen, wie sie die lange Fahrt nach Kansas auf sich genommen hatten, nur um das zweitgrößte