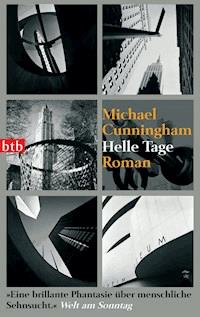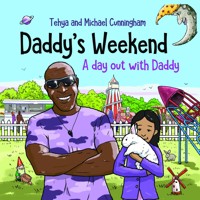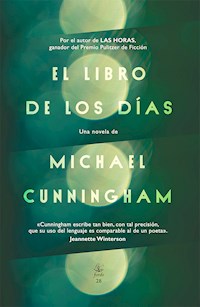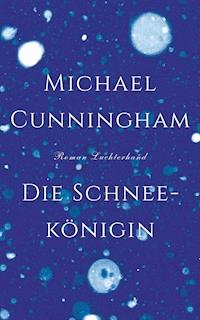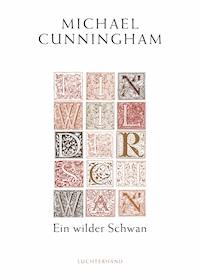2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jonathan und Bobby sind Freunde seit ihrer Kindheit. In New York begegnen sie der exzentrischen Clare, die sich zu beiden Männern hingezogen fühlt. Als sie ein Kind von Bobby erwartet, ziehen die drei gemeinsam aufs Land, in ein altes Farmhaus ganz in der Nähe des legendären Woodstock. Hier wollen sie ein neues
Leben beginnen …
Die bewegende Geschichte dreier Menschen auf der Suche nach dem Glück abseits ausgetretener Pfade.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Jonathan und Bobby sind Freunde seit ihrer Kindheit in Cleveland. Nach dem Ende ihrer Schulzeit zieht Jonathan nach New York. Und es dauert nicht lange, bis Bobby ihm folgt. Sie lernen die exzentrische Clare kennen und gründen eine Wohngemeinschaft. Clare fühlt sich zu beiden Männern hingezogen. Als sie ein Kind von Bobby erwartet, ziehen die drei gemeinsam aufs Land. Hier hoffen sie, eine ganz neue Art von Familie gründen zu können – das Kind soll in einer liebevollen Ménage à trois aufwachsen, zwanzig Jahre nach und fünf Meilen von Woodstock entfernt.
Autor
Michael Cunningham wurde 1952 in Cincinnati, Ohio, geboren und wuchs in Pasadena, Kalifornien, auf. Er lebt heute in New York City und unterrichtet Creative Writing an der Columbia University. Sein Roman »Die Stunden« ist vielfach preisgekrönt, u. a. mit dem Pulitzerpreis und dem PEN/Faulkner-Award, und wurde in 22 Sprachen übersetzt. Die überaus erfolgreiche Verfilmung in Starbesetzung wurde mit mehreren Oscars ausgezeichnet.
Inhaltsverzeichnis
FÜR KEN CORBETT
Teil I
Bobby
Irgendwann einmal kaufte mein Vater ein Kabriolett. Frag mich nicht, warum. Ich war fünf. Er kaufte es und fuhr damit so selbstverständlich zu Hause vor, als hätte er eine Gallone Schnaps mitgebracht. Stell dir das Gesicht meiner Mutter vor. Die Türgriffe hielt sie mit Gummibändern zusammen. Sie wusch alte Plastiktüten und hängte sie zum Trocknen an die Leine, eine Reihe in der Sonne sich blähender Quallen. Stell dir vor, wie sie den Käsegestank aus einer Plastiktüte schrubbt, die gerade ihre dritte oder vierte Runde macht, und unser Vater fährt in einem Chevy-Kabrio vor, gebraucht, aber was soll’s – eine fahrende Landschaft aus Metall, Chromstoßstangen und riesigen, silbernen, geschwungenen Flächen, die wie das Fleisch des Autos aussehen. Er sah den Wagen unten in der City mit einem Verkaufsschild und entschied, daß er der Typ Mann sei, der ein Auto einfach so aus einer Laune heraus kauft. Wie er näher kommt, sehen wir, daß die überschwengliche Freude bereits von ihm weicht. Der Wagen ist ihm jetzt schon eine Last. Er biegt in die Einfahrt mit einem gefrorenen Lächeln, das sich nahtlos dem Kühlergitter des Chevys anpaßt.
Natürlich muß der Wagen wieder weg. Meine Mutter setzt keinen Fuß in ihn. Mein älterer Bruder Carlton und ich werden auf eine Spazierfahrt mitgenommen. Carlton überschlägt sich vor Begeisterung. Ich bin skeptisch. Wenn unser Vater schon einen Wagen an einer Straßenecke kauft – wozu ist er dann noch fähig? Wer hat ihn dazu gebracht?
Er fährt mit uns hinaus aufs Land. Stände am Straßenrand sind überladen mit Äpfeln. Kürbisse werfen ihr Licht auf den Rasen der Farmhäuser. Carlton stellt sich in wilder Erregung auf den Vordersitz und muß wieder runtergezerrt werden. Ich helfe dabei. Unser Vater packt Carltons perlenbesetzten Cowboygürtel an der einen Seite, und ich packe ihn an der anderen. Das gefällt mir. Während ich helfe, Carlton herunterzuziehen, komme ich mir nützlich vor.
Wir fahren an einer großen Farm vorbei. Die Nebengebäude sind in einem Meer sich wiegenden Weizens verankert; in dem dunstigen Licht des späten Nachmittags glänzen die weißen Verschalungen wie geschmolzen. Wir bleiben alle drei schweigsam, sogar Carlton. Der Ort wirkt irgendwie vertraut. Kühe grasen. Herbstbäume werfen ihre langen Schatten. Ich sage mir, daß wir Farmer sind und trotzdem irgendwie reich genug, um ein Kabrio zu fahren. Die Welt prunkt mit ihren Möglichkeiten. Wenn ich nachts in einem Auto fahre, glaube ich, daß der Mond mir folgt.
»Wir sind zu Hause!« rufe ich, als wir an der Farm vorüberfahren. Ich habe keine Ahnung, was ich sage. Wind und Geschwindigkeit zusammen wirken sich so auf mein Gehirn aus. Doch weder Carlton noch mein Vater stellen mir irgendeine Frage. Wir fahren durch ein lebendiges Schweigen. In diesem Augenblick bin ich mir sicher, daß wir den gleichen Traum träumen. Ich blicke hoch und sehe, daß der Mond, weiß und tief eingelagert in einen dunklen, blauen Himmel, uns tatsächlich folgt. Es dauert nicht lange, bis Carlton wieder steht und gegen das Rauschen der Luft anschreit. Und mein Vater und ich ziehen ihn wieder in die Sicherheit und Geborgenheit dieses großen Wagens zurück.
Jonathan
Wir versammelten uns in der Abenddämmerung auf dem dunkler werdenden Rasen. Ich war fünf. In der Luft lag der Duft von frisch geschnittenem Gras. Mein Vater trug mich auf seinen Schultern. Ich war sowohl Pilot als auch Gefangener seiner gewaltigen Gestalt. Meine nackten Beine scheuerten am Sandpapier seiner Wangen; ich hielt mich an seinen Ohren fest, großen, weichen Muscheln, von Haaren bekränzt.
In der Dämmerung sahen der rote Lippenstift und die Fingernägel meiner Mutter fast schwarz aus. Sie war schwanger, man konnte die erste Rundung gerade erkennen, und die Menge machte ihr Platz. Wir schlugen unser kleines Lager in der zweiten Reihe in Form von zwei Klappstühlen auf. Unmengen von Menschen hatte die Feier mobilisiert. Rauch von den tragbaren Bratrosten würzte die Luft. Ich machte es mir auf dem Schoß meines Vaters bequem und bekam einen Schluck Bier. Meine Mutter saß da und fächelte sich mit der Sonntagsbeilage der Zeitung zu. Über uns summten Moskitos.
An diesem vierten Juli hatte die Stadt Cleveland zwei berühmte mexikanische Brüder engagiert, die das Feuerwerk über dem städtischen Golfplatz abbrennen sollten. Diese Brüder veranstalteten zu staatlichen und religiösen Anlässen Shows in der ganzen Welt. Sie stammten aus dem tiefsten Mexiko, wo Brote in Form von Schädeln oder Jungfrauen gebacken wurden und wo man ein Feuerwerk für die höchste künstlerische Ausdrucksform eines Menschen ansah.
Die Show begann, noch bevor sich der erste Stern zeigte. Sie fing recht unspektakulär an. Die Brüder hielten ihr Publikum hin, begannen mit den einfachen Sachen: Standarddoublette und Dreifachreigen, Spiralraketen, bunte Sprühregen, die gelbgraue Orchideen aus farbigem Rauch an den Himmel malten. Ganz gewöhnliches Zeug. Nach einer Pause machten sie dann ernst. Eine Rakete schoß steil empor, in ihrem Nachstrom einen leuchtenden Silberfaden ziehend; am höchsten Punkt ihrer Flugbahn erblühte sie purpurn, ein flammendes, fünfzackiges Maiglöckchen, wobei jedes Blumenblatt zu einer eigenen Blüte explodierte. Die Menge war begeistert. Mein Vater umfaßte mit seiner riesigen, braunen Hand meinen Bauch und fragte mich, ob mir das Feuerwerk gefiel. Ich nickte. Unter seiner Kehle drängte sich ein dichtes Büschel dunkelblonden Haares durch den Kragen seines Madrashemdes.
Weitere Maiglöckchen explodierten, rot, gelb und mauve mit zitternden, silbernen Stengeln. Dann kamen Schlangen, die orangenes Feuer spien, ein Dutzend gleichzeitig; sie schossen in großen, schwankenden Kurven aufeinander zu, verflochten sich und teilten sich wieder, die ganze Zeit über wild zischend. Ihnen folgten gewaltige, lautlose Schneeflocken, Kristallkörper aus reinstem Weiß, und dann kam eine Konstellation in der Form der Freiheitsstatue, mit blauen Augen und rubinroten Lippen. Tausende hielten den Atem an und applaudierten. Ich erinnere mich an die Kehle meines Vaters, gesprenkelt mit getrocknetem Blut, die stoppelige Haut lose über einem knotigen Mechanismus, der Bier schluckte. Wenn ich bei einem gelegentlichen Knall oder der farbigen Glut, die direkt auf unsere Köpfe zu stürzen schien, ängstlich aufstöhnte, versicherte er mir, daß ich nichts zu fürchten hätte. In meinem Bauch und meinen Beinen konnte ich das Grollen seiner Stimme hören. Seine sehnigen Arme, geteilt von einer einzigen Ader, hielten mich fest.
Ich möchte über die Schönheit meines Vaters reden. Ich weiß, das ist nicht gerade das übliche Thema für einen Mann – wenn wir über unsere Väter reden, dann geht es meist um mutige Taten oder gigantische Wutanfälle, vielleicht sogar um Zärtlichkeit. Doch ich möchte über die reine, unverfälschte Schönheit meines Vaters sprechen: die mächtige Symmetrie seiner hellen Arme mit ihren geschmeidigen Muskeln, die aussahen, als wären sie aus Asche geformt worden; die leichte, beherrschte Grazie seines Ganges. Er war ein kompakter Mann, dessen Körper Würde ausstrahlte, ein Kinobesitzer mit dunklen Augen, der auf stille Weise die Filme liebte. Meine Mutter litt an Kopfschmerzen und neigte gelegentlich zu Ironie, doch mein Vater war stets fröhlich, stets irgendwohin unterwegs, stets gewiß, daß sich alles zum Besten wenden würde.
Wenn mein Vater arbeitete, waren meine Mutter und ich allein zu Hause. Sie erfand Spiele, die wir im Haus spielen konnten, oder beschäftigte mich mit Kuchenbacken. Sie ging ungern aus, vor allem im Winter, weil sie in der Kälte Kopfschmerzen bekam. Sie war ein Mädchen aus New Orleans, von zierlichem Körperbau und mit präzisen Bewegungen. Sie hatte jung geheiratet. Manchmal brachte sie mich dazu, mich mit ihr gemeinsam ans Fenster zu setzen, auf die Straße hinauszuschauen und auf den Moment zu warten, in dem sich die gefrorene Landschaft vielleicht in etwas ganz Gewöhnliches verwandeln würde, dem sie so gelassen vertrauen konnte, wie es die soliden Ohio-Mütter taten, die riesige, mit Lebensmitteln, Babys und Verwandtschaft beladene Autos durch die Gegend steuerten.
»Jonathan«, flüsterte sie, »he, Boy-o! Worüber denkst du nach?«
Das war eine ihrer Lieblingsfragen. »Ich weiß nicht«, sagte ich.
»Erzähl mir irgendwas«, sagte sie. »Erzähl mir eine Geschichte.«
Mir war klar, daß ich irgend etwas sagen mußte. »Diese Jungen da gehen mit ihrem Schlitten zum Fluß«, erzählte ich ihr, als zwei ältere Jungs mit karierten Mützen aus unserer Nachbarschaft – Jungs, die ich bewunderte und fürchtete – an unserem Haus vorbeikamen, einen ramponierten Schlitten im Schlepptau. »Sie fahren damit auf dem Eis, aber sie müssen wegen der Löcher vorsichtig sein. Ein kleiner Junge ist hineingefallen und ertrunken.«
Es war keine großartige Geschichte, aber es war das Beste, was mir so aus dem Stegreif einfiel.
»Woher weißt du das?« fragte sie.
Ich zuckte mit den Schultern. Meiner Meinung nach hatte ich die Geschichte erfunden. Manchmal war es schwierig, zwischen dem, was passiert war, und dem, was hätte passieren können, zu unterscheiden.
»Macht dir diese Geschichte Angst?« fragte sie. »Nein«, erklärte ich. Ich stellte mir vor, wie ich über eine weite Eisfläche schlidderte, geschickt den zackigen Löchern ausweichend, in die andere Jungen mit traurigem Klatschen stürzten.
»Hier bist du sicher«, sagte sie, mir über das Haar streichend. »Mach dir nur keine Sorgen. Hier sind wir beide absolut sicher.«
Ich nickte, obwohl ich die Unsicherheit aus ihrer Stimme heraushören konnte. Ihr Gesicht mit der schweren Kinnlinie und der kleinen Nase fing das rauhe Winterlicht ein, das von der eisigen Straße abprallte und in unserem Haus von Raum zu Raum schoß, das Silberbesteck im Glasschrank streifend und die kleine Prismenlampe zum Leben erweckend.
»Wie wär’s mit einer komischen Geschichte?« sagte sie. »Wahrscheinlich könnten wir gerade jetzt eine brauchen.«
»Okay«, sagte ich, obwohl ich keine komischen Geschichten kannte. Humor war für mich ein Buch mit sieben Siegeln – ich konnte nur das erzählen, was ich sah. Draußen vor unserem Fenster tauchte Miss Heidegger auf, die alte Frau von nebenan, bekleidet mit einem Mantel, der aus Mäusefellen gemacht zu sein schien. Sie hob ein Zeitungsblatt auf, das in ihren Hof geweht worden war, und humpelte wieder hinein. Von den Bemerkungen meiner Eltern her wußte ich, daß Miss Heidegger komisch war. Sie war komisch in ihrem Beharren auf einem absolut makellosen Grundstück und in ihrer Meinung über die Kommunisten, die die Schulen, die Telefongesellschaft und die lutheranische Kirche beherrschten. Mein Vater pflegte mit trillernder Stimme zu sagen: »Diese Kommunisten haben uns schon wieder eine Stromrechnung geschickt. Denkt an meine Worte; sie versuchen uns aus unseren Häusern zu werfen.« Wenn er so was sagte, lachte meine Mutter stets, selbst zu den Zeiten, in denen die Rechnungen bezahlt werden mußten und die Furcht am deutlichsten um ihren Mund und ihre Augen eingegraben war.
An diesem Tag versuchte ich, am Fenster sitzend, Miss Heidegger selbst zu parodieren. Mit hoher, zitternder Stimme, die sich nicht stark von meiner echten Stimme unterschied, sagte ich: »Oh, diese schlimmen Kommunisten haben mir diese Zeitung direkt in den Hof geblasen.« Ich erhob mich und humpelte steifbeinig in die Mitte des Wohnzimmers, wo ich ein Exemplar von Time vom Kaffeetisch nahm und es über meinem Kopf schwenkte.
»Ihr Kommunisten!« krächzte ich. »Verschwindet jetzt! Hört auf, uns aus unseren Häusern zu vertreiben!«
Meine Mutter lachte entzückt. »Du bist boshaft«, sagte sie.
Ich ging zu ihr, und sie kraulte mir liebevoll den Kopf. Das Licht von der Straße erhellte die Gazevorhänge und füllte die dunkelblaue Konfektschale auf dem Beistelltisch. Wir befanden uns in Sicherheit.
Mein Vater arbeitete den ganzen Tag. Er kam zum Abendessen heim und ging danach wieder zurück ins Kino. Ich weiß bis heute nicht, was er all die Stunden tat – soweit ich das beurteilen kann, verlangt ein kleines, nicht gerade gutgehendes Kino kaum die Anwesenheit des Besitzers von morgens bis spät abends. Mein Vater arbeitete jedoch all diese vielen Stunden, und weder meine Mutter noch ich stellten das in Frage. Er verdiente Geld und unterhielt das Haus, das uns vor den Wintern in Cleveland schützte. Mehr brauchten wir nicht zu wissen.
Wenn mein Vater zum Abendessen heimkam, hing ein frostiger Geruch an seinem Mantel. Er wirkte so groß und unerschütterlich wie ein Baum. Wenn er seinen Mantel auszog, stellten sich die feinen Härchen auf seinen Unterarmen in der weichen, warmen Luft des Hauses wie elektrisch geladen auf.
Meine Mutter servierte das Essen, das sie gekocht hatte. Mein Vater tätschelte ihren Bauch, der mittlerweile so rund und solide wie ein Basketball war.
»Drillinge«, sagte er. »Wir werden ein größeres Haus brauchen. Auf lange Sicht kommen wir mit zwei Schlafzimmern nicht aus.«
»Machen wir uns erst mal Gedanken über die Ölrechnung«, sagte sie.
»Noch ein Jahr«, sagte er. »In einem Jahr sind wir in der Lage, uns ein paar Immobilien anzuschauen.«
Mein Vater redete oft von einer Änderung unserer Lage. Wenn wir uns in einer bestimmten Weise verhielten, würden die Dinge schon den richtigen Verlauf nehmen. Wir mußten darauf achten, wie wir uns gaben und was wir dachten.
»Wir werden sehen«, sagte meine Mutter ruhig.
Er erhob sich vom Tisch und rubbelte ihre Schultern. Seine Hände bedeckten sie vollständig. Mit Daumen und Mittelfinger hätte er fast ihren Hals umfassen können.
»Konzentriere du dich auf das Kind«, sagte er. »Sorg dafür, daß du gesund bleibst. Ich kümmere mich um den Rest.«
Meine Mutter fügte sich seinen Zärtlichkeiten, genoß sie aber nicht. Ich konnte es an ihrem Gesicht sehen. War mein Vater zu Hause, so zeigte sie den gleichen vorsichtigen Ausdruck, den man bei ihr beobachten konnte, wenn wir die Straße betrachteten. Seine Gegenwart machte sie nervös, als hätte sich ein Teil der Außenwelt Zutritt ins Haus verschafft.
Mein Vater wartete darauf, daß sie sprechen, daß sie unser Familienleben in der kontinuierlichen Konversation weitertragen würde. Sie saß schweigend am Tisch, die Schultern angespannt.
»Nun, ich schätze, es ist Zeit für mich, wieder an die Arbeit zu gehen«, sagte er schließlich. »Bis dann, Kollege. Paß auf das Haus auf.«
»Okay«, sagte ich. Er klopfte mir auf den Rücken und gab mir einen rauhen Kuß auf die Wange. Meine Mutter stand auf und begann den Abwasch zu machen. Ich blieb sitzen und beobachtete, wie mein Vater seine muskulösen Arme im Mantel versteckte und in die Außenwelt zurückkehrte.
An diesem Abend schlich ich mich, nachdem ich zu Bett gebracht worden war und während meine Mutter unten Fernsehen schaute, in ihr Zimmer und probierte ihren Lippenstift an meinen Lippen aus. Selbst in der Dunkelheit erkannte ich, daß ich damit nicht verführerisch, sondern eher wie ein Clown aussah. Nichtsdestoweniger veränderte es mein Erscheinungsbild. Mit ihrem Rouge malte ich mir rote Flecken auf die Wangen und schmierte schwarze Striche über meine eigenen, blaßblonden Augenbrauen.
Auf Zehenspitzen schlich ich ins Badezimmer. Von unten trieben Gelächter und Musik die Treppe hoch. Ich stellte den Hocker an die Stelle, wo sich mein Vater morgens rasierte, und kletterte hinauf, so daß ich mich im Spiegel sehen konnte. Die Lippen, die ich gemalt hatte, waren riesig und formlos, die scharlachroten Rougeflecke saßen schief. Ich war nicht schön, glaubte aber die Anlage zur Schönheit in mir zu haben. Ich mußte vorsichtig sein, wie ich mich gab, was ich dachte. An das quietschende Scharnier denkend, öffnete ich langsam das Arzneischränkchen und holte die gestreifte Dose Barbasol meines Vaters heraus. Ich wußte genau, was ich zu tun hatte: die Dose mit einem ungeduldigen Schnappen des Handgelenks schütteln, einen Berg Schaum auf meine linke Handfläche sprayen und ihn achtlos und verschwenderisch über Backen und Hals schmieren. Make-up aufzulegen erforderte die Präzision und Entschlossenheit, die man benötigt, um eine Bombe zu entschärfen; Rasieren war ein hastiger, ungenauer Akt, der scharlachrote, stecknadelgroße Blutströpfchen produzierte und im Ausguß kleine Haarborsten – so tot wie Schlangenhaut – zurückließ.
Nachdem ich mein Gesicht eingeschäumt hatte, betrachtete ich mich lange im Spiegel und begutachtete den Effekt. Meine schwarzen Augen glitzerten wie diejenigen einer Spinne über dem üppigen, weißen Schaum. Ich wirkte weder damenhaft noch männlich. Ich war etwas völlig anderes. Es gab so viele verschiedene Möglichkeiten, eine Schönheit zu sein.
Meine Mutter wurde immer runder. Bei einer Einkaufstour wollte ich eine rosa Vinylpuppe mit dünnen, magentaroten Lippen und Kobaltaugen haben, die sich mit dem unmißverständlichen Klicken von Miniaturfensterläden schlossen, wenn man sie hinlegte. Ich bekam die Puppe auch. Vermutlich haben meine Eltern das Thema diskutiert. Ich nehme an, sie entschieden, die Puppe würde mir helfen, mit dem Gefühl des Ausgeschlossenseins fertig zu werden. Meine Mutter brachte mir bei, wie ich sie zu wickeln und im Küchenausguß zu baden hatte. Selbst mein Vater zeigte Interesse am Wohlergehen der Puppe. »Wie geht’s dem Baby?« erkundigte er sich eines Abends kurz vor dem Essen, als ich die Puppe aus ihrem Bad hob.
»Okay«, sagte ich. Wasser tröpfelte aus den Gelenken. Das schwefelfarbene Haar, das aus den in den Skalp gebohrten Löchern sproß, hatte den Geruch eines nassen Pullovers angenommen.
»Braves Baby«, sagte mein Vater und tätschelte den festen Gummihals mit einem Finger. Ich war begeistert. Er liebte das Baby.
»Ja«, sagte ich und hüllte das leblose Ding in ein dickes, weißes Handtuch.
Mein Vater hockte sich nieder, stieß eine Brise Essensduft aus. »Jonathan?« sagte er.
»Ja?«
»Du weißt doch, daß Jungen für gewöhnlich nicht mit Puppen spielen, nicht wahr?«
»Schon. Ja.«
»Das ist dein Baby«, sagte er, »und hier zu Hause ist das auch ganz in Ordnung. Aber wenn du es den anderen Jungs zeigst, dann verstehen die das vielleicht nicht. Also spielst du besser nur hier mit ihr. Okay?«
»Okay.«
»Gut.« Er tätschelte meinen Arm. »Okay? Du spielst nur zu Hause mit ihr, ja?«
»Okay«, erwiderte ich. Wie ich da so klein vor ihm stand, die gewickelte Puppe im Arm, empfand ich die erste wahre Demütigung meines Lebens. Ich erkannte eine tiefgreifende Unzulänglichkeit in mir selbst, etwas Lächerliches. Natürlich wußte ich, daß es sich bei dem Baby lediglich um ein Spielzeug handelte und noch dazu um ein äußerst zweifelhaftes. Ein falsches Spielzeug. Wie hatte ich mich dazu verleiten lassen, etwas anderes zu glauben?
»Alles in Ordnung mit dir?« fragte er.
»Mhm.«
»Gut. Hör zu, ich muß los. Paß auf das Haus auf.«
»Papi?«
»Ja?«
»Mami will kein Baby haben«, sagte ich.
»Aber sicher will sie das.«
»Nein. Sie hat es mir erzählt.«
»Jonathan, mein Lieber, Mami und Papi sind beide sehr glücklich über das Baby. Bist du nicht auch glücklich?«
»Mami haßt es, das Baby zu bekommen«, sagte ich. »Sie hat es mir erzählt. Sie sagte, du willst es haben, aber sie nicht.«
Ich blickte in sein riesiges Gesicht und erkannte, daß ich einen Treffer erzielt hatte. Seine Augen wurden heller, und das Delta der Äderchen an Nase und Wangen trat als scharfes, rötliches Relief auf seiner blassen Haut hervor.
»Es stimmt nicht, Kollege«, sagte er. »Mami sagt manchmal Sachen, die sie gar nicht meint. Glaub mir, sie ist über das Baby genauso glücklich wie du und ich.«
Ich antwortete nicht.
»He, ich komme zu spät«, sagte er. »Vertrau mir. Du wirst bald eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder haben, und wir werden alle verrückt nach dem Baby sein. Du wirst der große Bruder sein. Eine großartige Sache.«
Nach einem Moment fügte er hinzu: »Kümmere dich um alles, während ich weg bin, okay?« Er strich mir mit seinem spatelförmigen Daumen über die Wange und ging los.
In dieser Nacht weckten mich die Geräusche eines im Flüsterton gehaltenen Streites, der hinter der Tür des Schlafzimmers am Ende des Ganges ausgetragen wurde. Ihre Stimmen zischten. Ich lag da und wartete – worauf? Bald schlief ich wieder ein und weiß bis heute nicht, ob ich die Geräusche des Streites nur geträumt habe. Es ist immer noch schwierig zu unterscheiden, was passiert ist und was hätte passieren können.
Als für meine Mutter an einem Abend im Dezember die Zeit gekommen war, blieb ich in Obhut von Miss Heidegger, der Nachbarin, zurück. Sie war eine milchäugige, mißtrauische alte Seele, deren Haar vor lauter Sorgen zu ein paar spärlichen grauen Büscheln verkommen war, durch die man die rosige Wölbung ihres Schädels sehen konnte.
Ich sah zu, wie meine Eltern zusammen fortfuhren. Miss Heidegger stand hinter mir, sanft nach welkem Rosenparfüm duftend. Als der Wagen unseren Blicken entschwunden war, erklärte ich ihr: »Mami wird das Baby nicht wirklich bekommen.«
»Nein?« sagte sie freundlich. Sie hatte keine Ahnung, wie man mit Kindern umgehen mußte, wenn sie so merkwürdige Sachen von sich geben.
»Sie will es nicht«, sagte ich.
»Oh, komm, du wirst das Baby furchtbar liebhaben«, sagte Miss Heidegger. »Warte nur ab. Wenn Mami und Papi es mit nach Hause bringen, dann wirst du schon sehen. Es wird das süßeste kleine Ding sein, das du dir nur vorstellen kannst.«
»Sie mag es nicht, ein Baby zu bekommen«, sagte ich. »Wir wollen es nicht.«
Der armen Miss Heidegger schossen die letzten Reste ihres Blutes ins Gesicht, und mit einem lauten Rascheln eilte sie in die Küche, um nach dem Abendessen zu sehen. Sie kochte irgendeine fade, labbrige Mahlzeit, die mir in meiner kindlichen Begeisterung für breiartige Sachen ungemein gut schmeckte.
Nach Mitternacht rief mein Vater vom Krankenhaus aus an. Miss Heidegger und ich griffen gleichzeitig nach dem Telefon. Sie nahm den Hörer ab und stand aufrecht in ihrem blauen Bademantel da und nickte mit ihrem Schrumpfkopf. An ihren Augen erkannte ich, daß etwas nicht stimmte; sie wurden klein und glitzerten wie Flußeis, kurz bevor es schmilzt.
Das Baby wurde mir beschrieben als ein Kuchen, den man zu zeitig aus dem Ofen genommen hatte. Erst als Erwachsener konnte ich mir die wahre Geschichte von der verwickelten Nabelschnur und dem zerfetzten Fleisch zusammenreimen. Meine Mutter war fast eine Minute lang tot gewesen und hatte dann wunderbarerweise wieder ins Leben zurückgefunden. Der größte Teil ihrer Bauchhöhle mußte ausgeschabt werden. Das Baby, ein Mädchen, hatte lange genug gelebt, um einen kläglichen Schrei zur fluoreszierenden Decke des Kreißsaales hochzusenden.
Ich denke, mein Vater war nicht in der Verfassung, mit mir zu sprechen. Er überließ das Miss Heidegger, die den Telefonhörer auflegte und mit einem Ausdruck entsetzter Verwirrung vor mir stand; mit einem solchen Ausdruck, stelle ich mir vor, sieht man dem Tod höchstpersönlich entgegen. Ich wußte, daß etwas Fürchterliches geschehen war.
Im Flüsterton sagte sie: »Oh, diese armen, armen Leute. Oh, du armer kleiner Junge.«
Obwohl ich nicht genau wußte, was geschehen war, bekam ich doch mit, daß Anlaß für Kummer und Trauer bestand. Ich gab mir Mühe, mich untröstlich zu fühlen; in Wirklichkeit aber freute ich mich mehr über die Chance, mich in einer schlimmen Situation richtig verhalten zu können.
»Nun, mach dir keine Sorgen, mein Lieber«, sagte Miss Heidegger. In ihrer Stimme schwang echtes Entsetzen mit, ein feuchter, gurgelnder Unterton. Ich versuchte, sie zu einem Stuhl zu führen, und stellte zu meiner Überraschung fest, daß sie mir gehorchte. Ich rannte in die Küche und holte ihr ein Glas Wasser, das man, so glaubte ich, anbot, wenn sich jemand im Zustand emotionaler Erregung befand.
»Keine Sorge, ich bleibe bei dir«, sagte sie, als ich ein Tablett für das Glas holte und es am Tischende abstellte. Sie versuchte, mich auf ihren Schoß zu ziehen, aber ich hatte nicht die Absicht, das zuzulassen. Ich blieb vor ihr stehen. Sie streichelte meinen Kopf, und ich tätschelte die dünnen, komplizierten Knöchelchen ihres mit Flanell bedeckten Knies.
Sie sagte hilflos, fast fragend: »Oh, sie war so gesund. Sie sah aus, als würde es ihr bestens gehen.«
Kühner geworden, nahm ich eine ihrer zerbrechlichen, gepuderten, alten Hände in meine.
»Oh, du armes Ding«, sagte sie. »Sorg dich nur nicht, ich bin ja bei dir.«
Ich blieb weiter vor ihr stehen und hielt die Knochen ihrer Hand. Sie lächelte mir zu. Lag da eine Andeutung von Vergnügen in ihrem Lächeln? Wahrscheinlich nicht; vermutlich bildete ich es mir nur ein. So blieben wir eine Weile stehen, mit gesenktem Kopf, aber standhaft und auf eine vage Art zufrieden, wie ein Paar alte Jungfern, die es gelernt haben, Trost zu finden in dem unendlichen Kummer und Elend dieser Welt.
Meine Mutter kam nach über einer Woche wieder nach Hause, zurückhaltend und ziemlich scheu. Sowohl sie als auch mein Vater blickten sich im Haus um, als wäre es neu für sie, als hätte man ihnen irgend etwas Großartiges versprochen. Während der Abwesenheit meiner Mutter hatte Miss Heidegger ihre eigenen Gerüche etabliert, die sich aus wäßrigem Rosenparfüm und unvertrauten Kochkünsten zusammensetzten. Sie drückte meinen Eltern die Hände und zog sich hastig und diskret zurück. Genausogut hätte ihr jemand heimlich anvertraut haben können, daß das Haus jeden Moment in Flammen aufgehen würde.
Kaum war sie weg, da knieten meine Mutter und mein Vater nieder und umarmten mich. Sie begruben mich fast unter sich mit ihrem Fleisch und ihren vertrauten Gerüchen.
Mein Vater weinte. Nie zuvor hatte er in meiner Gegenwart auch nur eine einzige Träne vergossen, und nun weinte er hemmungslos, große Schluchzer, die sich in seiner Kehle mit dem erstickten Laut eines zusammengepreßten Schlauches verfingen. Probeweise legte ich eine Hand auf seinen Unterarm. Er streifte sie nicht ab und wies mich auch nicht zurecht. Seine blassen Haare ringelten sich zwischen meinen Fingern.
»Ist schon gut«, flüsterte ich, obwohl ich glaube, daß er mich bei seinem Geschluchze nicht hörte. »Ist schon gut«, wiederholte ich laut. Er schien keinen merklichen Trost aus meinen Worten zu ziehen.
Ich schaute meine Mutter an. Sie weinte nicht. Aus ihrem Gesicht war nicht nur jegliche Farbe, sondern auch jeglicher Ausdruck gewichen. Sie hätte ein leerer Körper sein können, der dumpf darauf wartete, von einer menschlichen Seele zum Leben erweckt zu werden. Doch als sie meinen Blick spürte, schaffte sie es, mich auf schlafwandlerische Art an ihre Brust zu ziehen. Ihre Umarmung kam für mich überraschend, und meine Hand rutschte vom Unterarm meines Vaters ab. Als meine Mutter mein Gesicht in die Falten ihres Mantels preßte, verlor ich jeden Kontakt zu meinem Vater. Ich spürte, wie ich in die Tiefen des Mantels meiner Mutter gezogen wurde, der sich über meine Nase und meine Ohren legte. Die Klagetöne meines Vaters klangen nun gedämpft und fern, als ich immer tiefer in der Kleidung meiner Mutter untertauchte, durch die oberen, kalten Schichten zu dem duftenden, vertraut riechenden Kern. Ich leistete einen Moment lang Widerstand, versuchte, mich zu meinem Vater zurückzukämpfen, doch sie war zu stark. Ich verschwand. Ich verließ meinen Vater und ergab mich dem gefräßigeren Kummer meiner Mutter.
Danach widerstrebte es ihr mehr denn je, das Haus zu verlassen. Morgens holte sie mich manchmal in ihr Bett, und wir blieben da, lasen oder schauten fern bis in den Nachmittag hinein. Wir machten Spiele, erzählten uns Geschichten. Ich glaubte zu wissen, was wir während dieser langen häuslichen Tage zusammen taten. Wir probten für eine Zeit, in der mein Vater nicht mehr bei uns sein würde – wenn wir beide auf uns allein gestellt sein würden.
Um meine Mutter zum Lachen zu bringen, imitierte ich andere Leute. Allerdings verspürte ich keine Lust mehr, Miss Heidegger nachzuahmen. Ich imitierte meine Mutter, daß sie manchmal lauthals auflachte. Ich legte ihre Halstücher an, setzte ihre Hüte auf und redete in meiner eigenen Version ihres New-Orleans-Dialektes, einer Mischung aus Südstaaten und Bronx. »Was denkst du gerade?« fragte ich gedehnt. »Schatz, erzähl mir eine Geschichte.«
Sie lachte, bis ihr die Tränen in die Augen traten. »Herzchen«, pflegte sie zu sagen, »du bist ein Naturtalent. Was hältst du davon, daß wir dich auf die Bühne bringen? Dann kannst du deine Mama im Alter unterstützen?«
Wenn wir schließlich aufstanden, zog sie sich eilig an und machte sich ans Kochen und Aufräumen.
Mein Vater massierte ihre Schultern nicht mehr, wenn er abends heimkam. Er drückte ihr keine übertriebenen, schmatzenden Küsse mehr auf Stirn oder Nasenspitze. Es war nicht mehr möglich. Ein Kraftfeld hatte sich um sie herum aufgebaut, durchsichtig und solide wie Glas. Ich konnte sehen, wie es entstand, wenn er heimkehrte und die wuchernden, üppigen Gerüche der Außenwelt in den Falten seines Mantels mitbrachte. War das Feld aufgebaut, dann sah meine Mutter kein bißchen anders aus – ihr Gesicht wirkte klug und leicht fiebrig, ihre Bewegungen waren so exakt wie die eines Chirurgen, wenn sie das perfekte Abendessen servierte, das sie gekocht hatte – doch es war nun unmöglich geworden, sie zu berühren. Sowohl mein Vater als auch ich wußten es, mit einer inneren Gewißheit, die aufgrund ihrer Unerklärlichkeit nur um so realer war. Meine Mutter verfügte über gewisse Kräfte. Wir aßen unser Abendbrot (ihre Kochkünste wurden immer besser und erreichten ein respektables Niveau), unterhielten uns über allgemeine Themen, und mein Vater küßte die Luft in unserer Nähe, während er sich zur Rückkehr in die Außenwelt bereit machte.
Im späten Frühjahr erwachte ich eines Nachts wegen eines heftigen Streits. Meine Eltern waren unten. Selbst im Zorn dämpften sie ihre Stimmen, so daß nur gelegentlich ein Wort oder ein Satz bis in mein Zimmer hochdrang. Die Wirkung war so, als würden sich zwei Personen in einem Sack anschreien. Ich hörte meinen Vater sagen: »Bestrafung« und meine Mutter fast eine Minute später antworten: »Was du willst ... etwas ... Selbstsüchtiges.«
Ich lag in der Dunkelheit und lauschte. Kurz darauf hörte ich Schritte – die meines Vaters –, die die Treppe hochkamen. Ich dachte, er würde in mein Zimmer kommen, und täuschte tiefen, engelhaften Schlaf vor, den Kopf mitten auf dem Kissen und die Lippen leicht geöffnet. Doch mein Vater schaute nicht zu mir herein. Statt dessen ging er in das Zimmer, das er mit meiner Mutter teilte. Ich hörte ihn eintreten und dann nichts mehr.
Minuten vergingen. Meine Mutter folgte ihm nicht. Im Haus blieb alles still; es füllte sich mit einem eisigen, winterlichen Schweigen trotz der an den Fensterrahmen raschelnden Blätter. Ich lag in meinem Bett, einerseits auf der Hut, andererseits im Ungewissen, was von mir erwartet wurde und was in einer solchen Nacht erlaubt war. Ich dachte, vielleicht sollte ich einfach weiterschlafen, aber das gelang mir nicht.
Schließlich stand ich auf und ging den Flur entlang zum Zimmer meiner Eltern. Die Tür stand einen Spalt offen. Licht von der Nachttischlampe – ein von einem Pergamentschirm gefärbtes, rötlichgoldenes Licht – hellte das Halbdunkel des Flures auf. Ich konnte hören, daß meine Mutter in der Küche Pekannüsse knackte, eine Reihe scharfer, musikalischer Laute.
Mein Vater lag quer über dem Doppelbett in einer Haltung subtiler, fast spröder Hingabe. Sein Gesicht war der Wand zugekehrt, an der ein in Blau und Grün gehaltenes Bild im Silberrahmen hing, das eine Pariser Straßenszene ohne Menschen zeigte. Einer seiner Arme ragte über den Rand der Matratze; die großen Finger baumelten herab. Sein Brustkorb hob und senkte sich im gleichmäßigen Rhythmus des Schlafes.
Ich blieb eine Weile im Türrahmen stehen und dachte über meine Situation nach. Ich hatte erwartet, daß er mich hören würde, daß er aufschauen und sich sorgen würde, daß ich gestört worden war. Als er seine Haltung auf dem Bett nicht veränderte, trat ich leise in das Zimmer. Es war an der Zeit, etwas zu sagen, aber mir fiel nichts ein, was ich hätte sagen können. Ich hatte angenommen, allein durch meine Gegenwart würde irgend etwas geschehen. Ich blickte mich in dem Raum um. Da standen die beiden Spiegelkommoden; auf einem Perlmuttablett befanden sich die Make-up-Utensilien und die Parfüms meiner Mutter. In dem Spiegel mit Eichenrahmen konnte ich die geblümte Tapete der gegenüberliegenden Wand sehen. Mit leeren Händen schlich ich zum Bett und berührte vorsichtig den Ellenbogen meines Vaters.
Er hob den Kopf und sah mich an, als würde er mich nicht erkennen, als hätten wir uns vor langer Zeit einmal getroffen und er könne sich nun nicht mehr an meinen Namen erinnern. Beim Anblick seines Gesichtes blieb mir das Herz fast stehen. Einen Moment lang hatte es den Anschein, als hätte er uns nun doch bereits verlassen. Das, was den Vater in ihm ausgemacht hatte, war verschwunden, und nun sah ich nur noch einen Mann vor mir, so groß wie ein Auto, aber so leer und skrupellos wie ein Kind, das zu allem fähig ist. Ich stand in meinem gelben Schlafanzug im plötzlichen, harten Glanz seiner Fremdheit und lächelte scheu.
Dann riß er sich zusammen. Sein Gesicht belebte sich wieder, und er legte eine sanfte Hand auf meine Schulter. »He«, flüsterte er, »wieso bist du auf?«
Ich zuckte mit den Schultern. Selbst heute als Erwachsener kann ich mich an keine Situation erinnern, in der ich nicht eine Pause eingelegt und nachgedacht hätte, bevor ich die Wahrheit sagte.
Er hätte mich aufheben und zu sich ins Bett nehmen können. Diese Geste hätte uns vielleicht beide gerettet, zumindest für den Moment. Ich sehnte mich danach. Ich hätte alles, was ich mir in meinen habgierigsten Phantasien an Besitz vorstellen konnte, dafür gegeben, daß er mich zu sich ins Bett gezogen und festgehalten hätte, so wie er mich gehalten hatte, als der Himmel über unseren Köpfen an jenem vierten Juli explodierte. Doch der Gedanke, daß er beim Streiten ertappt worden war, schien ihn zu beunruhigen. Jetzt war er ein Mann, der sein Kind geweckt hatte, weil er seine Frau angeschrien und sich dann wie ein Teenager mit Liebeskummer aufs Bett geworfen hatte. Das würde er immer bleiben, was immer er auch sonst noch tat.
»Geh wieder schlafen«, sagte er schroffer, als er vielleicht beabsichtigt hatte. Ich glaube, er hoffte immer noch, die ganze Sache ungeschehen machen zu können. Wenn er nur überzeugend genug handelte, dann konnten wir in der Zeit zurückspringen und meinen Schlaf wiederherstellen. Morgens würde ich erwachen und lediglich eine vage Erinnerung an ein paar Träume haben.
Ich weigerte mich. Ich war mit nicht mehr und nicht weniger zufrieden, als ihm Trost spenden zu dürfen. Mein Vater befahl mir, zurück ins Bett zu gehen, und ich wurde störrisch und mürrisch. Ich stand kurz vor den Tränen, was seine Geduld nur noch mehr strapazierte. Ich wollte, daß er meine Gegenwart brauchte. Ich benötigte die Gewißheit, daß ich durch Freundlichkeit und Hartnäckigkeit in dem langen Kampf um seine Liebe gesiegt hatte.
»Jonathan«, sagte er. »Jonathan, komm schon.«
Ich ließ mich in mein Zimmer zurückführen. Mir blieb keine andere Wahl. Er nahm mich hoch, und zum erstenmal genoß ich weder seine Berührung noch seinen würzigen Geruch. In diesem Augenblick verstand ich die Zurückhaltung meiner Mutter, ihr Gefühl des Abstands und der Entfernung. Ich besaß mittlerweile einige Übung darin, sie zu imitieren, und nun konnte ich ganz plötzlich nichts anderes mehr tun. Wenn mein Vater meine müden Schultern rieb, verkrampfte ich mich; wenn er aus Schnee und Kälte hereingestampft kam, dann dachte ich nervös daran, daß mein Spinatsoufflé zusammenfallen könnte.
Er legte mich recht sanft ins Bett. Er zog die Decke über mich und sagte, ich solle die Augen schließen. Er benahm sich nicht übel. Trotzdem schlüpfte ich in einem Wutanfall aus dem Bett und rannte quer durch das Zimmer zu meiner Spielzeugtruhe. Unbekannte Gefühle summten in meinen Ohren und machten mich schwindlig. »Jonathan«, sagte mein Vater scharf. Er griff nach mir, aber ich war zu schnell für ihn. Ich wühlte mich bis zum Boden der Truhe vor, wußte genau, wohin ich greifen mußte. Ich zerrte die Puppe an ihrem glatten Gummibein heraus und preßte sie gegen meine Brust.
Er zögerte, halb über mein kleines Bett gebeugt. Auf dem Brett am Kopfende tanzte ein Papphase begeistert über eine Wiese mit vierblättrigen, rosafarbenen Blumen.
»Sie gehört mir«, sagte ich mit fast hysterischer Hartnäckigkeit. Der Boden des Schlafzimmers schien unter meinen Füßen zu schwanken, und ich klammerte mich an die Puppe, als könnte sie allein mir helfen, das Gleichgewicht zu bewahren.
Mein Vater schüttelte den Kopf. Meiner Erinnerung nach ließ ihn jetzt zum ersten und einzigen Mal seine Güte im Stich. Er hatte so viel gewollt, und die Welt begann zu schrumpfen. Seine Frau wies ihn zurück, sein Geschäft blieb ohne Erfolg, und sein einziger Sohn – es würde keine weiteren Söhne mehr geben – liebte Puppen und stille Spiele im Haus.
»Jesus Christus, Jonathan!« bellte er, »Jesus Christus! Was zum Teufel ist los mit dir? Was?«
Stumm stand ich vor ihm. Ich hatte keine Antwort auf diese Frage, obwohl ich wußte, was von mir erwartet wurde.
»Sie gehört mir« war alles, was ich herausbrachte. Ich drückte die Puppe so fest gegen meine Brust, daß ihre starren Wimpern sich durch meinen Schlafanzug bohrten.
»Gut«, sagte er ruhiger, in niedergeschlagenem Ton. »Gut. Sie gehört dir.« Und damit ging er hinaus.
Ich hörte ihn die Treppe hinabsteigen und seine Jacke unten aus dem Garderobenschrank holen. Meine Mutter blieb stumm in der Küche sitzen. Ich hörte, wie er die Haustür schloß mit einer Vorsicht und Entschlossenheit, die auf Endgültigkeit hindeutete.
Am nächsten Morgen jedoch kehrte er zurück. Er hatte auf der Couch im Büro des Kinos geschlafen. Nach einer Zeit voll peinlicher Verlegenheit nahmen wir unser normales Familienleben wieder auf und fanden zu unserer Fröhlichkeit zurück. Mein Vater und meine Mutter bastelten sich eine herzliche Beziehung voller Scherze zurecht, in der es weder Küsse noch Kämpfe gab. Sie lebten zusammen mit der lockeren, keuschen Vertrautheit von Geschwistern. Er stellte mir keine unbeantwortbaren Fragen mehr, obwohl diese eine Frage in meinem Hinterkopf wie eine fehlerhafte elektrische Verbindung knisterte und Funken schlug. Meine Mutter errang eine gewisse Berühmtheit wegen ihrer Kochkünste. 1968 wurde unsere Familie für die Sonntagsbeilage der Cleveland Post fotografiert: Meine Mutter schnitt eine Terrine mit Shrimps an, während mein Vater und ich zuschauten, stolz, erwartungsvoll und perfekt gekleidet.
Bobby
Wir lebten damals in Cleveland, mittendrin. Es waren die sechziger Jahre – unsere Radios plärrten den ganzen Tag von Liebe. Das ist natürlich Geschichte. Es geschah, bevor die Stadt Cleveland Pleite machte, bevor ihr Fluß Feuer fing. Wir waren zu viert. Meine Mutter und mein Vater, Carlton und ich. Carlton wurde in dem Jahr sechzehn, in dem ich neun wurde. Zwischen uns lagen mehrere Brüder und Schwestern, schwache Flämmchen, die im Bauch unserer Mutter erloschen waren. Wir sind keine fruchtbare, weitverzweigte Familie. Unser Familienname lautet Morrow.
Unser Vater war Musiklehrer an der High-School. Unsere Mutter unterrichtete »außergewöhnliche« Kinder, was bedeutete, daß einige den Tag nennen konnten, auf den Weihnachten im Jahre 2000 fallen würde, aber stets vergaßen, ihre Hosen herunterzuziehen, wenn sie pinkeln mußten. Wir wohnten in einer Gegend namens Woodlawn – ordentliche Häuser, ein- und zweistöckig, in optimistischen Farben getüncht. Sie grenzte an einen Friedhof. An unseren Hinterhof schloß sich ein mit dichtem Gebüsch bewachsener Abwasserkanal an; jenseits davon lag ein Feld mit glatten, polierten Steinen. Ich wuchs neben diesem Friedhof auf. Es störte mich nicht. Der Friedhof war manchmal wunderschön. Ein einzelner Steinengel mit kleinen Brüsten und entschlossenem Gesichtsausdruck erhob sich zwischen den eher konservativeren Grabsteinen in der Nähe unseres Hauses. Ein Stück weiter entfernt in einem reicheren Abschnitt legten Moscheen und Tempel ein lautloses Bekenntnis für die bleibenden Werke der Menschen ab. Carlton und ich spielten als Kinder auf dem Friedhof; als wir ein bißchen älter waren, rauchten wir dort Joints und tranken dazu Southern Comfort. Ich war, dank Carlton, der kriminell am weitesten fortgeschrittene Neunjährige in meiner vierten Klasse. Ich stand im Begriff, Karriere zu machen. Ich tat nichts ohne seinen Rat.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!