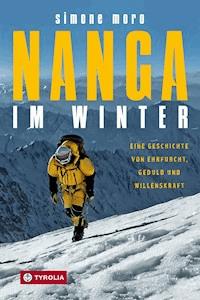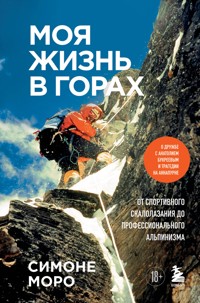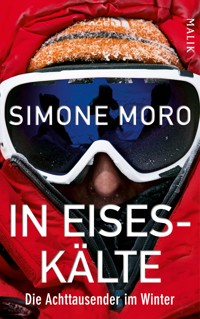
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Seine erste Winterbegehung der Shisha Pangma im Jahr 2005 war ein Meilenstein der Alpingeschichte. 2006 gelang ihm die erste Süd-Nord-Traverse des Mount Everest im Alleingang, und in der Wintersaison 2011/2012 folgten seine beiden bisher größten Erfolge: die erste Winterbegehung des Makalu und des Gasherbrum II im Alpinstil. Doch im Gegensatz zu anderen Profibergsteigern sammelt Simone Moro keine Achttausender: »Ich träume davon, etwas Neues zu machen. Abenteuer sind der Motor meines Alpinismus.« Jetzt schildert der Extrembergsteiger erstmals für ein deutschsprachiges Publikum die Höhen und Tiefen im Leben eines Ausnahmebergsteigers und seine leidenschaftliche Suche nach den letzten großen Herausforderungen des modernen Höhenbergsteigens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.malik.de
Aus dem Italienischen von Marie Anna Söllner
Die italienische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »La voce del ghiaccio. Gli ottomila in inverno: il mio sogno quasi impossibile« bei Rizzoli in Mailand
Mit 53 farbigen Fotos und einer Karte
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Erstausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96343-5
© RCS Libri S.p.A., Mailand 2012 © Piper Verlag GmbH, München 2013 Redaktion: Karin Steinbach, St. Gallen Bildteilfotos: Cory Richards/The North Face (GASHERBRUM II, 2010/2011), Matteo Zanga/The North Face (NANGA PARBAT, 2011/2012), alle anderen: Archiv Simone Moro Karte: Eckehard Radehose, Schliersee Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de Coverabbildungen: Cory Richards/The North Face Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Für Barbara, Jonas und Martina
PROLOG
Ständig drückte ich mich vor dem Schreiben, immer hatte ich eine Menge zu tun, familiäre Verpflichtungen, Reisen, Projekte, Expeditionen und das Training. All dies erforderte Arbeit, Aufmerksamkeit und Energie und lieferte mir so ein unangreifbares Alibi dafür, dass ich keinesfalls eine Pause einlegen konnte, um mich an den Schreibtisch zu setzen und mit dem Schreiben zu beginnen; um meine Erinnerungen in Worte zu fassen, um mir vergangene Momente, Wochen, Monate und Jahre in der vertikalen Welt, all das, wovon ich seit meiner Kindheit geträumt habe, ins Gedächtnis zu rufen. Vierundvierzig alpinistische Expeditionen und vierundvierzig Jahre hätten sich in ebenso vielen Büchern oder zumindest in einer schönen Sammlung von Artikeln widerspiegeln können (und müssen); stattdessen floh ich nach meiner ersten Erfahrung als Autor – 2003 erschien mein erstes Buch in Italien* – jeweils im letzten Moment vor dieser Aufgabe, denn in Aktion zu sein oder dem Verleger mündlich etwas zu erzählen lag mir eindeutig mehr.
Das Schreiben hätte für meinen Geist und meine gut trainierten, kräftigen Muskeln eine allzu statische Tätigkeit, eine erzwungene Pause bedeutet. Gleichzeitig wollte ich diese Aufgabe aber auch nicht an andere abgeben, etwa indem ich mich mit jemandem ausführlich unterhalten und diese Person die Gespräche dann in geschriebene Seiten verwandelt hätte. Nein, Bücher habe ich mir – wie die Aufsätze in der Schule – noch von niemandem schreiben lassen, genau wie ich den Alpinismus und meinen Weg völlig allein und selbstständig verfolgt habe. Folglich begann ich nie mit meinem zweiten Buch, es wollte einfach nicht entstehen. Ich häufte weiterhin Erfahrungen, Reisen und Begehungen an, verschob das Schreiben jedoch immer auf einen ruhigen Moment, der – so hoffte ich insgeheim – nie kommen würde.
Diesmal aber habe ich mir diese Aufgabe – genau wie das tägliche Training und die häuslichen Pflichten – selbst auferlegt. »Setz dich hin und schreibe!« Zehn Minuten Flucht ins Internet, dann ein Klick auf »Logout«, auch die Flucht ins Internet ist beendet. »Jetzt bleib sitzen und schreib, verdammt noch mal! Mann, wie öde!«
Ja, aber was schreibe ich denn nun? Ich muss doch wohl nicht alles von Anfang an erzählen und zwanzig Expeditionsjahre Revue passieren lassen! Gleichzeitig weiß ich aber, dass ich unglaublich viele Erfahrungen gesammelt habe, gerade weil ich nie Pause gemacht habe. Ich habe viele, zu viele Tage, Fakten, Anekdoten vergessen, die mir niemals wieder einfallen würden, wenn ich einfach nur dem Faden der Erinnerung folgte. Nein, ich muss eine andere Lösung finden! Ich brauche ein Thema, einen roten Faden, etwas, was mich begeistert, damit es in meinem Gedächtnis hell wird und mich die Stunden, die ich von jetzt an an der Tastatur verbringen werde, nicht zu sehr belasten.
In vierzig Tagen werde ich zum Nanga Parbat aufbrechen, und mein Terminkalender ist bis dahin randvoll. Ich denke, dass ich erst dort, in der Umgebung, die ich am meisten liebe, die nötige Konzentration zum Schreiben aufbringen werde. Als ich meinem Verleger von dem Plan erzähle, hält er mir entgegen, dass dies »fast unmöglich« sei. Und schon habe ich das Schlüsselwort, das Thema für mein Buch gefunden: das »Unmögliche« oder vielmehr das »fast Unmögliche«. Es ist fast unmöglich, davon zu träumen, ein Profibergsteiger zu werden. Aber ich sage mir, dass ich nicht meinen ganzen Traum von Anfang an erzählen kann, wenigstens diesmal nicht! Also erzähle ich von etwas anderem »fast Unmöglichen«, das einen direkten Bezug zu mir hat, das mich immer angezogen hat, das mich von Anfang an über die höchsten, kältesten und schönsten Wände und Berge der Erde getrieben hat. Ich werde vom Winteralpinismus erzählen, von meinen Winterbegehungen der Achttausender.
Im Grunde genommen ist mir, auch wenn ich mich nicht mehr im Detail an den langen Marathon aus vertikalen Erfahrungen von 1992 bis heute erinnere, sonnenklar, dass der Winter die Jahreszeit ist, die mich bekannt gemacht hat. Mir gefällt die Idee, von dieser Form des Alpinismus zu erzählen, während ich in eine weitere Expedition im Winter involviert bin.
Ganz schön verrückt! Ich riskiere es, ein Buch zu schreiben, das schon veraltet ist, genau wie Kletterführer, Straßenkarten oder Restaurantführer für Italien. Ich schreibe über eine Welt, die sich in ständiger Entwicklung und Veränderung befindet, genauso wie ich selbst. Das, was ich tun will, wird im Grunde eine Momentaufnahme eines Lebensausschnitts sein, mit Zooms auf begeisternde, eisige Momente, in denen ich mich ungeheuer lebendig gefühlt habe.
Okay, es geht los (o Mann, ich Idiot!) …
* Cometa sull’Annapurna (»Komet an der Annapurna«), Corbaccio, Mailand 2003.
Nanga Parbat, 4.Januar 2012
BASISLAGER NANGA PARBAT, 4230 METER TEMPERATUR: –13 °C
Endlich sind wir im Basislager angekommen. Ende Oktober hatte ich Träger hierhergeschickt, um eine rechteckige Steinmauer errichten zu lassen, innerhalb deren wir unser Zelt aufbauen wollten. Die Mauer haben wir heute vorgefunden, und sie ist sehr gut gebaut. Die Leute hier sind wirklich phantastisch.
Morgen werden wir auf Erkundungstour gehen: Wir haben vor, die Wand aus größerer Nähe in Augenschein zu nehmen und auf den Flanken des Ganalo Peak weiter aufzusteigen. Heute ist jedoch der erste Erholungstag. Wir sind im Basislager geblieben und haben ein zweites Zelt aufgebaut. Es soll als Vorratslager und Schlafzelt für die beiden Köche und den Sirdar dienen, den Chef der Sherpas.
Während wir arbeiteten, löste sich eine gigantische Lawine aus dem oberen Teil des Mazenograts, des längsten Gebirgskamms der Welt, der im Westen des Nanga-Parbat-Gipfels nach unten zieht. Wir hatten das Glück, diese Naturgewalt aus der Nähe zu sehen. Der Schneestaub erreichte uns fast fünf Minuten nach dem Lawinenabgang: Es schien zu schneien.
Selbstverständlich habe ich nicht vergessen, dass mein Sohn Jonas heute zwei Jahre alt wird. Wir haben geskypt, es war ein lustiges Gespräch.
WIE ICH DEN WINTERALPINIMUS FÜR MICH ENTDECKTE
CERRO MIRADOR UND ACONCAGUA
Meine lange Reise und meine Entwicklung als Bergsteiger – das, was man allgemein »Karriere« nennt – begann mit dem Winteralpinismus, und zwar schon mit meiner zweiten Expedition. Damals war ich 25Jahre alt. Man schrieb das Jahr 1993, und ich hatte mich auf eine der schwierigsten Wände der Welt fokussiert, die Südwand des Aconcagua, des höchsten Gipfels des amerikanischen Kontinents, der fast 7000Meter erreicht. Im Alpinstil mitten im Winter erlebten Lorenzo Mazzoleni aus Lecco und ich – es hätte noch ein dritter Kamerad dabei sein sollen, aber er hatte mit dem Aufstieg noch nicht einmal beginnen können – in dieser riesigen Wand, die immer im Schatten lag, ein wunderbares, magisches und fast dramatisches Abenteuer.
In meinem ersten Buch, »Cometa sull’Annapurna«, habe ich im Detail über diese fünf Tage berichtet: zwei 25-Jährige in einer der größten Wände der Welt, in völliger Einsamkeit und Unabhängigkeit. Auf 2000 Höhenmetern im Aufstieg überwanden wir alle technischen Schwierigkeiten, dann aber steckten wir einige endlos erscheinende Tage bei dichtem Schneetreiben auf mehr als 6000Metern fest – eine weiße Falle, in der wir hätten umkommen können, denn bei diesen Bedingungen gab es keinerlei Fluchtweg. Es folgte ein dramatischer Überlebenskampf, bei einer Sichtweite gegen null und mit äußerst wenig Sicherungsmaterial, um die zwei Kilometer Abgrund zu überwinden. Wir ließen uns alles Mögliche einfallen, um die zahllosen Stände einzurichten, an die wir bei der nicht enden wollenden Abseilerei unsere Hoffnung und unser Leben hängten. Schließlich schafften wir es doch. Wie Roboter kamen wir erschöpft und von den überstandenen Gefahren entkräftet am Fuß der Wand an und konnten es kaum glauben. Sofort schnallten wir, fast ohne ein Wort zu sagen, die Skier an.
Wir wussten, dass uns, obwohl wir eigentlich schon keine Energie mehr hatten, noch vierzig Kilometer bei extremen Temperaturen und in der Dunkelheit bevorstanden. Die ganze Nacht spurten wir in Richtung Tal und versuchten uns zwischen einem Windstoß und dem nächsten zu orientieren. Wir wussten genau, dass die Rettung erst nahe war, wenn wir die Straße zwischen Argentinien und Chile erreicht hatten – dort, wo unser Abenteuer begonnen hatte. Es gab keine Alternative und folglich keinen Platz für Schwäche oder andere Entscheidungen. Das Einzige, was wir zu tun hatten, war, uns immer weiterzubewegen. Wie zwei von Jägern gehetzte Tiere erreichten wir nach zwei Tagen ununterbrochenen Abstiegs die Ortschaft Puente del Inca auf 2700Metern. Diese zwanzig Häuser samt einem Hotel erschienen uns als der schönste, sicherste und erstrebenswerteste Ort der Welt. Wir waren gerettet. Wir aßen, tranken und ruhten uns einige Tage aus, aber wir wollten nicht nach Hause zurückkehren, ohne irgendein Ergebnis vorweisen zu können; außerdem hatten wir noch Zeit und Energie für einen zweiten Versuch.
Damals gab es niemanden, der Winterexpeditionen auf den Aconcagua organisierte, und noch heute macht das kaum jemand. Wir würden also die Einzigen sein, die einen neuen Versuch starteten. Wir wussten, dass wir uns nach diesen langen Tagen in der Wand gut akklimatisiert hatten. Zudem hatten wir vor der Südwand des Aconcagua eine neue Route auf den gegenüberliegenden, 6089Meter hohen Cerro Mirador erschlossen. Wir hatten sogar auf dem Gipfel übernachtet. Wenn man jene Nacht und die weiteren Nächte, die wir in der Wand feststeckten, zusammenzählte, kam man auf fast eine Woche, die wir in großer Höhe verbracht hatten.
Diese Erkenntnis brachte uns dazu, einen letzten Versuch zu unternehmen. Wir entschieden jedoch, die andere Seite des Bergs auf dem Normalweg in Angriff zu nehmen, denn es war uns bewusst, dass dort im Winter rein gar nichts »normal« sein und der Aufstieg – bei peitschendem Wind und extremen Temperaturen – in jedem Fall sehr anstrengend werden würde. Wir setzten auf Geschwindigkeit und Leichtigkeit und vertrauten auf unser Blut, das inzwischen reich an roten Blutkörperchen sein musste, sowie auf unsere erprobte und harmonische Zusammenarbeit. Wir verließen Puente del Inca auf Skiern und stiegen direkt ins Basislager am Plaza Mulas an: eine gehörige Strecke, die man im Sommer normalerweise in zwei Tagen zurücklegt, indem man für den Materialtransport Maultiere einsetzt. In diesem Fall waren wir selbst – mit unseren schweren Rucksäcken auf dem Rücken – die Maultiere. Bei unserer Ankunft im Basislager wurden wir von einem wunderbaren Sonnenuntergang empfangen, der die Westseite der Wand, die Seite, die wir besteigen wollten, feuerrot leuchten ließ.
Wir brachen früh auf, ohne Biwakausrüstung, nur mit Sicherungsmaterial. Unser Plan war, so schnell wie möglich aufzusteigen und eine Route durch die schneebedeckte Wand zu finden. Die Schwierigkeiten sind bekanntlich gering, im Winter muss man jedoch immer mit Steigeisen gehen und darauf achten, dass man nicht von den Windböen erfasst wird. Diese treten plötzlich auf und legen sich genauso schnell wieder, um einer scheinbaren Ruhe Platz zu machen.
In nur dreizehn Stunden erreichten wir mitten im Winter den Gipfel auf 6962Meter Höhe, den höchsten Punkt Süd- und Nordamerikas. Wir blieben etwa eine Viertelstunde dort, vielleicht auch ein bisschen länger. Diesen Moment wollten wir genießen, unsere erste Winterbegehung von Bedeutung, die uns völlig allein gelungen war! Vielleicht war es genau dieser Moment, in dem ich die Schönheit des Winteralpinismus entdeckte und meine Freude daran wahrnahm. Es war ein starkes, nicht zu leugnendes Gefühl, eine ganz andere Art des Kletterns zu genießen, bei der ich auf einem schon bekannten Berg eine neue Faszination und neue Schwierigkeiten entdecken durfte – einfach nur, indem ich in einer anderen Jahreszeit aufbrach.
Wenn man dort oben allein ist, kann man diese Gipfel und Panoramen mit einem zeitlosen Blick umfassen, der von der Wahrnehmung und Sichtweise anderer Bergsteiger unbeeinflusst ist – frei von ihren Spuren, ihren Geräuschen, ihrer Ausrüstung. Man wird sich bewusst, aus freiem Willen Teil einer rauen Welt zu sein, die jeglicher Bequemlichkeit und zugleich jeder Selbstverständlichkeit entbehrt, in der alles einen Sinn, einen Wert bekommt.
Am selben Abend und in derselben Nacht stiegen wir direkt zum Basislager ab und genossen die eisige Luft, die so rein und klar war, dass wir die Lichter von Santiago de Chile in 200Kilometer Entfernung schimmern sehen konnten. In jener Nacht sank die Temperatur auf minus 46Grad Celsius, aber ich kann mich nicht daran erinnern, unter dieser Kälte gelitten zu haben. Ich erinnere mich nur an schöne, angenehme Dinge, sowohl beim Auf- als auch beim Abstieg, und zusätzlich an die Freundschaft, die ich mit Lorenzo erleben durfte, sowie an die Menschen, denen wir in diesen zwei Monaten in Argentinien im Rahmen der Expedition begegneten.
Es war die zweite Expedition meines Lebens, und ich brachte zwei Winterbegehungen mit nach Hause: den Cerro Mirador und den Aconcagua, aber auch die Erkenntnis, dass mir die Kälte und der Winter verdammt gut gefielen. Vielleicht ahnte ich schon damals, dass mich diese Art von Alpinismus beständig locken und ich mir wünschen würde, mein Leben, meinen Alltag darauf auszurichten, aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages sogar ein Buch über meine Winterkarriere schreiben würde!
Zweifelsohne muss man bei dieser Art von Expeditionen genau auf jedes kleine Detail achten, um nicht nur lebend, sondern auch heil nach Hause zurückzukehren, ohne schreckliche Erfrierungen zu erleiden, die in Amputationen enden. Es handelt sich um wohlbekannte Risiken, die auch in günstigeren Jahreszeiten auftreten können, die aber bei jeder Winterbegehung sehr gegenwärtig sind, wo auch immer diese durchgeführt wird, ob in den Alpen oder am Everest. Deshalb muss sich jeder Einzelne rigoros, ja fast besessen an bestimmte Verhaltensregeln halten und Kontrollen durchführen, egal ob das die Ankunftszeit auf dem Gipfel betrifft, die ständige Überwachung der Geschwindigkeit oder Aktionen und Phasen am Berg, die auf gar keinen Fall aufgeschoben werden dürfen. Zudem müssen alle Entscheidungen unbedingt nach dem Verstand gefällt werden und nicht nach dem Gefühl oder aus einem Impuls heraus, denn diese sind oft vom Wunsch nach Erfolg und von Ehrgeiz verzerrt. Wenn man um jeden Preis siegen will, rettet man sich manchmal nur um Haaresbreite. Im schlimmsten Fall stirbt man.
Am Berg – vor allem in extremer Höhe – muss man nicht so sehr auf die anderen, sondern in sich hineinschauen, auf sich hören. In der Höhe gibt es keine starken und weniger starken Personen, sondern nur solche, denen es an diesem speziellen Tag gut oder schlecht geht. Ich könnte eine lange Liste von Hochgebirgs- und Expeditionsunfällen erstellen, die vorhersehbar waren, sowie von anderen Unfällen, bei denen das Schicksal die Hauptrolle spielte. Aber ich denke, dass der größere Anteil in die erste Kategorie fällt.
Bergsteigen bedeutet jedoch auch eine praktisch perfekte Form von Freiheit. Es ist nicht nur ein Sport, sondern vor allem auch eine Möglichkeit des Ausbruchs, der persönlichen Entdeckungsreise, der Erkundung, von Abenteuer und Kontemplation. Jeder kann das Bergsteigen also so ausüben, wie er will, auch indem er »Fehler« macht und scheinbar unlogische Entscheidungen trifft, jedoch immer unter der Voraussetzung, dass diese Entscheidungen keine anderen Menschen in etwas mit hineinziehen, was sie gar nicht wollen, oder mit ins Unglück reißen. Ich bin es leid, Urteile oder Bewertungen abzugeben: Es existiert keine absolute Wahrheit, keine »richtige« Ethik, keine »wahre« Art des Bergsteigens. Auch ich bin manchmal – und das war sicherlich ein Fehler – in die Falle getappt und habe Definitionen geliefert. Rückfällig will ich nun wirklich nicht werden. Das ist auch der Grund, warum ich von meinen Winterbegehungen auf eine sehr persönliche Art und Weise erzähle, als wären sie mein Gesicht oder mein Personalausweis. Es gibt kein Besser oder Schlechter, Richtig oder Falsch. Jeder hat seine eigene Ansicht und das Recht, sie zu erzählen.
Über den Winteralpinismus zu sprechen bedeutet für mich nicht, Urteile über andere Arten der Begehung in anderen Jahreszeiten abzugeben. Bergsteiger haben seit jeher die Tendenz, einander zu zerfleischen, oft nur wegen Nichtigkeiten oder weil sie sich in Dinge einmischen, die sie nichts angehen. Ich hoffe, die Härte des Winters hebt diese Tendenz bei mir sowohl in den Bergen als auch in diesem Buch auf.
Nanga Parbat, 6.–8.Januar 2012
ERKUNDUNG UND AKKLIMATISIERUNG ZWISCHEN BASISLAGER (4230 M) UND LAGER 1 (5250 M)
Wir sind hier sehr motiviert, die Wartezeiten sind lang und werden es weiterhin sein. Ich nutze die Zeit, um an meinem nächsten Buch weiterzuschreiben, das ich eigentlich in wenigen Tagen abgeben müsste …
Heute hatten wir sogar die Gelegenheit, uns zu rasieren und ein bisschen in Ordnung zu bringen. Dann folgte ein weiterer Tag, an dem wir zwischen Basislager und der Wand des Nanga Parbat in der Nähe von Lager 1 hin und her liefen.
Während unseres Marsches lösten sich zahlreiche Lawinen. Der Schnee gab nach, und auch unter unseren Füßen zerbrachen kleinste, eigentlich unbedeutende Schollen, die jedoch zeigten, wie instabil die frische Schneedecke war. Eine Lawine, die rechts von uns abging, machte uns klar, dass wir unnötige Risiken eingingen. An einer sicheren Stelle errichteten wir ein Materiallager und gingen zum Basislager zurück.
Heute haben wir endlich wieder für ein paar Stunden die Sonne gesehen. Wie sich dadurch das Leben verändert! Ich wollte, ich könnte erklären, wie wichtig die Sonne ist, vor allem für die Psyche.
IM NAMEN ANATOLIS
MOUNT EVEREST UND PIK MARMORWAND
Nach der positiven und motivierenden Erfahrung am Aconcagua im Winter 1993 intensivierte ich, zumindest außerhalb der Sportklettersaison, zwischen einer Expedition und der nächsten meine Eiskletteraktivitäten in den Alpen. Dabei begeisterte ich mich besonders für die Begehung von Eisfällen. Diese neue Art der Klettertechnik sollte mir später noch sehr zugutekommen: Die alpinistische – und damit auch mentale – Vielseitigkeit half mir sowohl als Bergführer als auch in vielen Situationen in extremer Höhe.
Am Alpinismus bin ich tatsächlich gewachsen. Als Mensch konnte ich meinen beruflichen und kulturellen Horizont erweitern. Durch das Bergsteigen hatte ich außerdem die Gelegenheit, viele Leute kennenzulernen, Freundschaften zu schließen, auch einzigartige Bindungen einzugehen. Am wichtigsten war mit Sicherheit die Begegnung mit Anatoli Boukreev, mit ihm verband mich die intensivste aller Freundschaften, die ich in der Höhe erlebt habe. Von ihm habe ich schon viel erzählt, in Artikeln, in meinem letzten Buch, in zahlreichen Interviews, die ich gegeben und in denen ich die entsprechenden unvermeidlichen Fragen beantwortet habe. Ich will mich also nicht in einer Art fortwährender Seligsprechung Anatolis verlieren, sondern ihm hier nur einige Zeilen widmen. Denn auf die erste winterliche Erfahrung am Aconcagua folgte jene tragische in der Annapurna-Südwand, in der Seilschaft mit ihm und Dimitri Sobolev.
Von dieser Winterexpedition habe ich schon erzählt. Damals kehrte nur ich nach Hause zurück, Anatoli und Dimitri blieben für immer verschwunden. Man fand nicht einmal mehr ihre Leichname, sie waren unter Tausenden von Kubikmetern Schnee und Eis begraben, ein tonnenschweres Grab, das auf wundersame Weise nur mich verschont hatte. Auch ich wurde von dieser eisigen Masse 800Meter tief mitgerissen. Sie hatte sich in 6300Meter Höhe gelöst, genau an der Stelle, auf die Anatoli ein paar Tage zuvor gezeigt hatte, als ich ein Foto von ihm schoss. Ich wurde nicht bewusstlos, ich erinnere mich an jeden Augenblick, ich wusste, dass Anatoli und Dimitri mit mir nach unten stürzten. Ich landete in Wandmitte auf dem einzigen Vorsprung, der meinen Absturz aufhalten konnte, anstatt weitere 1000Meter gnadenlos nach unten zu fallen. Es war, als ob uns eine gigantische Welle erfasst, mitgerissen und hin und her gewirbelt hätte. Nur ich tauchte wieder daraus auf, mit Schwellungen, Blutungen und Schürfwunden, ich war an den Händen und an einem Bein schwer verletzt. Von der Gewalt der Lawine fast entkleidet und bis zum Knie im Schnee steckend, fand ich mich sitzend mit Blick zum Tal wieder. Stille, nur Stille … Dann Kälte, Zittern … Ich schreie die Namen meiner beiden Gefährten, erneut, immer wieder und wieder. Nichts.
Mein erster Versuch der Winterbegehung eines Achttausenders endete auf diese Weise. In 5500Meter Höhe gestrandet, musste ich ans nackte Überleben denken. Ich stieg den Berg fast 1,5Kilometer ab, physisch und psychisch wie tot. Es war Weihnachten, niemand wusste genau, wo wir waren, wir hatten keinerlei Kommunikationsmittel dabei und waren vom Rest der Welt abgeschnitten, denn es lagen mehr als zwei Meter Schnee. Der Energieaufwand, den ich leisten musste, um zu überleben und nach Hause zurückzukehren, gehört zu den extremsten Erfahrungen, die ich bei meinen Unternehmungen gemacht habe. Noch heute kann ich es kaum glauben, dass ich all das, was außerhalb von mir sowie in meinem Innern geschah, aushalten und mich völlig auf mich allein gestellt retten konnte.
Aus diesem Erlebnis bin ich jedoch äußerst einsam hervorgegangen, ohne Anatoli, den engsten Freund meines Lebens, den mir niemand ersetzen kann. Ich war kurz davor, meine Begeisterung, unsere Projekte, all das, wofür ich mich eingesetzt, wovon ich immer geträumt, was ich für möglich gehalten hatte und wovon ich erste Ergebnisse sehen konnte, unter jener Lawine zu begraben.
Nach einem so heftigen Schicksalsschlag hätte ich auf zwei ganz verschiedene, einander entgegengesetzte Arten reagieren können. Ich hätte alles hinwerfen und mich ganz in der Erinnerung, im Gedenken verlieren können, dabei weiter Schuld empfinden und tausend Thesen darüber aufstellen können, was gewesen wäre, wenn. Oder aber die Einsicht haben können, dass selbst die vielversprechendste aller Existenzen nie ausschließlich nach unseren Wünschen gestaltet werden kann, weder nur aus Glück besteht noch gegen Probleme immun ist, als sei sie von der Wirklichkeit getrennt. Im Leben siegt man, stirbt man, liebt man, man streitet sich, steckt Niederlagen ein, unterliegt und fängt wieder von vorn an. Der Alpinismus ist Leben, ist Liebe, ist Aktion, weshalb er natürlich allen unvorhersehbaren Variablen des Lebens unterworfen ist.
Nach der Annapurna musste ich schlichtweg weitermachen, um nicht zu sterben, um den Anstrengungen und Träumen, für die ich gearbeitet und an die ich geglaubt hatte, einen Sinn zu geben. Aus diesem Grund entschied ich mich, meine Abenteuer in den Bergen fortzusetzen. Die vertikale Welt war nicht Sinn und Zweck meiner Existenz, sondern das Mittel, durch das ich innerlich wuchs, die Welt entdeckte und den unbekanntesten und spannendsten Teil des Lebens erkundete: mich selbst. Den Alpinismus aufzugeben hätte für mich bedeutet, auch mit der Selbsterkundung aufzuhören, etwas, was ich nicht akzeptieren wollte und konnte.
Die Freundschaft mit Anatoli hatte mir eine Menge Fragen ohne Antwort hinterlassen, eine große Neugier, die es zu befriedigen galt, und vor allem eine lange Liste gedanklich schon geplanter Besteigungen. Insbesondere wollte ich sein Land kennenlernen, seine Freunde, die Kultur des Ostens, die Kultur jener Sowjetunion, die nicht mehr existierte, in der Anatoli jedoch geboren, aufgewachsen und zum Mann, Sportler und schließlich Bergsteiger geworden war. Während ich in der Welt unterwegs war, waren mir in der Tat »Einzelteile« dieser zersplitterten kommunistischen Realität begegnet, Menschen und Mittel, die dazu bestimmt oder »erworben« worden waren, um im Ausland das fortzusetzen, was in der Ex-Sowjetunion nicht möglich gewesen wäre. In den Bergregionen war ich vor allem mit hervorragenden russischen Helikoptern und Piloten in Kontakt gekommen. Ich erinnere mich, dass es bei jener tragischen Winterexpedition 1997 zur Annapurna der phantastische russische Pilot Sergej Danilov war, der uns mit einer spartanischen, aber enorm leistungsfähigen Mi-17-Maschine zum Basislager auf 4200Meter brachte.
Vielleicht war es bei dieser Gelegenheit, dass ich mich für Hubschrauber zu begeistern und ihre Vielseitigkeit wie ihren Nutzen zu schätzen begann. Vielleicht ist diese Begeisterung, die dann in mir weitergewachsen ist und mich fast dreizehn Jahre später dazu gebracht hat, Pilot zu werden und Hilfseinsätze im Himalaja zu fliegen, gerade durch Sergej entstanden. Wieder einmal war es ein Russe, dem ich den Anstoß dazu verdankte, meinen Horizont zu erweitern und mich einer neuen Leidenschaft, einer neuen Arbeit zu widmen, nämlich der des Hubschrauberpiloten, die heute ein immer wichtigerer Teil meines täglichen Lebens zu werden scheint. Aus einer seltsamen Laune des Schicksals heraus sollten es ausgerechnet die Annapurna und ein anderer russischer Pilot sein – ich erinnere mich nur an seinen Vornamen, Flugkapitän Alexander –, die mir 2004 den letzten, wohlwollenden Impuls hierzu gaben.
Ich kehrte zur Annapurna zurück, um zusammen mit Denis Urubko den Gipfel erneut zu versuchen, auch er ein Russe mit kasachischer Staatsangehörigkeit, genau wie Anatoli (ein Zufall?). Wir kamen von einer faszinierenden Erstbesteigung des Kali Himal, des Nordgipfels des Baruntse, wo wir zusammen mit unserem unvergesslichen dritten Gefährten, Bruno Tassi »Camos«, eine neue Route von 2000Meter Höhe im Alpinstil eröffnet hatten. Unser Plan war, zum Basislager auf der Nordseite der Annapurna zu fliegen, denn der Winter war schon weit fortgeschritten und wir sehr gut akklimatisiert. Am Abend zuvor hatte ich mich mit Alexander getroffen. Nach dem Abendessen, bei dem es Fisch gab und viele Flaschen Wein (und Wodka) auf dem Tisch standen, sagte er zu mir: »Morgen fliegst du, du weißt ja sowieso besser als ich, wo du hinfliegen musst!«
Da mir das ein typischer Satz eines weinseligen Abends zu sein schien, maß ich diesen Worten keinerlei Bedeutung bei. Tags darauf jedoch, wir waren gerade vom Flughafen der nepalesischen Stadt Pokhara gestartet, rief Alexander mir zu: »Also, wie steht’s? Machst du einen Rückzieher?«
Daraufhin ich: »Nein, nein, wenn du mich lässt, versuche ich es wirklich.«
»Natürlich lasse ich dich, das habe ich dir gestern Abend schon gesagt!«
Alexander ließ den Kopiloten aufstehen, ich setzte mich auf dessen Platz, nahm die Schalthebel in die Hand und ließ mich von Alexanders wenigen, knappen Anweisungen führen.
Schließlich sagte Alexander: »Perfekt, so ist es gut. Ich sehe schon, du begreifst schnell! Jetzt fliegst du zum Basislager. Gib mir Bescheid, kurz bevor wir da sind!« Und damit drehte er sich um und fing an, mit dem Bordingenieur und dem Kopiloten zu sprechen.
Unglaublich, nur ein russischer Pilot konnte so verrückt sein, mir einen 7,5Tonnen schweren, voll beladenen Riesenvogel anzuvertrauen! Gewiss, er saß an der Steuerung und war bereit, sofort einzugreifen, wenn es die Situation erforderte, aber ich spürte die Verantwortung, die so plötzlich, von einer Sekunde zur nächsten, auf mir lastete.
Der Flug war atemberaubend, von oben schaute ich auf Berge hinab, die ich bis dahin nur auf Fotos oder von unten, bei meinen Märschen entlang der Talsohle, gesehen hatte. Einige hatte ich auch aus der Ferne vom Gipfel anderer hoher Berge aus erblickt, aber direkt neben und zwischen ihnen hindurchzufliegen wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis. Alles ging glatt. Nach diesem Flug wusste ich, dass dies meine zweite große Leidenschaft werden würde. Seit Längerem schon wollte ich etwas für die Leute in Nepal tun. Die Idee, einen Hubschrauberrettungsdienst zu schaffen, den man in diesem Land dringend brauchte, fand ich sofort ziemlich aufregend. Ich hatte am eigenen Leib erfahren, wie wichtig der Helikopter als Transportmittel war: Einer von ihnen hatte mir am Ende jenes waghalsigen Abstiegs nach der Lawine von 1997 das Leben gerettet, und oft hatte ich auch die Lasten meiner Expeditionen mit Hubschraubern transportiert, wenn die Träger es nicht tun konnten. Helikopter konnten außerdem zu grundlegenden Voraussetzungen werden, um Wasserkraftwerke zu bauen, um sehr große und schwere Materialien zu transportieren, um alte Menschen, Verunglückte oder Bergsteiger schnell zu evakuieren.
Kurz und gut, mit den Russen, den Sowjetbürgern oder wie man sie auch immer nennen will, bin ich immer gut zurechtgekommen. Man denke bloß nicht, dass sie – wie es uns das Kino und die Westpropaganda glauben machen wollten – immer die »Bösen« waren. Es ist einfach wahr, dass es immer besser ist, die Welt, die Wirklichkeit, selbst zu entdecken, als sich auf die Erzählungen anderer zu verlassen.
Natürlich darf man sich von Russen nicht allzu viel Höflichkeit, Förmlichkeit oder Verbindlichkeit, politisch korrekte Äußerungen oder andere eher »weiche« Gesten erwarten. Aber für meinen Charakter und für die Situation in extremen Höhen sind sie, denke ich, der beste Menschenschlag, mit dem man sich umgeben kann, vor allem wenn man sich eine Winterbegehung oder eine schwierige Besteigung vorgenommen hat. Wenigstens schauen sie dir in die Augen, wenn sie dich dahin schicken, wo der Pfeffer wächst, und tun das nicht hinter deinem Rücken.
Gerade wegen dieses besonderen Gefühls, aber auch wegen der vielen Fragen, die seit Anatolis Tod unbeantwortet geblieben waren, entschied ich mich, eineinhalb Jahre nach der Tragöde von 1997 in den Pamir und den Tienschan zu gehen. Ich wollte in einer einzigen Saison das Projekt »Schneeleopard« realisieren und mich zwischen Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan bewegen. Der Schneeleopardenorden war eine Auszeichnung, die zu Zeiten der Sowjetunion denjenigen verliehen wurde, die im Laufe ihrer Karriere die fünf Siebentausender der ehemaligen UdSSR bestiegen hatten: den Pik Lenin, den Pik Kommunismus (heute Pik Ismoil Somoni), den Pik Korschenewskaja, den Khan Tengri und den Pik Pobeda. Die Idee, die ich zusammen mit Anatoli entwickelt hatte und die ich nun im Sommer 1999 in die Tat umsetzen wollte, war, einen alpinistischen Marathon in einer einzigen Expedition durchzuführen, auch wenn ich mir der logistischen und politischen Schwierigkeiten bewusst war, die drei unabhängige Staaten, in denen es nicht immer ruhig zuging, mit sich bringen konnten.
Dieses phantastische Abenteuer – eine der schönsten Expeditionen meines Lebens – hätte es verdient, in einem eigenen Buch beschrieben zu werden. Ich nahm es mir zusammen mit Denis Urubko vor, und er war die schönste Antwort, die ich bei jener Expedition im Jahr 1999 fand. Ein neuer, anderer Anatoli Boukreev, seit damals mein brüderlicher Seilschaftsgefährte, im Alpinismus wie auf Expeditionen. Ich lernte ihn in diesen Bergen kennen, unter den Bekannten von Anatoli. Die Freundschaft entstand nicht unmittelbar, blitzartig und auf den ersten Blick, sondern im Laufe der zwei Monate des Projekts »Schneeleopard«, in denen wir uns »beschnupperten«, kennenlernten und verstanden. Bis heute verbindet uns eine tiefe, einzigartige Freundschaft.
Nach dieser wunderschönen Erfahrung von 1999 war ich wieder voll und ganz ich selbst. Von der Lawine von 1997 und vom Verlust meines engsten Freundes hatte ich mich erholt. Ich war wieder fröhlich und positiv gestimmt, ich hatte Lust, an der Stelle, wo alles stehen geblieben war, neu anzufangen: im Winter, in großer Höhe, mit einem kasachischen Seilgefährten und dem starken Wunsch, einen explorativen Alpinismus zu betreiben und nicht einen, bei dem man Gipfel nur besteigt, weil man sie »sammelt«.
Im Jahr 2000 lud ich Denis zum ersten Mal ein, mit mir nach Nepal zu kommen, um den Everest zu versuchen, und er bekam seinen ersten kasachischen Pass mit der Reiseerlaubnis. Es wurde eine ganz besondere Expedition. Am 24.Mai stiegen wir zusammen auf den höchsten Berg der Erde, nachdem wir vier Nächte auf über 8000Meter verbracht hatten. Dort oben, auf Höhe des letzten Lagers, war unser Proviant fast aufgebraucht. Der windumtoste, auf der Grenze zwischen Nepal und Tibet gelegene Südsattel ist so groß wie zwei Fußballfelder. Sich in solchen Höhen so lange Zeit ohne zusätzlichen Sauerstoff aufzuhalten schwächt Körper und Geist auf dramatische Weise.
Außerdem besteht die Gefahr, dass einem dort Nahrung und Gas ausgehen. Deshalb zogen wir los und stocherten zwischen den Gaskartuschen und Lebensmittelresten herum, die von früheren Expeditionen zurückgelassen worden waren. Ich erinnere mich an den Käse, den ich fand, und habe noch deutlich das Etikett mit der Aufschrift »Neuseeland« vor Augen. Wer weiß, seit wann dieser Käse dort lag … Gierig verschlang ich ihn allein, dann schauten Denis und ich, dass wir heißen Tee zu trinken bekamen. Nach wenigen Stunden musste ich mich jedoch übergeben, ich fühlte mich hundeelend. Die dunkle Farbe des Erbrochenen erschreckte mich, ich fürchtete, Blut zu erbrechen. Wahrscheinlich war es jedoch nur Gallenflüssigkeit, die mit hochkam. Denis machte sich Sorgen, er verließ das Zelt. Es gelang ihm, von einer kommerziellen Expedition eine Sauerstoffmaske und eine halbe Sauerstoffflasche auszuleihen.
Für ein paar Stunden setzte ich die Sauerstoffmaske auf. Dann kam gegen Mitternacht der Zeitpunkt, zu dem wir beschlossen hatten, uns in Richtung Gipfel aufzumachen. Die Maske war aus Plastik und meines Erachtens wenig für diese große Höhe geeignet. Nachdem ich das Zelt verlassen hatte und langsam nach oben stieg, spürte ich bald nur noch wenig vom positiven Effekt des künstlichen Sauerstoffs. Ich dachte, es würde mit meinem geschwächten Zustand zusammenhängen, und biss die Zähne zusammen. Von Anfang an hatte ich die Anzahl der Schritte, die ich hintereinander machen konnte, und die Dauer der Pausen im Blick. Ich versuchte also, meine Geschwindigkeit und meinen Gesundheitszustand zu kontrollieren, indem ich mich auf diese einfachen, aber sicheren Signale verließ. Ich war bereit zu leiden und einen Schritt nach dem anderen zu tun, aber nur unter der Bedingung, dass dies bei einer konstanten Geschwindigkeit und einem gleichmäßigen Rhythmus zu realisieren war, sodass ich den Gipfel ohne Verzögerungen im anvisierten Zeitraum erreichen konnte.
Ab einer Höhe von 8400Metern fiel ich etwas hinter Denis zurück, aber ich behielt eine akzeptable Geschwindigkeit bei. Das Wetter wurde jedoch deutlich schlechter, die Sicht immer eingeschränkter und der Wind heftiger. Ich hatte die Situation noch im Griff, es war mir irgendwie gelungen, trotz kurzem Atem gleichmäßig vorwärtszukommen. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Normalerweise lassen, wenn man langsamer wird und trotzdem weiter nach oben steigt, die Kräfte immer deutlicher nach, man wird immer benebelter im Kopf, und die Pausen werden länger. Doch nichts dergleichen geschah: Es blieben nur der kurze Atem und jener unerbittliche Rhythmus von zehn gleichmäßigen Schritten und einer Pause von dreißig Sekunden, in der ich so viel wie möglich zu atmen und neue Kraft für die nächsten zehn Schritte zu sammeln versuchte.
Ich dachte auch, die Sauerstoffflasche würde bald leer sein, da ich sie schon nachts verwendet hatte und nunmehr seit vier Stunden nach oben stieg. Unterhalb des Südgipfels auf fast 8700Meter Höhe begriff ich endlich was los war: Der durchsichtige Schlauch von der Flasche zur Maske war voller Eis, vor allem in dem Abschnitt nahe an meinem Mund. Der Sauerstoff war wahrscheinlich schon seit Längerem ausgegangen und mein kondensierter Atem zu Eis geworden, das den Schlauch verstopfte. Ich stieg also mit einer Maske über Nase und Mund auf, die nicht nur keinen Sauerstoff lieferte, sondern es auch fast unmöglich machte, die Außenluft zu atmen. Als ich das bemerkte, versuchte ich den Schlauch zu biegen und das Eis darin zu zerschlagen. Die Maske hatte wenigstens den Vorteil, mein Gesicht vor den Windstößen zu schützen und für »feuchte« Luft zu sorgen, die ich lieber einatmete als die trockene, kalte Luft von außen. Ab und zu versuchte ich sie abzusetzen und tief zu atmen, aber dann setzte ich sie wieder auf, um erneut die Wärme im Gesicht zu spüren. Ich hatte keine Neoprenmaske oder irgendetwas aus Stoff dabei, was ich stattdessen über den Mund hätte ziehen können. Der Gipfel war inzwischen nahe. Plötzlich erschien Denis vor mir, er war ohne zusätzlichen Sauerstoff auf dem Gipfel des Everest gewesen und hatte mit dem Abstieg begonnen. Ich erinnere mich noch an seinen erstaunten Blick und seine Worte: »Wow, Simone! Du bist hier? Großartig, los, weiter geht’s! Der Gipfel ist gleich da oben! Ich dachte, du seist schon vor Stunden umgekehrt, aber stattdessen … Was soll ich tun? Wenn du willst, warte ich hier auf dich, und wir steigen gemeinsam ab.«
Ich nahm die Maske ab und lächelte ihn an. »Ciao, Denis, beruhige dich, mir geht’s gut. Die Maske ist komplett vereist, Mist, und ich habe das nicht kapiert! Seit Stunden habe ich nur mit Mühe atmen können … Steig ruhig ab, ich gehe nach oben, mache ein paar Fotos und komme dann nach. Wir sehen uns am Zelt beim Südsattel. Aber du könntest schon mal heißen Tee machen, während du auf mich wartest.«
Nach ein paar Minuten erreichte ich den Gipfel. Ich war völlig allein. Dann tauchten plötzlich zwei völlig eisverkrustete Sherpas ohne »Kunden« auf. Es war neblig, man konnte nur ein paar Meter weit sehen. Aber ich machte mir keine Sorgen, weil bis zum Südsattel Sicherungsseile fixiert waren, eine Form von Ariadnefaden, der den Weg nach unten wies. Der Südostgrat des Everest ist zudem ganz einfach – unter diesen Bedingungen war es unmöglich, sich zu verlaufen. Auch der Wind hatte sich inzwischen gelegt, und es waren Wolken aufgezogen.
Für uns beide war es das erste Mal auf dem Everest. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, auf andere Weise dorthin zu kommen, aber schließlich hatten wir vier Nächte ohne zusätzlichen Sauerstoff auf 8000Meter verbracht, und ich wusste jetzt, was ich schaffen konnte, etwas, das mir in den darauffolgenden Jahren noch sehr nützlich werden sollte.
Ende der Leseprobe