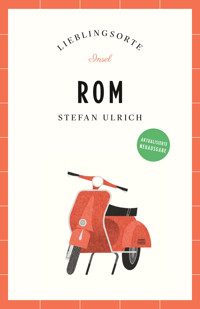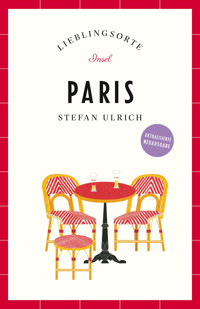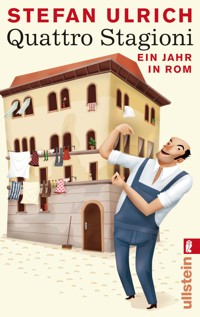8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Münchner Rechtsanwalt Robert Lichtenwald verkauft seine Kanzlei, um in sein Landhaus in der Toskana zu ziehen und dort ein freies, unbeschwertes Leben zu genießen. Als seine Freundin, die temperamentvolle Journalistin Giada Bianchi, plötzlich verschwindet, befürchtet er das Schlimmste. Die Suche nach ihr führt Lichtenwald nach Rom und auf die Spur eines mysteriösen Verbrechens: Ein reicher Kunstsammler ist in seiner Wohnung verstümmelt und getötet worden. Dem Gerücht nach war er im Besitz der einzigen noch existenten antiken Statue des Adonis. Hat Giadas Verschwinden mit dem Mord zu tun? Und wie steht das grausige Schicksal der jungen Römerin Donatella Fortunata damit in Verbindung? Die Recherche zieht Lichtenwald immer tiefer hinein in die morbiden Geheimnisse der schönheitsverliebten Stadt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Der Autor
Stefan Ulrich, geboren 1963, verbrachte als Korrespondent der »Süddeutschen Zeitung« je vier Jahre in Rom und Paris. Heute lebt er mit Frau, Tochter und Sohn wieder an der Isar. Er arbeitet im Ressort Außenpolitik der »Süddeutschen Zeitung« — und schreibt weiterhin am liebsten über Italien. Seine Bücher »Quattro Stagioni« (2008), »Arrivederci, Roma!« (2010) und »Bonjour la France!« (2013) erschienen im Ullstein-Verlag, Berlin, und wurden allesamt zu »SPIEGEL«-Bestsellern. »Quattro Stagioni« wurde außerdem fürs Fernsehen (ARD/Arte) verfilmt.
Das Buch
Der Münchner Rechtsanwalt Robert Lichtenwald verkauft seine Kanzlei, um in sein Landhaus in der Toskana zu ziehen und dort ein freies, unbeschwertes Leben zu genießen. Als seine Freundin, die temperamentvolle Journalistin Giada Bianchi, plötzlich verschwindet, befürchtet er das Schlimmste. Die Suche nach ihr führt Lichtenwald nach Rom und auf die Spur eines mysteriösen Verbrechens: Ein reicher Kunstsammler ist in seiner Wohnung verstümmelt und getötet worden. Dem Gerücht nach war er im Besitz der einzigen noch existenten antiken Statue des Adonis. Hat Giadas Verschwinden mit dem Mord zu tun? Und wie steht das grausige Schicksal der jungen Römerin Donatella Fortunata damit in Verbindung? Die Recherche zieht Lichtenwald immer tiefer hinein in die morbiden Geheimnisse der schönheitsverliebten Stadt.
Stefan Ulrich
In Schönheit sterben
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage August 2018 (1)© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: Getty Images / © Joel AdamsSatz: Pinkuin Satz und Datentechnik, BerlinE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-1785-4
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Epilog
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Hinweis
Die Personen und die Handlung im Buch sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
Motto
»Unser Körper ist unser Gartenund unser Wille der Gärtner.«
William Shakespeare
Prolog
Die Männer schwitzten unter ihren Motorradhelmen. Nicht vor Aufregung. Es war nicht der erste Auftrag solcher Art. Doch die Hitze in Rom war in diesem August noch unerträglicher als in anderen Jahren. Tagsüber überwölbte eine weißgraue Schicht aus Dunst und Abgasen die Stadt wie eine Treibhauskuppel. Und selbst jetzt, weit nach Mitternacht, kühlte es kaum ab. Straßen und Häuser gaben die Hitze wieder ab, die sie tagsüber aufgesaugt hatten. »Wir sind gleich da«, sagte Gianluca, der Ältere der beiden, der auf dem Soziussitz saß. Simone nickte und bog nach rechts auf den Ponte Testaccio ab. Unter ihnen floss schwarzgrün und faulig der Tiber Richtung Meer. Am anderen Ufer fuhr Simone an den ranzigen Gebäuden der ehemaligen Schlachthöfe vorbei und dann die Via Beniamino Franklin und die Via di Monte Testaccio am Fuß eines mit Bäumen und Gestrüpp bewachsenen Hügels entlang.
Als er den Hügel umrunden wollte, boxte ihn Gianluca in die Seite: »Idiot! Willst du direkt vor dem Lokal parken? Damit wir auch ja erwischt werden?« Simone sagte nichts, stellte die Maschine jedoch neben einer Bushaltestelle ab. Zu Fuß gingen sie weiter. Die Straßenlaternen spendeten ein fahlgelbes Licht, das mehr zu verbergen als zu erleuchten schien. Autos kurvten auf der Suche nach einem Parkplatz herum. Aus den Clubs, die sich hier am Monte Testaccio, dem Scherbenberg, eingenistet hatten, wummerte Techno und Hip-Hop. Abfall quoll aus grünen, verbeulten Müllcontainern. »Scheiße«, sagte Simone, als er etwas Weiches, Klebriges unter seinem Turnschuh fühlte.
Vor ihnen tauchte die Trattoria da Mori auf. Sie durchquerten das Tor und den Innenhof. Das Lokal hatte schon geschlossen, doch drinnen brannte noch Licht. Sie kannten diese Trattoria gut, so wie alle Männer aus der Gegend. Und darüber hinaus. Wegen Rubina, der göttlichen Rubina. Wahrscheinlich richtete sie gerade mit ihrem Vater die Tische für den nächsten Tag her. Gianluca legte den Finger auf den Mund. Sie lugten durch eines der kleinen, halb von wildem Wein überwachsenen Fenster. Der mit dunklem Holz getäfelte Gastraum war nur noch schwach erleuchtet. An den Wänden hingen unzählige Schwarz-Weiß-Fotografien schöner Römerinnen. Gianluca grinste. Er wusste, dass Acilio Mori all diese Fotos aufgehängt hatte, damit sie vor der phänomenalen Schönheit seiner Tochter verblassten.
Und da war sie. Mit dem federnden Schritt einer Balletttänzerin lief Rubina zwischen den Tischen hindurch. Sie trug – wie üblich, wenn sie im Lokal aushalf – ein weißes Herrenhemd, das sie vor dem Bauchnabel zusammengeknotet hatte. In der rechten Gesäßtasche ihrer engen, ausgewaschenen Jeans steckten noch Block und Stift.
Gianluca starrte auf ihre gewölbten Hüften. »Che razza di culo!«, entfuhr es ihm. »Was für ein Wahnsinnsarsch!«
Simone musterte das Gesicht der jungen Frau, während sie Gläser und Besteck auf die Holztische stellte. Die gewölbte Stirn, die geröteten Wangen, die schmalen, hoch geschwungenen Augenbrauen, pechschwarze Wimpern um mandelförmige Augen. Smaragdgrüne Augen, wie er wusste. Aber das war jetzt nicht zu sehen. Und dann diese granatroten Lippen, um die ein spöttisches Lächeln zu tänzeln schien. Wie eine dieser Madonnen, die ihnen die Lehrer in Florenz auf einem Klassenausflug gezeigt hatten. Simone wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Scheißjob«, murmelte er.
Traumjob, dachte Gianluca. Dann drückte er die Klinke der Tür. Abgeschlossen. Er hämmerte mit der Faust gegen das Holz und rief: »Mach auf! Wir haben Hunger!«
Es klackte ein paarmal, die Tür wurde aufgerissen, und Acilio Mori stand vor ihnen. Ein kleiner, fast kahlköpfiger Mann mit fleckiger Schürze über dem Bäuchlein. Gianluca musterte ihn verächtlich. Von diesem Männlein diese Tochter! Die Wege des Herrn waren unergründlich.
»Was wollt ihr?«, brummte Mori. »Wir haben geschlossen.«
»Und wir sind hungrig.« Gianluca zog mit der Rechten seine Beretta aus der Tasche und hielt dem Wirt den Lauf unter die Nase. »Aber nicht auf deine Pasta …«
Mori stemmte die Hände in die Hüften und versperrte den Eingang. »Ihr schäbigen Wichser! Ihr wisst, dass ihr mir keine Angst einjagen könnt.« Er spuckte vor ihnen auf den Boden. »Sagt eurem Boss, er kann mich mal! Ein Mori zahlt kein Schutzgeld.«
Gianluca grinste und zischte: »Dann zahlt er eben mit seiner Tochter.« Dabei schubste er mit der Linken Mori zurück in den Gastraum und immer weiter, bis der Wirt mit dem Rücken zur Bar stand. Simone ging ihnen nach und schloss die Tür ab.
Rubina kam hinter dem Tisch hervor, den sie gerade deckte, und schrie: »Was wollt ihr? Lasst meinen Vater in Ruhe!« Ihr Gesicht stand in Flammen. Sie sah hinreißend aus.
Gianluca scheuchte das Mädchen mit einem Wink seiner Beretta zurück und ließ den Blick durchs Lokal schweifen. Früher war es eine Arbeiterschenke gewesen, von der mehrere Generationen der Familie Mori mehr schlecht als recht gelebt hatten. Dann kam Rubina – und änderte alles. Ihre Schönheit lockte erst die Burschen des Testaccio-Viertels an, dann die Schickeria aus der ganzen Stadt. Und die Kasse hörte abends, wenn Rubina kellnerte, nicht mehr auf zu scheppern. Dann wurde die Mafia darauf aufmerksam, dass das einfache Lokal plötzlich satte Gewinne einfuhr. Es war nur fair, dachte Gianluca, dass der Don seinen Anteil an diesem Boom wollte. Doch Mori, dieser Starrkopf, weigerte sich zu bezahlen. Seine Vorfahren hätten das auch nicht getan, hatte er gesagt. Nie werde er zulassen, dass la piovra, die Krake, wie er die Clans nannte, an der Schönheit seiner Tochter abkassiere. Was für ein Scheißargument. Gianluca lachte auf. Der alte Mori wusste nicht, wen er da herausforderte. Zum Glück. Sonst hätte er, Gianluca, Rubina niemals vögeln können.
Er hielt dem Wirt die Pistole an die Schläfe, damit Simone ihn an die gusseiserne Säule neben der Bar binden konnte, einem Beutestück aus einer verfallenen Schlachthofhalle. Simone zog ein Seil aus seinem Rucksack und schnürte es so fest um die Säule und den Bauch des Wirts, dass dieser aufschrie. Gianluca stellte sich dicht vor den kleinen Mann und spuckte ihm ins Gesicht. »Du glaubst, dass du etwas Besseres bist, nur weil deine Kleine die Eier der Burschen zum Kochen bringt? Du wirst gleich sehen, was du davon hast. Und«, seine Stimme wurde leise und sanft, »wenn du danach nicht zahlst, kommen wir wieder und bringen noch unsere Freunde mit …«
In diesem Moment schnellte Rubina zur Theke und stürzte sich auf Gianluca. »Lass meinen Vater in Ruhe!«, schrie sie und hieb ihre Fingernägel in seine Schulter. Gianluca schüttelte sie mit einer raschen Bewegung seines Oberkörpers ab. Zappelnd lag sie unter ihm am Boden. Er zielte mit seiner Beretta auf ihren Kopf und schrie: »Gib Ruhe, oder ich schick dich zur Hölle!« Dann schnauzte er seinen Begleiter an. »Halt das Mädel fest!«
Scheißjob, dachte Simone wieder, während er in das wutverzerrte Gesicht des schönsten Mädchens blickte, das er je gesehen hatte. Widerstrebend ging er hinter sie, um sich auf ihre Oberarme zu knien. Der Geruch des Hundekots, der von seinem Turnschuh aufstieg, brachte ihn zum Würgen. »Halt still«, krächzte er ihr zu, »dann geht es schneller vorbei.«
Doch Rubina hielt nicht still. Mit der Wut der Verzweiflung stieß sie mit den Beinen um sich. Gianluca schien das zu amüsieren. Er knöpfte sich provozierend langsam seine karierten Shorts auf. Dann ließ er sich auf ihre Beine sacken, riss ihre Jeans auf und zerrte sie ihr samt Slip von den Hüften. Rubina starrte auf das AS-Roma-Medaillon, das er um den Hals trug, und brüllte heraus, was ihr an Schimpfwörtern durch den Sinn fuhr: »Scheißkerl! Hurensohn! Hundebastard!« Gianluca grinste. Er ließ sich nach vorn auf ihre Brust sinken, legte die Pistole zur Seite und griff mit der Rechten nach unten. Er stieß seine Hüften nach vorne, einmal, zweimal, und dann immer weiter, während Rubina schrie und Simone den Kopf zur Seite wandte. Gianluca versetzte dem Mädchen einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht. »Halt’s Maul, Schlampe!« Dann machte er weiter, berauscht von ihrem weichen, warmen Körper und ihrem Duft nach einem langen, schwülen Sommerabend. Seine Bewegungen wurden schneller, sein nach Zwiebeln und Knoblauch stinkender Atem ging heftiger. Er vergaß Simone, der immer noch auf den Armen des Mädchens kniete, und den Vater, der an die Säule gebunden war. Er vergaß die Gaststube und den Schlachthof und das ganze dampfende, stinkende Rom. Das Paradies hatte sich ihm aufgetan, ihm, dem hässlichen Burschen aus der Vorstadt, dem Handlanger Don Riccos, der sich bislang mit drittklassigen Nutten draußen an der Via Salaria hatte zufriedengeben müssen. Doch jetzt gehörte ihm die göttliche Rubina …
Gianlucas Oberkörper bäumte sich auf, er schloss die Augen, begann krampfhaft zu zucken und hörte das Sirren in der Luft erst, als der Schmerz in ihn einschlug. Doch da sackte er schon vornüber. Blut quoll aus seinem Mund, während Rubina erneut einen entsetzten Schrei ausstieß.
Simone starrte auf seinen Kumpel. Gelähmt vor Ekel hatte er miterlebt, wie Gianluca die junge Frau vergewaltigte. Gerade hatte er ihm noch den Tod gewünscht. Und nun steckte das Messer in Gianlucas Rücken. Simone fuhr hoch und starrte auf Acilio Mori, dessen Hand noch vom Wurf erhoben war. Verdammt! Auf der Theke hatte offenbar ein Messer gelegen. Sie hatten gepennt. Warum hatten sie ihm nicht die Hände gebunden! Was würde Don Ricco sagen? Simone zog seine Pistole und feuerte drei-, viermal auf den gefesselten Mann an der Säule. Dann stürzte er aus der Trattoria, während Rubina um sich schlug und versuchte, sich von der Last des toten Mafioso zu befreien.
Eins
Fünfzehn Jahre später
Was für ein Spektakel! Giada Bianchi starrte auf die Schalen an der Marmorfassade, aus denen Blut hervorquoll. Jedenfalls sah es aus wie Blut. Die dunkelrote Flüssigkeit sprudelte in das große, halbkreisförmige Becken, dessen Wasser sich ebenfalls rot gefärbt hatte. Der Farbkontrast zu der barocken Brunnenanlage aus weißem Marmor wirkte grandios und schauerlich zugleich.
»Wie entsetzlich!«, plapperte ein junger Reporter eines lokalen Radiosenders neben ihr in sein Mikrofon. »Der Brunnen blutet! Wenn das kein böses Omen ist. Oder spendet er vielleicht Rotwein? Dann wäre es ein gutes Omen …«
»Unsinn«, murmelte Giada so vernehmlich vor sich hin, dass es der Kollege hören musste. »An diesem Brunnen endet ein altes Aquädukt, das Wasser von einer Quelle am Lago di Bracciano hierher nach Rom bringt. Jemand muss rote Farbe in den Zulauf geschüttet haben. Und ich kann mir sogar denken, wer.«
Der Reporter redete noch ein paar Sätze in sein Mikro und schaltete es dann aus, um die junge Frau zu mustern, die neben ihm am Beckenrand stand. Sie trug einen kurzen olivgrünen Rock und ein ärmelloses Top. An den Ohrläppchen hingen zwei kleine Hexen aus schwarzem Stein, die auf ihren Besen leicht hin und her wippten. »Bist du Expertin?«, fragte der Reporter offenbar in der Hoffnung, eine Interviewpartnerin gefunden zu haben, mit der sich seine nächste Schalte füllen ließe.
»Nicht direkt. Ich bin Journalistin wie du. Oder eher nicht wie du. Ich bin eine richtige Journalistin. Ich quatsche nicht irgendwelchen Stuss in ein Mikro, um die Zeit zwischen den Werbeblöcken zu füllen. Ich recherchiere und schreibe Artikel für eine Tageszeitung. Il Mercurio, falls dir das was sagt.«
Der Reporter schluckte die Beleidigung hinunter. »Il Mercurio!« Er schnalzte mit der Zunge. »Geiles Blatt. Was für die Intellektuellen-Schickeria. Nur leider defizitär!«
Giada ignorierte seinen Spott. Wobei er nicht ganz unrecht hatte. Der Mercurio wandte sich an ein bildungsnahes Großstadtpublikum. Nur dass auch die bildungsnahen Römer nicht mehr unbedingt Print-Zeitungen kauften. Der morgendliche Gang zum Kiosk um die Ecke samt Plausch mit dem Zeitungshändler, früher ein obligates Ritual, geriet allmählich in Vergessenheit. Und die kostenpflichtige Online-Ausgabe brummte auch nicht gerade, bei all der digitalen Konkurrenz. Gut, dass der Mercurio Cesare Colasanti gehörte, einem Bau-Tycoon, der sich das Blatt sozusagen als Hobby leistete, um in der Stadtgesellschaft nicht nur mit seinem Geld zu glänzen. Das sicherte der Zeitung vorerst das Überleben. Und ihr den Lebensunterhalt.
Giada zog ihr Smartphone aus der Tasche, schaltete die Diktier-App ein und legte los: »Stehe an der Fontana dell’Acqua Paola. Das Wasser ist blutrot gefärbt. Reporter und Schaulustige. Offensichtlich wurde nicht nur der Mercurio vorab informiert, dass hier auf dem Gianicolo-Hügel etwas abgeht. Vermutlich wieder eine Aktion dieser Futuristen.«
»Der Futuristen?«, unterbrach sie der Radioreporter. »Wer sind denn die?«
»Ein besonders bunter Klecks auf der Palette der Intellektuellen-Schickeria.«
»Ein blutroter Klecks?«
»In Kunstgeschichte nicht aufgepasst? Machen wir es kurz. Futuristen: avantgardistische Bewegung aus Italien mit bildenden Künstlern, Literaten und Musikern. Entstanden vor dem Ersten Weltkrieg. Lehnte die Kirche, bürgerliche Gesellschaft und etablierte Kunst ab. Verherrlichte Jugend, Fortschritt, Technik, Geschwindigkeit, Gewalt, Nationalismus, Krieg. Liebte Manifeste und multimediale Aktionen. Wandte sich dem Faschismus zu. Kapiert, Kollege?«
Der Radioreporter starrte Giada an: »Das ging ein bisschen schnell. Und – Erster Weltkrieg, Faschismus, das ist verdammt lang her. Was hat das alles mit dem roten Brunnen hier zu tun?«
»Ist ja nur eine Vermutung von mir«, sagte Giada. »Es gibt auch heute noch Künstler, die es mit dem Futurismus halten. Sie wollen schockieren, um Rom, diese fette Diva, aus der Lethargie zu reißen und zur alten Glorie zurückzuzwingen. Mal lassen sie Hunderttausende bunte Bälle die Spanische Treppe herunterrollen, mal färben sie Brunnen rot. Du hast doch bestimmt schon davon gehört, oder? Daneben gibt es in Rom auch noch Leute, die sich ebenfalls Futuristen nennen und offen mit den Faschos paktieren.«
»Das ist ja total aufregend«, sagte der Radioreporter. »Futuristische Faschisten richten Blutbad in Brunnen an! Das muss ich gleich meinen Hörern erzählen. Kann ich dich dazu interviewen?«
»Journalisten befragen Journalisten? Das ist ja wohl selten blöd. Da musst du dir was Besseres einfallen lassen. Ich muss jetzt ohnehin in die Redaktion und die Geschichte mit diesem Farbbrunnen aufschreiben …«
In diesem Augenblick regnete es rote Flugblätter vom Aufsatz des Brunnenmonuments herab, das einem Triumphbogen nachempfunden war. Einige landeten im Wasserbecken, andere trieb der Wind auf die vorbeiführende Via Garibaldi hinaus. Giada, der Radioreporter und ein halbes Dutzend anderer Journalisten haschten nach den Pamphleten. Sobald Giada eines erwischt hatte, überquerte sie die Via Garibaldi und ging zur Aussichtsplattform auf der anderen Straßenseite. Hier öffnete sich einer der weitesten Blicke auf Rom. Kuppeln, Türme, mit Pinien und Zypressen bestandene Hügel sowie das schneeweiße Monstrum des Viktor-Emanuel-Denkmals – im Volksmund Schreibmaschine genannt – ragten aus der Masse karminroter und umbrafarbener Häuser heraus. Die Sommerhitze ließ die Luft über der Stadt flirren und diese wie ein Traumbild oszillieren. Giada liebte Rom mit all seiner magischen Schönheit und all seinen Abgründen, die das Leben unten in den Schluchten der Straßen und Gassen bereithielt. Sie war froh, den Zeitungsladen in ihrem südtoskanischen Heimatdorf Morcone verpachtet zu haben, um wieder als Journalistin durch Rom zu streifen, in das sie sich während ihres Studiums verliebt hatte. Wenn es nach ihr ginge, wäre sie längst wieder hierhergezogen, weil es in Morcone so grottenlangweilig war – von einer Mordserie im vergangenen Jahr einmal abgesehen. Doch ihr Sohn Leo wollte auf keinen Fall aus seiner Schulklasse und Freundesclique weg. Daher pendelte Giada zwischen Dorf und Stadt, was anstrengend, als freie Reporterin des Mercurio aber möglich war.
Sie schwang sich auf die Steinbalustrade und ließ die Füße herabbaumeln. Sie spürte den kühlen Stein an ihren nackten Schenkeln und den Windhauch, der ihr sommerheißes Gesicht streifte. Sie nahm das Flugblatt und begann zu lesen.
»Manifesto« stand in dicken schwarzen Lettern über dem Text, und dann: »Per un Partito Futurista della Bellezza« – »Für eine Futuristische Partei der Schönheit«.
»Da haben wir’s«, murmelte Giada. »Wie ich es mir dachte. Die Futuristen! Und jetzt wollen sie auch noch eine Partei gründen?«
Sie las weiter:
»1. Wir wollen die Liebe zur Schönheit besingen, die Makellosigkeit des Leibes, Erotik des Blutes und Reinheit des Geistes.
2. Schönheit gibt es nur im Kampf gegen das Hässliche. Kunst und Politik müssen aufgefasst werden als Angriff auf die Kräfte des Hässlichen, um sie zu zwingen, sich der Schönheit zu beugen.
3. Wir versprechen, das ewige Rom, das so tief im Morast versunken ist, wieder zur Hauptstadt der Schönheit zu machen.
4. Wir geloben, die Werke der Schönheit aus den privaten Sammlungen zu befreien, um sie zur Erhebung des Volkes auszustellen.
5. Wir schwören, eine Diktatur der absoluten Schönheit zu errichten, die als Anarchie der Anmutigen regiert.«
Die Hexen an Giadas Ohrläppchen begannen wild zu tanzen. Ärgerlich knüllte sie das Manifest zusammen. Denen hat wohl einer Grappa ins Gehirn gepinkelt, dachte sie. Erotik des Blutes! Kampf gegen das Hässliche! Diktatur der absoluten Schönheit! Was für ein Unfug! Und dafür musste nun das Denkmalamt viel Geld ausgeben, um den Brunnen von dem Pseudoblut zu reinigen. Wo doch die Stadt ohnehin schon pleite war. Ich werde einen Artikel darüber schreiben, der sich gewaschen hat …
In diesem Moment begann in ihrer Handtasche Gianna Nannini zu singen. »Bello, bello e impossibile …« Ihr Klingelton. Giada kramte das Handy heraus und warf einen Blick auf das Display. Es war Michele, der Feuilletonchef des Mercurio. »Pronto?«
»Ich bin’s. Ich weiß, dass wir dich gerade zu dem Brunnenspektakel geschickt haben. Aber es gibt jetzt Wichtigeres zu tun. Fahr bitte sofort nach Parioli. In die Via Adelaide Ristori. Ein Mord.«
»Seit wann interessiert sich das Feuilleton für so was Rohes wie einen Mord? Ich habe hier eher was für dich. Eine abgefahrene Geschichte. Der ganze Brunnen oben an der Via Garibaldi ist blutrot. Eine Aktion der Futuristen. Sie haben eine Partei der Schönheit gegründet. Wenn du mich fragst: reinster Faschismus! Ästheto-Faschismus! Alles Hässliche soll ausgemerzt werden. Michele, wenn die an die Macht kommen, hast du nichts zu lachen.«
»Sehr spaßig! Aber jetzt hör mir bitte zu, Giada: Bei der Geschichte in Parioli geht es um mehr als irgendeinen Mord. Um viel mehr.«
»Ich höre.«
»Der Tote heißt Colasanti. Annibale Colasanti! Eh?«
»Unser Oligarch?«
»Fast. Es ist der Bruder von Cesare Colasanti, unserem Sugar Daddy.«
»Ich verstehe. Ist er auch Bauunternehmer? Steckt die Baumafia dahinter?«
»Nein. Annibale Colasanti fällt total aus der Familientradition. Ein Schöngeist. Kunstsammler. Lebemann. Früher war er eine bekannte Figur in der römischen Schickeria. Er fuhr einen blauen Lamborghini und trat auf Partys meist in einer roten Toga auf. Verrückter Typ.«
»Ach, der mit der Toga! Ich erinnere mich. Der war oft genug in den Illustrierten, die meine Eltern in ihrem Zeitungsladen in Morcone verkauft haben. Das ist aber schon lange her. Er muss ziemlich alt sein …«
»Aus deiner Fröschchenperspektive vielleicht«, sagte Michele, der kurz vor der Rente stand. »Er war überhaupt nicht alt. Anfang sechzig erst. Aber tatsächlich schon lange nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ich glaube, er hatte vor etlichen Jahren einen schweren Unfall. Seitdem sah man ihn kaum noch. In der Kunstszene ist er aber immer noch eine Nummer. Er muss eine phänomenale Sammlung antiker Statuen haben. Man munkelt, er habe einige sensationelle Stücke Grabräubern beziehungsweise – wenn es nicht um Gräber ging – Raubgräbern abgekauft. Sie sollen ein Vermögen wert sein. Womöglich ist er deswegen überfallen worden.«
»Wann ist es passiert?«
»Keine Ahnung. Vielleicht heute Nacht? Wir wissen noch nichts. Haben nur den Tipp aus der Einsatzzentrale der Polizei bekommen. Ich möchte, dass du gleich hinfährst.«
»Warum ich?«
»Weil das ein komplexer Fall ist. Ein Prominenter, Kunstszene, der Bruder unseres Mäzens – da braucht es Fingerspitzengefühl. Und man wird sich dahinterklemmen müssen, um was rauszubekommen. Cesare Colasanti wird dafür sorgen, dass die Polizei das sehr vertraulich behandelt. Er hasst Schlagzeilen rund um die Familie. Die Eskapaden seines Bruders haben ihn deshalb immer total genervt.«
»Also, noch mal: Warum ich?«
»Weil du Biss hast und hartnäckig bist, Giada. Du weißt, was ich von dir halte.«
»Und was wird unser Mäzen dazu sagen?«
»Das werden wir sehen. Selbstverständlich legen wir Cesare Colasanti die Geschichte vor, bevor wir sie drucken. Vielleicht zahlt er uns was extra, wenn wir sie nicht drucken?«
»Du hast ja einen Knall! Ich bin Reporterin, nicht Erpresserin«, schimpfte Giada los. »Ich recherchiere, um aufzuklären.«
Michele kicherte. »Manchmal funktionierst du wie ein Springteufel, Giada. Man drückt auf einen Knopf, und du gehst hoch. Glaubst du wirklich, ich mach so einen Scheiß? Natürlich drucken wir deine Geschichte. Gerade, weil es unser Mäzen ist, müssen wir darüber berichten, sonst machen wir uns ja lächerlich. Aber, wie gesagt, mit Fingerspitzengefühl. Und das heißt vor allem: nur belegbare Fakten; keine erfundenen Zitate. Deswegen du. Nimm es als Kompliment.«
Giada fühlte sich widerwillig geschmeichelt. Und spannend klang die Geschichte ja. »Adresse?«
»Schreib dir auf: Via …«
Drei Minuten später saß Giada am Steuer ihrer ape – eines dreirädrigen Zwerglasters der Firma Piaggio, der in Italien Kultstatus genoss – und knatterte die Via Garibaldi zum Tiber hinunter.
Robert Lichtenwald streifte über sein Land in der Maremma, und er sah, dass es gut war. Die Oleanderbüsche standen in Blüte, Rosmarin, Thymian und Lavendel würzten die Luft, unten am Teich ringelte sich eine gelb-grüne Zornnatter auf einer Steinplatte wie ein verknotetes Stück Gartenschlauch. Lichtenwald hatte sich inzwischen an die ungiftigen, wenn auch beißfreudigen Schlangen gewöhnt, die ihn anfangs so erschreckt hatten. Er ging in Flip-Flops über den Kiesweg hoch zum Haus, lauschte dem hypnotisch wirkenden Liebeswerben der Zikadenmännchen und erfreute sich an der Wiese rund um die Terrasse, die dank nächtlicher Bewässerung auch jetzt Anfang August mit sattem Grün das Auge erfrischte. Knallpinkfarbene Bougainvilleen kletterten an den Natursteinwänden seines Landhauses empor. Von der Pergola über der Terrasse baumelten aus dichtem Laub die Tafeltrauben.
Lichtenwald schnitt hier einen gelblich verfärbten Wedel aus einer Fächerpalme, klaubte dort Steinchen aus dem Rosenbeet. Dann goss er die Engelstrompeten, die, obwohl im Halbschatten, ihre waschlappengroßen Blätter und wachsweißen Blüten hängen ließen.
Lichtenwald blickte umher. Es war alles in Ordnung. Alles getan. Monatelang hatte er ununterbrochen in Haus und Garten geschuftet, seit er im März aus Deutschland zurückgekommen war. Er hatte die Handwerker beaufsichtigt, während sie den Weinkeller herrichteten, WLAN installierten, die Fenster im Erdgeschoss gegen einbruchsichere austauschten und den Gartenteich anlegten. Er war herumgefahren, um Küchenmaschinen, Kerzenständer, Bettbezüge und einen hochauflösenden Fernseher für sein Wohnzimmer zu kaufen. Er hatte das Gebüsch um den Teich herum gerodet, Bambus und andere Ziergräser gepflanzt, den Weg von Unkraut gereinigt und neu gekiest und die tückischen Brombeerranken beseitigt, die sich wie NATO-Stacheldraht um die Nordseite des Hauses gelegt hatten. Kurzum: Er hatte das Rustico, das alte toskanische Bauernhaus, das er zusammen mit seiner Frau Stefanie vor Jahren als Feriensitz gekauft hatte, zu einem dauerhaften Domizil umgestaltet. Wenn Stefanie das sehen könnte! Es würde ihr gefallen.
Das rastlose Basteln an seinem Landhaus in der Südmaremma hatte Lichtenwald geholfen, der Traurigkeit und Unruhe auszuweichen, die ihn immer wieder heimsuchten, seit Stefanie ihn verlassen hatte. Er genoss es geradezu, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang herumzuwerkeln und abends mit schmerzenden Knochen auf sein Wasserbett zu sinken. Zum Grübeln blieb ihm dadurch keine Zeit. Ja, er kam nicht einmal dazu, sich um seine neuen Freunde in Morcone zu kümmern, um Mario Pianigiani, den Wirt der Trattoria Tramonto, um Luigi La Torre, genannt der Philosoph, und um Giada Bianchi, die vulkanische Giada, mit der zusammen er vor einem Jahr ein mörderisches Abenteuer nur um Haaresbreite überlebt hatte.
Doch nun konnte sich Lichtenwald daranmachen, sein Leben im Süden richtig zu beginnen, so wie er es sich seit Schülerzeiten erträumt hatte, seit jenem ersten Urlaub ohne Eltern, mit Freunden und Rucksack am Meer in Ligurien. Wie würde es werden, dieses Leben? Lichtenwald wusste, dass es nur eine Sache gab, die noch gefährlicher war, als seine Träume zu beerdigen: sie zu verwirklichen.
Er ging barfuß ins Haus, um etwas Hitze aus seinem Körper an die Terrakottafliesen abzugeben. Es war Spätnachmittag und heißer denn je. Robert goss sich ein Glas eisgekühlten Parrina Bianco ein, einen Weißwein aus der Gegend. Dann zog er einen Zigarillo aus der noch jungfräulichen Packung, die er vor Tagen gekauft hatte. Er setzte sich in einen Korbstuhl unter dem Feigenbaum im Garten und tat, was er zwei Jahrzehnte lang nicht mehr getan hatte. Er rauchte. Anfangs brannte der Qualm auf seiner Zunge, doch bald schon gewöhnte er sich daran. Er schloss die Augen und ließ Bilder aufsteigen … aus der Studentenzeit … damals mit Stefanie … Lachen, Liebe, Nächte.
Er wollte nachdenken, was er nun machen sollte aus seinem wahr gewordenen Traum. Er stand auf und holte sich noch einen Zigarillo und noch ein Glas Parrina Bianco. Nikotin und Alkohol waberten durch seinen Kopf, er fühlte sich wohl und schlief ein. Da erschien Giada, sommerbraun, in Shorts und Tanktop. Ihre Zähne strahlten wie Scheinwerfer aus ihrem bronzefarbenen Gesicht, und die beiden Hexen aus Obsidian an ihren Ohrläppchen sausten um ihren Kopf, als würden sie Kettenkarussell fahren. Lichtenwald saß auf der Veranda eines Holzhauses und sah Giada zu, wie sie barfuß auf das Geländer einer Hängebrücke stieg, die über einen Urwaldfluss führte. Sie drehte sich um und winkte. Er wollte aufstehen, aber eine unerklärliche Schwere hielt ihn zurück. Sie streckte ihm die Zunge heraus und balancierte über den Fluss. Unendlich mühsam, als zöge ihn ein Magnet zurück, löste er sich von seinem Sitz. Doch dann, als er sich leicht und frei fühlte und auf die Brücke zurannte, strauchelte Giada …
Zwei
Parioli war das mondäne Viertel Roms. Ein grüner Hügel im Norden der Stadt, der einst erschlossen worden war, um die Bonzen des faschistischen Regimes zu beherbergen. Nach dem Zweiten Weltkrieg zogen arrivierte Künstler, Schauspieler, Politiker, Diplomaten und Industrielle in die Palazzi, die in immergrünen Gärten entlang geschwungener Straßen schlummerten. Für den normalen Römer waren die Bewohner von Parioli eine Spezies der anderen Art, besonders begünstigt von einer Laune der Götter.
Giada mochte Parioli, nicht wegen seiner Bewohner, aber wegen seiner Gärten mit den lauschigen Schirmpinien, die sie an ihre Maremma erinnerten. Sie hatte die Fenster der ape heruntergekurbelt und sog die würzige Luft des Viertels ein, während sie die Via Adelaide Ristori ansteuerte. Sie brauchte nicht nach der Hausnummer zu suchen. Vor einem vierstöckigen, sandfarbenen Gebäude mit türkisfarbenen Fensterläden war die u-förmige Straße abgesperrt. Die Lampen auf den blassblauen Wagen der Polizia di Stato blinkten nervös. Zwei Beamte in kurzärmligen dunkelblauen Uniformen signalisierten Giada, umzukehren und sich zu trollen. Sie stieß ein Stück zurück, parkte in einer Einfahrt und stieg aus ihrer ape. Während sie auf die Polizisten zuging, kramte sie in ihrem Lederrucksack nach dem Journalistenausweis. Aus dem Eingang des Palazzo traten drei Personen in weißen Overalls. Die Spurensicherung war offenbar fertig. Direkt vor dem Haus stand ein schwarzblauer Alfa Romeo der Carabinieri. Sieh mal einer an, dachte Giada, Polizei und Carabinieri kloppen sich um einen dicken Fisch. Sie stutzte, als sie das runde Wappen auf dem Wagen sah. Ein goldener Drache vor einem goldenen Tempel. Offenbar eine Sondereinheit.
Ein schriller Pfiff zerriss die Nachmittagshitze. »Signora, bleiben Sie stehen!« Die beiden Polizisten stellten sich Giada breitbeinig in den Weg. »Sie können hier nicht weiter. Laufende Ermittlungen. Steigen Sie wieder in Ihre Schrottlaube und ziehen Sie Leine!«, sagte der eine. »Wir können aber auch später einen caffè zusammen trinken«, schnurrte der andere, während sein Blick Giadas gebräunte Schenkel entlangglitt.
Giada schloss unwillkürlich die Beine und verkniff sich ein »Arschloch«. »Ich bin Journalistin«, sagte sie spitz.
»Das sagen sie alle«, höhnte der erste Polizist.
»Sie können hier wirklich nicht durch, signora«, flötete der zweite. »Journalistin hin oder her. Das haben wir auch schon Ihren Kollegen gesagt. Da oben«, er nickte über seine Schulter hinweg, »liegt ein toter Mann in einer Wohnung, die mit Antiquitäten vollgestopft wie ein Museum ist. Die Spurensicherung ist gerade fertig. Die Leiche kommt jetzt in die Gerichtsmedizin, und die Wohnung wird versiegelt. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann.«
»Danke, Sie sind wirklich nett«, sagte Giada, legte den Kopf schräg und lächelte den zweiten Polizisten an. Sie ließ ihre Augen aufstrahlen, so hatte sie schon als Schülerin die Jungen beeindruckt. »Ach, eines noch: Der Tote ist ja Annibale Colasanti …«
»Dazu können wir nichts sagen«, fuhr der erste Polizist dazwischen. »Es wird sicher bald eine Pressekonferenz geben, da können Sie und Ihre Kollegen sich informieren. Kapiert?«
»Der Tote ist also Colasanti«, fuhr Giada fort. »Erbe, Millionär, Lebemann, Kunstsammler. Da kommen viele Täter in Betracht.« Sie fuhr sich mit den Händen übers Gesicht und streifte ihre orangerot gefärbte Mähne zurück. »Hm. Er wurde also erschossen, sagten Sie …«
»Aber nein«, rief der zweite Polizist, während er Giada betrachtete. »Er wurde nicht erschossen, sondern …«
»Halt die Klappe!«, ging der erste dazwischen. »Willst du noch mehr Ärger bekommen, weil du vor jedem Mädel Männchen machen musst?«
Der Kollege verstummte.
»Gehen Sie jetzt endlich«, sagte der erste. »Mehr erfahren Sie von uns nicht.«
Giada warf den beiden Polizisten eine Kusshand zu und schlenderte an dem rot-weißen Absperrband entlang zur anderen Straßenseite, wo im Schatten eines Hauses Fotografen und Kameraleute lauerten wie ein Rudel Wölfe in einer Hungernacht. Sie sprach ein paar Notizen in ihr Handy. »Porca miseria«, murmelte sie vor sich hin, »verdammter Mist! Warum hat mich der Kerl so kühl abgewimmelt? Wahrscheinlich ist er schwul … Und jetzt? Auf eine Pressekonferenz warten wie die ganze Meute? Um ein paar Brosamen aufzupicken, mit denen die Polizei die Kollegen abspeist? Nicht mit mir …« Suchend blickte sie zu dem Haus hinüber, dessen Fassade durch Terrassen und Balkone aufgelockert war. Und wenn sie versuchte, von der Seitenstraße her über die Mauer zu klettern? Giada verwarf das wieder, als sie die Glasscherben sah, mit denen die Mauer gespickt war. Verdammter Mist …
Drei Beamte in blauschwarzen Uniformen mit breiten roten Seitenstreifen an den Hosen traten aus dem Eingang des Hauses, in dem Colasanti ermordet worden war. Zwei Männer und eine groß gewachsene Frau, deren kräftiger pechschwarzer Zopf unter der Dienstmütze hervorquoll. Ihre stahlblauen Augen leuchteten in der Sonne auf. Sie sieht hinreißend aus, dachte Giada. Während die beiden Begleiter wie lästige Hausierer auf sie einquasselten, schritt die Offizierin auf das Auto mit dem Drachensymbol zu. Dieser selbstbewusste, ja herausfordernde Gang. Schlagartig wurde Giada klar: Sie kannte die Frau. Die blauen Augen im bronzefarbenen Gesicht, der Zopf. Es musste Donatella Laganà sein, capitano Laganà, die Carabinieri-Offizierin aus dem Städtchen Grosseto, die im vergangenen Jahr die Ermittlungen in der Mordserie von Morcone geführt hatte. Was machte sie denn hier? Egal. Die schickte der Himmel.
»Capitano Laganà!«, schrie Giada. Sie stellte sich in ihren weißen Turnschuhen auf die Zehenspitzen und winkte mit beiden Armen. »Kennen Sie mich noch?«
Donatella Laganà drehte sich auf dem Absatz um und griff unwillkürlich an ihr Halfter. Sie kniff die Augen zusammen und musterte die quirlige junge Frau mit den orangeroten Haaren und dem kurzen Rock, die da außerhalb der Absperrung auf und ab hüpfte. Dann bemerkte sie die zwei schwarzen Figürchen, die an den Ohrläppchen der Frau wippten. Ein Lächeln huschte über ihr ernstes Gesicht, während sie auf die Frau zuging. »Giada? Giada Bianchi! Was machen Sie denn hier?«
»Das wollte eigentlich ich Sie fragen, capitano«, rief Giada und streckte der Offizierin die Hand entgegen.
»Ts, ts, ts«, schnalzte Laganà und deutete gespielt vorwurfsvoll auf ihre Schulterklappen, auf denen eine Krone und ein Stern zu sehen waren. »Maggiore, mittlerweile.« Sie drückte Giadas Hand. »Rote Haare, Hexenohrringe – Sie haben sich nicht verändert. Und, wie läuft die Recherche bei meinen Kollegen von der Polizia di Stato?«
Giada wusste, dass die Staatspolizei, die dem Innenministerium untersteht, und die Carabinieri, welche zu den Streitkräften gehören, eine epische Rivalität verbindet. Die Carabinieri halten sich für etwas Besseres als die poliziotti, und sie sehen in ihren Uniformen jedenfalls deutlich fescher aus. Die Polizisten wiederum betrachten die Carabinieri als eitle Gockel, bei denen die Evolution mehr ins Federkleid als ins Gehirn investiert hatte. Diese Rivalität wird vom Gesetzgeber angeheizt, indem er beiden Einheiten praktisch dieselben Aufgaben zuweist, die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Das führt zu erbittertem Kompetenzgerangel, was der italienische Staat als Kollateralschaden dieser besonderen Form der Gewaltenteilung hinnimmt.
Giada schnaubte und warf einen schrägen Blick auf die beiden Polizisten, die immer noch den Weg zum Haus versperrten. »Der eine ist okay, aber der andere ist ein A…, also ein Idiot. Dabei arbeite ich für eine seriöse Zeitung. Den Mercurio!«
»Sie arbeiten jetzt für den Mercurio?«, fragte Laganà anerkennend.
»Ja. Freiberuflich. Soweit es zeitlich eben geht. Ich lebe immer noch in Morcone, wegen Leo, Sie wissen schon, meinem Sohn, der partout nicht nach Rom ziehen will. Aber den Zeitungsladen hab ich verpachtet. Ich fand es auf Dauer einfach zu langweilig, in Morcone Illustrierte, Lose und Postkarten zu verkaufen.«
»Das versteh ich.« Laganà nickte ernst. »Auch mir ist es in Grosseto zu eng geworden. Daher habe ich mich auf einen Posten bei einer Sondereinheit hier in Rom beworben.«
»Hat das was mit dem Drachen und dem Tempel auf Ihrem Auto zu tun?«, fragte Giada.
»Durchaus. Drachen machen uns bislang zwar weniger zu schaffen, Tempel und deren Inhalte aber sehr.«
»Es geht um Kultur?«
»Genau. Der italienische Staat mag ja nicht zur Avantgarde effektiver Systeme gehören. Auf einem Gebiet aber sind wir spitze: beim Kulturgüterschutz. Das Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale – das Carabinieri-Kommando für den Kulturgüterschutz – wird in der ganzen Welt bewundert. Und kopiert. Selbst die Franzosen nehmen unsere Einheit als Vorbild. Die Franzosen! Das hat mich gereizt. Zumal ich aus einer Region mit einer uralten Kultur komme …«
»Aus Kalabrien, ich weiß …«
»Genau!«
Giada verkniff sich die Bemerkung, Kalabrien sei doch eher für seine Mafia bekannt, die furchtbare ’Ndrangheta. »Und was machen Sie hier? An diesem Tatort, meine ich? Ich dachte, diesen Fall hat sich schon die Polizei geschnappt?«
»Wir wurden hinzugezogen. Der Tote«, Laganà deutete auf eine Wohnung mit Terrasse im dritten Stock, »hatte eine bedeutende Kunstsammlung. Womöglich steht der Mord damit im Zusammenhang.«
»Sind Kunstschätze geraubt worden?«, fragte Giada wie beiläufig.
Laganà lächelte. »Sie wollen mich aushorchen? Sicher haben Sie die Kollegen schon auf die Pressekonferenz verwiesen.«
»Sie wollen mir also auch nichts sagen«, sagte Giada und starrte wie ein kleines Mädchen auf ihre Turnschuhe.
»Wer weiß«, sagte Laganà. Sie senkte die Stimme. »Manchmal treibt es Ermittlungen voran, wenn die Presse vorprescht. Und ich weiß von unseren Begegnungen im vergangenen Jahr, dass Sie zu den Guten gehören.« Sie lächelte komplizenhaft. »Zu den puri e duri, den Reinen und Harten. Ich meine das gar nicht ironisch«, fügte Laganà schnell hinzu, als sie Giadas schrägen Blick bemerkte. »Hier kann ich Ihnen allerdings nicht mehr sagen. Zu viele Ohren hören mit. Warum besuchen Sie mich nicht in unserer Kaserne?«
»Liebend gern.« Giada nickte heftig.
»Morgen Vormittag, sagen wir … um sieben?«
»Das nennen Sie Vormittag?«
»Der frühe Vogel fängt den Wurm.«
»Wo finde ich Sie?«
»Via Anicia 23, in Trastevere. Links neben der Kirche San Francesco a Ripa. Wir sind in einem ehemaligen Franziskanerkloster untergebracht. Bescheiden, aber voller Hingabe, das passt zu uns.«
»Die Hingabe nehme ich Ihnen ab«, lästerte Giada. »Aber Bescheidenheit, maggiore? Wie eine Bettelnonne wirken Sie nicht gerade!«
Laganà hielt die ausgestreckte rechte Hand an ihre Schirmmütze. »Wir sehen uns«, rief sie vergnügt.
Giada nahm Haltung an und schlug ihre Turnschuhe zusammen. »Wir sehen uns, maggiore!« Zackig drehte sie sich um und ging im Stechschritt die Straße hinunter. Die beiden Polizisten schauten ihr entgeistert nach.
Robert Lichtenwald saß auf seiner Terrasse und verzehrte die Crostini, die er sich zubereitet hatte. Er liebte die kleinen gerösteten Brotscheiben. Einen Teil hatte er mit gehackten Tomatenwürfeln und Zwiebeln belegt, andere mit Thunfisch und Kapern, wieder andere mit Avocadocreme und gebratener Hühnerleber. Genüsslich schmeckte er den unterschiedlichen Aromen nach, die sich wie die Sätze einer Symphonie in seinem Gaumen entfalteten. Es waren solche kleinen Sachen, die ihn so an Italien begeisterten. Wobei er gute Crostini genauso in München zubereiten konnte. Nur, da ging es ihm wie mit einfachem Landwein. Es war ein Unterschied, ob man ihn in seinem Terroir oder zu Hause trank. Während Lichtenwald wieder einmal versuchte, seiner chronischen Italienpassion auf die Spur zu kommen, bezog sich der Himmel mit lachsrot schimmernden Wolkenschlieren, zwischen denen bald das Blau des Abends hindurchlugte. Die Zikaden verstummten, und die Nachtfalter begannen, um die betäubend duftenden Kelche der Engelstrompeten zu taumeln. Lichtenwald überlegte, ob er sich eine Lampe und den Roman holen sollte, in dem er gerade las. Er ließ es bleiben und starrte in die Dunkelheit.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.