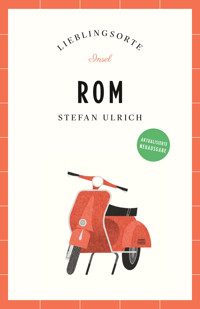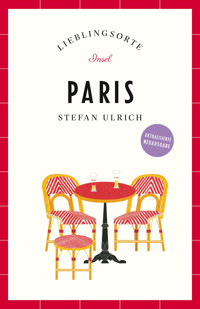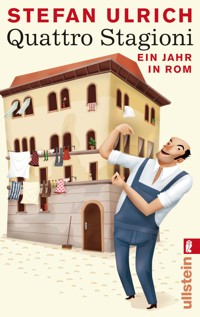
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Habt Ihr´s gut ...« ist der Kommentar ihrer Freunde, als für Familie Ulrich endlich der alte Traum von der Dolce Vita in Bella Italia wahr wird. Doch das Leben in der ewigen Stadt erweist sich als alles andere als »dolce«: die Wohnung ist bei der Ankunft in chaotischem Zustand und Tochter Bernadettes Meerschweinchen wird vom Hausbesitzer mit einer Ratte verwechselt. Wichtige Erkenntnisse der Rom-Anfänger: Ein Palazzo ist ein ganz normales Mehrfamilienhaus, römische Kinder-geburtstage haben es in sich und die Italiener beschweren sich auch bei strahlendem Sonnenschein andauernd übers Wetter. Trotzdem versuchen die Ulrichs, Bella Figura zu machen! Und entdecken doch noch das süße Leben in Rom.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Das Buch
Als Familie Ulrich von München nach Rom umzieht, sind die Erwartungen hoch: tolles Essen, immer Sonne, gesellige Menschen, Cappuccinoschlürfen auf der Piazza Navona. Doch die Dolce Vita lässt erst mal auf sich warten: Die Wohnung ist bei der Ankunft in chaotischem Zustand, die italienische Bürokratie toppt die deutsche bei weitem, und auch sonst hält das Leben in Italien für die Rom-Anfänger einige Überraschungen bereit. Trotzdem versuchen die Ulrichs, Bella Figura zu machen. Und entdecken schließlich auch noch das süße Leben in Rom.
Der Autor
Stefan Ulrich wurde 1963 in Starnberg geboren. Im August 2005 zog er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern von München nach Rom um. Von dort berichtet er als Korrespondent der Süddeutschen Zeitung über Rom, Italien und den Vatikan.
Von Stefan Ulrich ist in unserem Hause außerdem erschienen:
Arrivederci, Roma!
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen,
wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung,
Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Mai 2008
13. Auflage 2011
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2008
Umschlaggestaltung und Gestaltung des Vor- und Nachsatzes:
Sabine Wimmer, Berlin
Titelillustration: © Isabel Klett
Satz: LVD GmbH, Berlin
eBook-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
Printed in Germany
eBook ISBN 978-3-548-92069-6
Für Annette, Franziska und Julius
Eins
Wir wussten, es würde heiß werden, und es wurde heiß. Ab dem Brenner stieg die Temperaturanzeige im Auto unaufhaltsam, vor Bozen waren es 28 Grad, bei Modena sind es bereits 39. Die Poebene verschwimmt vor unseren Augen zu einem klebrigen Milchbrei. Beim Zwischenstopp an der großen Agip-Tankstelle hinter Bologna umhüllt uns die schwüle Luft, als ob sie uns ersticken will, langsam zwar, aber unerbittlich.
»C’è tanta afa«, sagt der Tankwart mit einem mitleidigen Blick auf unsere erhitzten Gesichter. »Es ist furchtbar schwül.«
»Vielleicht hätten wir nicht gerade am ersten August umziehen müssen«, sagt Antonia, während wir in die Raststätte wanken. »Wir könnten jetzt auch am Starnberger See liegen.«
»Jetzt nur keinen Defätismus«, murmele ich, wenig überzeugend.
Ich denke an das graublaue, kühle Wasser des Sees, an das flauschige Grün der Roseninsel, das sich beim Hinausschwimmen vom Ufer löst, an den Blick auf Schloss Ammerland und den breiten Rücken der Benediktenwand. Und ich denke – es sei gestanden – an ein eiskaltes Weißbier. Bye-bye Chianti. Dann gebe ich mir einen Ruck. Schließlich kann man nicht alles haben.
»Warte, bis du unsere Wohnung in Rom siehst«, sage ich mit aufgesetzter Munterkeit. »Heute Abend sitzen wir bei einem Glas Rotwein auf unserer Terrasse und lauschen den Zikaden.«
Seit ich denken kann, mag ich solche romantischen Italien-Klischees. Doch hier, an diesem bleiernen Augustnachmittag auf dem benzinschwangeren Parkplatz der Tankstelle, fällt es mir schwer, mich richtig zu begeistern. Die bistecca alla fiorentina und der Rucola-Salat heben jedoch meine Laune. In Italien isst man sogar in Autobahnraststätten gut. Eine schlechte Küche könnte sich einfach nicht halten. Wir bestellen Cappuccino nach dem Essen, ein Sakrileg. Non si fa, das macht man nicht in diesem Land, warum auch immer. Italiener trinken stattdessen einen caffè, einen Espresso, und zwar erst nach dem dolce, der Süßspeise, und keineswegs dazu. Basta!
Wir wissen das wohl, doch was schert es uns? Noch sind wir nicht angekommen, noch sind wir nur Reisende in Richtung Rom.
Bologna, Firenze, das kleine, verschachtelte Dorf Orte auf seinem Tuffsteinfelsen, Roma Nord. Wir schwenken ein in den sogenannten »GRA«, die große Ringstraße rund um die Hauptstadt. Die Sonne klebt inzwischen wie ein orangeroter Medizinball eine Handbreit über dem Horizont. Es hat noch immer 36 Grad. Ich freue mich auf eine kühle Wohnung, eine kalte Dusche, unser neues Zuhause. Das Handy klingelt.
»Wo seid ihr gerade?«, fragt Klaus, der Freund und Kollege von meiner Zeitung in München, die mich für die nächsten Jahre als Korrespondent nach Rom geschickt hat.
»Fast am Ziel«, antworte ich. »Wir sehen schon die Stadt. Jetzt sind es vielleicht noch zwanzig Minuten.«
»Na dann, viel Glück«, sagt Klaus. »Und denkt immer daran, wie gut ihr es habt. Leben in Rom!«
»Habt ihr’s gut«, das haben wir in den vergangenen Wochen unzählige Male gehört, von Kollegen und Freunden in München, von Eltern und Geschwistern, den Kindergärtnerinnen unseres Sohnes Nicolas und der Klassenlehrerin unserer Tochter Bernadette.
»Rom, das ist doch ein Traum«, meinten sie alle und ich gab ihnen recht.
Am Abend vor der Abfahrt waren wir noch einmal mit unseren Nachbarn in einem Restaurant in München essen, in einer italienischen Trattoria versteht sich. Wir saßen im Wirtsgarten, es war ein herrlich milder Abend.
»So werdet ihr es demnächst immer haben«, meinte die Nachbarin. »Wie wir euch beneiden.«
Wir merkten nicht, wie sich hinter den Bäumen im Westen schwarze Wolken ballten. Auf einmal, der vitello tonnato kam gerade auf den Tisch, fegte eine Windböe durch den Garten, riss an den Decken, griff in die Sonnenschirme. Gleich darauf knallte der erste Donnerschlag, Hagelkörner prasselten herab, Gäste und Kellner flüchteten ins Haus. Ein dramatischer Abschied – ein böses Omen? Zum Glück sind wir nicht abergläubisch.
Wir verbrachten die letzte Nacht in unserem ausgeräumten Haus auf einem Lager aus Isomatten.
»Geht so Zelten?«, fragte Nicolas, der mit seinen fünf Jahren noch nie auf dem Boden geschlafen hatte.
»Bist du dumm«, sagte die zweidreiviertel Jahre ältere Bernadette. »Zelten tut man draußen.«
»Aber draußen regnet es doch, du Kuh«, krähte Nicolas.
Die beiden begannen sich sofort zu balgen. Wir waren alle aufgeregt, halb freudig, halb beklommen. Am nächsten Tag würden wir die Kinder für eine Woche zu meinen Eltern nach Tutzing am Starnberger See bringen, während wir in Ruhe die Wohnung in Rom einrichten wollten.
Ich schlief schlecht in jener Nacht. Unruhige Träume mischten sich mit Erinnerungen. Unscharfe Bilder mit blassen Farben, wie in einem alten Super-8-Film. Santa Margherita Ligure, 1969. Das erste Mal am Meer, kurz vor der Einschulung. Im Traum sah ich wieder die bunten Schirme, spürte den heißen Sand zwischen den Zehen, hörte das Schwapp, Schwapp der kleinen, auslaufenden Wellen. Draußen, bei dem dunklen Felsen im Meer, tauchte ab und an eine gelbe Taucherbrille mit dem Kopf meines Vaters auf, ein Wasserstrahl spritzte aus dem Schnorchel. Mein Vater verbrachte jenen Urlaub fast ausschließlich unter Wasser. Immer wenn er mit einem Seestern, einer Muschel oder einem lila Seeigel mit weißen Stachelspitzen an Land kam, schickte ich ihn energisch wieder los.
»Los, fang mir noch einen Kraken«, schrie ich. Schließlich hatte der dicke Italiener unter dem Nachbarschirm seinen Kindern auch so ein unheimliches Tier mit Fangarmen voller Saugnäpfe aus dem Meer getaucht. Das konnten wir unmöglich auf uns sitzen lassen. Mittags gingen wir dann immer zu Alfonso, der in seinem winzigen Strandlokal kleine Fische und calamari frittierte. Alfonso wunderte sich, wie viel ich mit meinen sechs Jahren davon verputzen konnte.
»Mangia bene il bambino«, sagte er anerkennend zu meinem Vater. »Der Junge isst aber gut.« Es wurden meine ersten italienischen Wörter.
Das war Santa Margherita, nichts Besonderes, ein ganz normaler Strandurlaub, aber er hat sich damals in meinen Jungenkopf eingebrannt wie Musik auf eine CD. Der Traum vom Süden.
Wieder watete mein Vater an Land, sein nasses Gesicht strahlte. In der Hand hielt er einen riesigen Kraken. Er wollte etwas rufen, doch dann begann das Bild plötzlich abzutauchen und eine Schiffssirene läutete. Nein, es war der Wecker. Sechs Uhr früh und wir vier sprangen sofort hellwach von unseren Isomatten hoch. Nun ging es los – unser römisches Abenteuer. Als wir zwei Stunden später die Kinder bei meinen Eltern abgaben, sagte meine Mutter zum Abschied: »Und grüßt mir Italien. Habt ihr’s gut!«
Wir verlassen den GRA und nehmen die Via Aurelia Richtung Città del Vaticano, also Richtung Innenstadt. Es ist Montagabend und es herrscht erstaunlich wenig Verkehr. Wo sind die Römer? Weg, am Meer. Von früheren Italien-Reisen weiß ich: Man bleibt nicht im August in Rom, non si fa. Die Stadt gehört in dieser Zeit den Katzen, den sandalierten Touristen und den Hausangestellten. Die bewachen nämlich die großen, ziegelroten und melonengelben Palazzi, die Mehrfamilienhäuser, während die Herrschaft im Urlaub ist. Früher waren all die Pförtner, Hausmeister und Dienstmädchen Italiener, heute kommen sie oft von den Philippinen. Sie sind fleißig und zuverlässig und haben, was die Römer sehr schätzen, scheinbar kaum eigene Bedürfnisse. Oft hausen diese Philippiner das ganze Jahr über in winzigen Pförtnerwohnungen seitlich des Eingangs zum Palazzo oder in einem Kämmerchen neben den Küchen der Wohnungen. Freundlich, leise und nahezu unsichtbar verrichten sie ihre Arbeit wie Geisterwesen. Jetzt, im August, aber leben sie auf, verabreden sich in den ferienverwaisten Wohnungen, streifen plaudernd in Grüppchen durch die Häuser oder sitzen im Schatten der Pinien in den römischen Parks beisammen.
Unser Palazzo liegt in Prati, einem Stadtviertel am rechten Tiberufer unweit des Vatikans, das nach der italienischen Einigung 1870 mit klassizistischen, gutbürgerlichen Mehrfamilienhäusern entlang schachbrettartig angelegter Straßen bebaut wurde. Ich hatte das große, sechs Stockwerke hohe Haus, in das wir nun einziehen sollten, nur flüchtig besichtigt. Ein Bekannter hatte mir im Frühjahr von der frei werdenden Wohnung im dritten Stock erzählt. Daraufhin flog ich sofort von München nach Rom, denn es ist nicht leicht, in einer besseren Gegend, noch dazu in zentraler Lage, eine Unterkunft zu finden. An jenem Tag regnete es in Rom, die riesige, dunkle Wohnung mit ihren langen Gängen und vielen Türen stand voller Umzugskisten, die Möbelpacker gingen ein und aus. Ein Blick in die Zimmer, ein Blick auf die Balkone, ein kurzes Gespräch mit dem Besitzer, einem gewissen Signor Cornetti, und ich unterschrieb den Mietvertrag, froh, so rasch eine Wohnung gefunden zu haben.
»Jetzt bin ich aber wirklich gespannt auf die Wohnung«, sagt Antonia, während wir im letzten Abendlicht die breite Wohnstraße entlangfahren.
»Ich auch. Ich habe sie ja damals gar nicht richtig gesehen. Doch ich bin sicher, sie wird dir gefallen.«
Wir finden rasch einen Parkplatz, schließlich ist es August, und stehen kurz darauf vor einem hohen Portal aus poliertem Holz. Suchend blicken wir auf die Klingelanlage aus blank geputztem Messing. Gut eineinhalb Dutzend Namen stehen darauf. Etwa die Hälfte der Nachnamen lautet auf Cornetti. Dann entdecke ich, ganz unten, die Aufschrift portinaio, Hausmeister. Ich drücke den Klingelknopf und es rührt sich – nichts. Ich klingele noch einmal und noch einmal. Schließlich meldet sich eine Männerstimme: »Chi è?« – »Wer ist da?« Dann summt der Türöffner, wir treten in einen eleganten, hohen, mit Marmor gefliesten Vorraum.
Schritte nähern sich und plötzlich steht Filippo vor uns. Filippo ist kein Philippiner, sondern Italiener, genauer gesagt Neapolitaner. Ein kleiner Mann in Khakihosen und Polohemd, mit leicht gewellten, kurzen schwarzen Haaren und ebenso schwarzen Knopfaugen. Er reicht uns die Hand und murmelt, er habe um diese Zeit eigentlich schon frei. Aber natürlich mache es nichts, dass wir erst so spät kommen. Er habe zwar die ganze Zeit auf einen Anruf von uns gewartet, aber selbstverständlich sei das kein Problem, dass wir uns den ganzen Tag über nicht gerührt haben und er deshalb immer in Reichweite des Telefons bleiben musste, obwohl er gerade so viel zu tun hat. Überhaupt kein Problem.
Wir sollten bald lernen, dass Italiener Kritik und andere unangenehme Dinge gerne verklausuliert ausdrücken. Schließlich soll niemand brutta figura machen. An diesem Abend aber bin ich zu müde, mir darüber den Kopf zu zerbrechen oder mich so recht schuldig zu fühlen. Filippo führt uns zu seiner kleinen, verglasten Pförtnerloge in einer dunklen Ecke der Eingangshalle links neben dem Tor und deutet auf ein Brett mit unzähligen Schlüsseln. Fünfzehn Wohnungen habe der Palazzo, doch im August sei kein Mensch zu Hause.
»Niemand außer mir und Federica, meiner Frau. Wir haben dennoch genug zu tun, müssen die Balkonblumen versorgen, den Innenhof pflegen. Außerdem lässt uns jeder der signori – der Herrschaften – eine Liste mit Reparaturen zurück. Und dann müssen wir natürlich noch die ganzen Ganoven fernhalten«, seufzt er und deutet mit einer weiten Handbewegung Richtung Straße.
»Welche Ganoven?«, fragt Antonia. Eine kleine Furche zeigt sich zwischen ihren Augenbrauen.
»Na ja, die ganzen Banditen eben. Die Diebe, Einbrecher, Fassadenkletterer, Vergewaltiger und Schlimmeres. All das Gesindel sucht jetzt in der Ferienzeit Straße für Straße, Palazzo für Palazzo nach leichter Beute ab. Erst vor einer Woche wurde zwei Häuser weiter im dritten Stock alles ausgeräumt. Der Hausmeister hat nichts gemerkt. Aber hier brauchen Sie überhaupt keine Angst zu haben. Ich passe ja auf.«
Filippo spürt Antonias zweifelnden Blick und versichert: »Federica passt mit auf. Außerdem haben wir Alarmanlagen, eine fürs Treppenhaus und eine für jede Wohnung. Die in Ihrer Wohnung ist leider kaputt. Aber gleich nach den Ferien wird sie gerichtet.«
Filippo führt uns zu einem großen Drahtkäfig in der Mitte der Halle. Die darin verlaufenden dicken Kabel setzen sich in Bewegung, als der Hausmeister auf einen Knopf an der Vorderseite des Käfigs drückt. Ratternd senkt sich ein hölzerner Aufzug aus dem dunklen Schacht herab. Filippo zieht die Drahttüre auf, klappt die beiden hölzernen Innentürchen auf und bittet uns in die Aufzugskabine, die mit ihren geschwungenen Spiegeln an den glänzenden hellbraunen Holzwänden aussieht wie ein Biedermeierzimmer. Rumpelnd geht es nach oben in den dritten Stock. Filippo nimmt einen langen Schlüssel mit gezacktem Bart aus der Tasche und dreht ihn viermal im Schloss.
»Die Tür ist gepanzert«, sagt er, während er sie aufzieht. »Bitte schön, treten Sie ein.«
Es ist atemberaubend – wenn auch leider nur im wahrsten Sinne des Wortes. Ein heißer, modriger Luftschwall schlägt uns aus dem stockdunklen Flur entgegen. Vorsichtig taste ich mich hinein. Mir ist, als dringe ich in eine altägyptische Grabkammer vor, und mir wird augenblicklich schwindlig. Hier ist offenbar den ganzen heißen Sommer über nie gelüftet worden. Ich stolpere zum erstbesten Fenster und reiße es auf. Die hereinströmende warme Stadtluft kommt mir wie ein Labsal vor.
»Es ist vielleicht ein wenig stickig hier drinnen«, sagt Filippo mitfühlend, »und Sie können natürlich gern nachts die Fenster auflassen. Aber seien Sie vorsichtig! Die Ganoven warten nur auf so eine Gelegenheit. Bei Freunden von uns sind sie vor einer Woche durch ein gekipptes Fenster eingestiegen.«
»Und was ist dann passiert?«
»Sie haben unsere Freunde mit einem K.-o.-Spray betäubt und alle Wertgegenstände mitgenommen.«
Wir beschließen dennoch, in dieser Nacht lieber beraubt zu werden, als zu ersticken. Zumal die Wohnung ja noch leer ist. Leer und dunkel. Antonia tastet die Wände nach einem Lichtschalter ab, findet ihn und drückt darauf. Nichts geschieht.
»Sie müssen sich erst bei einem Stromversorger anmelden«, erklärt Filippo. »Das kann jetzt in der Ferienzeit natürlich etwas dauern. Aber ich helfe Ihnen gleich morgen, dort anzurufen.« Dann zieht er zwei Kerzenstummel hervor und zündet sie an. Im schummrigen Licht sehen wir, dass der weiß geäderte schwarze Marmorfußboden mit einer dicken Schicht aus Staub und grünlichen Baumpollen überzogen ist. Ich bin Pollenallergiker. Filippo mustert uns fragend. Er will endlich nach Hause.
»Wo werden Sie heute Nacht schlafen? In einem Hotel?«
»Nein … hier«, antworte ich zögernd. »Wir haben Isomatten und Decken mitgebracht. Morgen früh kommt dann der Laster aus Deutschland mit unseren Möbeln.«
Filippo schaut erst uns an, dann den dreckigen Boden und danach wieder uns. Schließlich reckt er leicht den Kopf und gibt einen dreifachen Schnalzlaut von sich: »Ts, ts, ts.«
Wir lernen bald, dass dies eine sehr vielseitige, vor allem in Süditalien beliebte Redewendung ist. Sie bedeutet, je nach den Umständen: »So etwas führen wir hier nicht.« – »Das geht nicht.« – »Das ist nicht erlaubt.« – »Das tut man nicht.« In unserem Fall meint Filippo: So lasse ich Sie hier nicht übernachten. Wortlos fährt er nach unten, um kurz darauf zwei bequeme Feldbetten hereinzuschleppen und in einem der Zimmer aufzubauen.
»Ein Römer würde so etwas nie für Sie tun«, erklärt er uns, damit wir uns keine Illusionen machen. »Die Römer sind kühl und scheren sich nicht um Fremde.« Er guckt uns tief in die Augen. »Aber ich bin zum Glück Neapolitaner.«
Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Zwei
Auch in dieser Nacht schlafe ich schlecht. Die offenen Fenster bringen nur wenig Kühlung. Und ich muss ständig an die Ganoven denken, die nun in Trupps durch die Straßen ziehen. Vorsichtshalber lege ich mein kleines Schweizer Taschenmesser neben das Bett. Immer wieder stehe ich auf, mache mir mit meinem Handydisplay ein wenig Licht und tapse den Gang entlang von Raum zu Raum. Etwas huscht über eine Wand des Wohnzimmers. Verharrt. Huscht weiter. Zögernd gehe ich näher heran und entdecke einen Mauergecko. Seine schwarzen Augenpunkte blicken mich freundlich an. Wenigstens sind wir nicht allein.
Irgendwann schlafe ich doch ein. Im Traum erscheinen mir meine Eltern, die Nachbarn, mein Freund Klaus und sogar der Chefredakteur meiner Zeitung. Sie murmeln im Chor: »Wir beneiden euch! Leben in Rom! Habt ihr’s gut!«
Ich wache auf, als es tagt, schleiche durch die schmutzige Wohnung und trete auf einen der Balkone. Er ist so klein, dass man gerade einmal zwei Stühle daraufstellen kann, und er geht auf die Straße hinaus. Draußen ist es verblüffend ruhig. Rom ruht noch. Nur die Vögel begrüßen bereits die ersten Sonnenstrahlen, die über die Hügel der Stadt mit ihren karminroten Dächern und tiefgrünen Pinien, über Türme und Kuppeln, Palmen und Zypressen streichen. Die Luft ist weich und duftig. Plötzlich erschauern die Blätter einer Akazie vor dem Haus und eine ganz leichte Brise bringt den Salzgeruch des Meeres mit.
Da ahne auch ich, wie gut wir es haben.
Ich wecke Antonia und wir gehen in die geräumige Ikea-Küche mit Blick hinab auf einen stillen, grünen Innenhof. In der Spüle liegen noch wer weiß wie alte Brotstücke und ein undefinierbarer, von grauem Schimmel umflockter Speiserest. Ein Drehknopf des Gasherdes ist abgerissen. Ich drücke die anderen Knöpfe – nichts tut sich. Immerhin tropft der Wasserhahn. Es gibt also fließend Wasser, allerdings nur kaltes. Der riesige Kühlschrank funktioniert nicht – klar, wir haben ja noch keinen Strom. Dafür sitzen eine Menge kleiner fahler Falter an der Decke und auf den Ablagen. Federica wird uns später versichern, die Tierchen seien völlig harmlos. Sie kämen von draußen herein, wenn sie etwas zu Essen witterten. Antonia ist da anderer Meinung. »Das sind Mehlmotten«, sagt sie so angeekelt, als tummelten sich Skorpione und giftige Riesentausendfüßler in unserer Küche. Wochenlang wird sie nun in Rom auf die Suche nach Mottenfallen gehen und sich schließlich von ihrer Mutter aus Deutschland welche schicken lassen.
Nun aber essen wir erst einmal die Kekse, die von der Fahrt übrig geblieben sind. Dazu trinken wir lauwarmes Wasser aus einer Plastikflasche. Unser erstes Frühstück in Rom.
Während wir beide unseren Gedanken nachhängen, klopft es plötzlich energisch an der Tür. Draußen steht Filippo mit einem Aluminium-Kännchen, aus dem es nach Espresso duftet. »Dottor Uuulrik«, sagt er, »möchten Sie ein bisschen caffè?« Dann fragt er, ob er eintreten dürfe, und kommt, ohne die Antwort abzuwarten, herein. Wie es uns so gehe, will er leutselig wissen.
Auf diese Frage hat man in Italien erst einmal und unter allen Umständen zu antworten, es gehe einem hervorragend. Erst danach tauscht man sich über Krankheiten, Autopannen, Wasserrohrbrüche und Todesfälle in der engeren Verwandtschaft aus. Antonia aber neigt selbst für deutsche Verhältnisse zu großer Direktheit. Daher deutet sie ohne Umschweife auf den schmutzverkrusteten Boden, die staubblinden Fenster, den desolaten Herd, die Falter und den offen stehenden, weil stromlosen Kühlschrank.
Filippo reibt sich das Kinn, mustert uns und setzt sein mitfühlendes Lächeln auf, das bedeuten soll: Ja, ja, die Welt ist schlecht. Dann sagt er: »Wissen Sie, nach dem Auszug der Vormieter bin ich im Juni mit Signor Cornetti durch die ganze Wohnung gegangen. Ich habe ihm alles genau gezeigt und gesagt, hier müsse gründlichst geputzt und einiges repariert werden.«
Der padrone habe jedoch nur geantwortet: »Jetzt warten wir erst einmal ab, ob es die neuen Mieter überhaupt bemerken. Dann können wir immer noch etwas unternehmen.«
»Natürlich merken wir es und beschweren uns auch«, ruft Antonia erbost. »Wo ist denn dieser Signor Cornetti? Wir haben ihn ja noch gar nicht gesehen.«
»Der padrone ist in Argentinien, und zwar noch mindestens fünf Wochen«, sagt der Hausmeister. »Er verbringt jeden Sommer dort bei seinem Bruder, der vor vielen Jahrzehnten ausgewandert ist und sich eine Wein-Hazienda gekauft hat. Wenn Signor Cornetti im September zurückkommt, wird er sich gewiss um alles kümmern, um die Alarmanlage, um Gas und Strom und natürlich um die Reinigung der Wohnung.«
»Aber unsere Möbelpacker rücken heute, jetzt, in den allernächsten Stunden an«, rufe ich lauter als gewollt, der Verzweiflung nahe. »Unsere Kinder kommen in ein paar Tagen. Und überhaupt müssen wir ab sofort hier leben und arbeiten. Wir können nicht bis September warten.«
Filippo tippt mir beruhigend mit den Fingern auf die Schultern. »Natürlich nicht. Federica und ich werden Ihnen helfen. Aber: con calma, tutto con calma – alles mit der Ruhe.«
»Con calma«, diese beiden Wörter bekomme ich in den folgenden Wochen noch oft zu hören. Von Federica, von Signor Cornetti, bei der Telecom, im Finanzamt und vielen anderen Behörden. Anfangs sträubt sich alles in mir dagegen. Ich habe mir bei meiner Zeitung vier Wochen Urlaub für den Umzug genommen und will bis zum ersten September alles »erledigt« haben: Wohnungseinrichtung, Anmeldungen, Anschaffungen und wenn möglich auch noch die Erkundung Roms und des Umlandes.
Noch an diesem ersten Tag in der »neuen« Wohnung erstelle ich eine lange Liste mit all den Dingen, die ich systematisch, gründlich, schnell und unbeirrbar abzuarbeiten gedenke. Sie reicht vom Bepflanzen der Balkone über den Erwerb einer Mottenfalle mit hormonellen Lockstoffen und dem Abschluss eines italienischen Handyvertrages bis hin zur Akkreditierung als Journalist beim Heiligen Stuhl. Gut 30 Punkte habe ich bald auf meinem DIN-A4-Blatt beisammen. Dafür sollten vier Wochen wohl reichen.
Doch da habe ich leider die Rechnung ohne die Italiener gemacht. Mit einem mal freundlichen, mal störrischen »con calma« lassen sie meinen teutonischen Tatendrang ins Leere laufen. Dieses »Immer mit der Ruhe« wird mich noch manches Mal zur Raserei bringen. Doch allmählich werde ich aus der Beobachtung nationaler Leidensgenossen lernen, dass es nur zwei Arten gibt, darauf zu reagieren: sich auflehnen und dem Land, wo die Zitronen blühen, alsbald enttäuscht den Rücken kehren. Oder sich fügen und Italien erleben, erleiden und neu lieben zu lernen. Ich werde schließlich den zweiten Weg wählen. Aber bis dahin wird es noch dauern.
Fürs Erste sind Antonia und ich Filippo für seinen Espresso dankbar. Noch dankbarer sind wir, als er wenig später seine Frau Federica heraufholt, um gemeinsam die nächsten Schritte bei der Urbarmachung unserer Wohnung zu beraten. Federica ist eine zierliche und dennoch zupackende, stets gutgelaunte Frau. Als Tochter italienischer Gastarbeiter in Waiblingen geboren, fühlt sie sich ein wenig als tedesca, als Deutsche, obwohl sie ab ihrem dritten Lebensjahr in Italien aufgewachsen ist. Aufmerksam und wissbegierig wird sie fortan das fremdartige Leben der signori tedeschi in ihrem römischen Palazzo beobachten. Zunächst vereinbaren wir, dass uns Federica beim Putzen der Wohnung hilft. Später wollen wir dann versuchen, die Kosten bei Signor Cornetti einzutreiben.
Gerade als die Hausmeisterin mit Eimern, Wischlappen und Scheuermittel beladen heraufkommt, fahren unten auf der Straße die Möbelpacker mit ihrem Lastwagen samt Anhänger vor. Filippo hat sich eine orangefarbene Leuchtweste übergestreift, fuchtelt wild mit den Armen und weist sie an, halb auf dem Bürgersteig zu parken. Er erklärt uns, wir hätten eigentlich bei der Stadtverwaltung eine Sperrung des Straßenabschnittes für den Umzug beantragen müssen. Aber so gehe es auch. Dann entfernt er von einer nahen Baustelle einige rot-weiß gestreifte Absperrbänder aus Plastik und drapiert sie mit Hilfe von Besenstielen und Gartengeräten um unseren Lastwagen herum. Es sieht beinahe professionell aus.
»Wir brauchen vor allem Strom«, sagen die beiden Möbelpacker zu mir. »Dann können wir Ihre Sachen mit der Hebebühne zu Ihren Balkonen hochschaffen und müssen nicht mit all dem schweren Zeugs durchs Treppenhaus«, erklären sie mit einem schrägen Blick auf die massive Ulmer Kommode, die einst die Aussteuer meiner Ur-Urgroßmutter enthielt. Nur: Wir haben leider keinen Strom.
Filippo bemerkt meinen ratlosen Blick und versteht sofort. »Lo faccio io«, sagt er, »Ich kümmere mich schon darum.« Dann rennt er in den Keller des Palazzo und führt von dort ein Stromkabel herauf. So löst sich unser Problem. Und während Federica oben in der Wohnung fegt und wischt, wandern unsere Betten, Blumentöpfe, Bücherkisten, Schränke, Bilder und – jawohl – Skier und Skistiefel die Fassade hoch und zum Fenster hinein.
Filippo genießt es derweil sichtlich, in seiner orangefarbenen Schutzweste und mit geschäftiger Miene auf der Straße auf und ab zu patrouillieren und den Passanten und Bekannten aus der Nachbarschaft, die noch nicht im Urlaub sind, zu erklären, das alles sei »la roba«, das »Zeug« der signori tedeschi, die soeben unter seiner Regie und seinem Schutz diesen Palazzo bezögen.
Am Abend ist ein Wunder vollbracht, wie es in Italien manchmal geschehen kann. Zwar stehen gut hundert Kisten unausgepackt in den Räumen herum. Zwar gibt es immer noch kein Licht, kein Gas und kein warmes Wasser. Zwar scheinen sich die Motten beständig zu vermehren. Muff, Staub und Knaster aber sind aus der Wohnung verschwunden. Und die Möbel stehen mehr oder weniger an den Stellen, an denen sie in den kommenden Jahren auch bleiben sollen.
Filippo inspiziert sein Werk, nickt zufrieden und meint, es sei für ihn nun Zeit, »den Schalter zu schließen«. Mit diesen Worten geht er hinunter in seine Hausmeisterwohnung, die sich irgendwo hinter der Pförtnerloge im Tiefparterre des riesigen Palazzo verbirgt. Federicas Pasta ist schon fertig.
Antonia und ich dagegen ziehen – oder genauer schwanken – noch, hundemüde wie wir sind, durchs Viertel. Wir entdecken eine kleine Trattoria, vor der einige Tische auf dem Trottoir stehen. Die römischen Straßenlaternen mit ihrem gelben Licht dringen kaum durch die heiße Nacht. Ausgehungert bestellen wir carciofi alla romana – in Wasser und Olivenöl gekochte und mit Minze, Knoblauch, Salz und Pfeffer gewürzte Artischocken –, im Ofen geschmortes Milchlamm mit Rosmarin-Bratkartoffeln und dazu una birra grandissima, ein sehr großes Bier.
»Sie sind wohl Touristen aus Deutschland?«, fragt die Kellnerin treffsicher.
Ich sehe Antonia an, und dann antworten wir wie aus einem Munde: »Nein, wir leben hier.«
Später rufen wir unsere Kinder an, die bei den Großeltern in Tutzing auf Neuigkeiten warten. »Gibt es in Rom Haie?«, will Nicolas wissen. Außerdem interessiert ihn, ob Haie eigentlich Schildkröten fressen.
Bernadette fragt besorgt: »Papa, geht es euch auch gut da in diesem Rom?«
In diesem Augenblick kann ich ganz ehrlich antworten: »Ja, mein Schatz, uns geht’s gut.«
Dennoch wird auch diese Nacht schlafarm. Es ist einfach zu heiß, um Ruhe zu finden. Der ferienverwaiste Palazzo ist so dunkel und still, dass ich noch das kleinste Geräusch wahrnehme. Schabt da nicht etwas an der Außenwand? Ist es der Gecko? Oder sind da etwa Fassadenkletterer am Werk? Im Wachtraum stelle ich mir vor, wie sie mich mit K.-o.-Spray betäuben und dann die Ulmer Kommode meiner Ur-Urgroßmutter lautlos aus dem Fenster abseilen. Anschließend fahren sie mit unseren Skiern die Fassade hinab und auf dem Tiber aus Rom hinaus. Schweißgebadet schrecke ich hoch.
»Wenn wir wenigstens Strom hätten, um einen Ventilator anzustellen«, murmelt Antonia hitzetrunken.
Da kommt mir eine Idee. Ich gehe ins Bad und lasse die Wanne mit kaltem Wasser volllaufen, denn kaltes Wasser ist das Einzige, was wir in unserer Wohnung haben. Wir legen uns abwechselnd hinein. Das hilft erst einmal. Eine Dauerlösung ist es aber eher nicht. Im Geiste schreibe ich meine Erledigungsliste um. Punkt eins lautet nicht mehr: Büro einrichten. Sondern: Strom beschaffen.
Drei
Als wir am nächsten Morgen schwitzend erwachen, hören wir ein Pfeifen im Hof. Ich trete auf den langen, schmalen Balkon unseres Wohnzimmers und sehe, wie Filippo, mit einem Reisigbesen bewaffnet, fröhlich und con grande calma ein paar Blätter und Piniennadeln zusammenfegt. Ich glaube, er genießt es, dass seine zahlreichen padroni alle im Urlaub sind und ihm keiner irgendwelche Anweisungen geben kann. Leider muss ich nun seinen Morgen stören: »Guten Morgen, Filippo«, rufe ich hinunter. »Wie geht es Ihnen?«
»Hervorragend«, antwortet er. »Und Ihnen?«
»Ausgezeichnet«, flöte ich zurück. »Ich habe allenfalls ein problemino, ein Problemchen. Wir bräuchten endlich ein wenig Strom, genauer gesagt subito, sofort.«
Filippo nickt bedächtig und ruft von unten hoch: »Gerade habe ich noch zu tun. Aber sobald ich fertig bin, werde ich Ihnen helfen, dottor Uuulrik.« Er greift wieder zum Besen und fährt fort, im Zeitlupentempo den Hof zu entblättern. Ich zucke resigniert mit den Achseln und mache mich daran, Bücher aus den Kisten zu nehmen und die Regale zu füllen.
Im nächsten Augenblick klingelt mein Handy, einen Festnetzanschluss haben wir ja noch nicht. »Pronto«, melde ich mich und komme mir dabei schon extrem italienisch vor.
»Pronto«, erwidert eine vorsichtige Männerstimme. »Spreche ich mit Signor Uuulrik?«
»Si, sono io«, antworte ich. »Chi parla?«
Die Italiener sind ja ein sehr kommunikatives Volk. Ihre Telefonate aber beginnen sie wie Autisten. Statt sich mit ihrem Namen vorzustellen, melden sie sich stets mit einem anonymen pronto – die vorsichtigste Form eines verbalen Sich-Abtastens. Der Anrufer weiß also nie, ob er den richtigen Anschluss erreicht hat und, falls ja, ob er nun mit dem Hausherrn, dessen Sohn, dem Hausfreund der Gattin, einem Gast, Hausmeister oder sprachgewandten Papagei parliert. Daher schickt er erst einmal selbst ein »Si, pronto« in den Äther, um sich dann der Identität seines Gesprächspartners zu versichern. »Parlo con il signor Uuulrik?« Worauf der Angesprochene nun seinerseits zurückfragen muss, mit wem er eigentlich die Ehre habe.
So sind rasch mehrere Telefoneinheiten verstrichen, ehe man endlich zur Sache kommt.
Bis heute habe ich nicht herausbekommen, was das pronto-Ritual eigentlich soll. Allerdings habe ich mir eine Theorie zurechtgelegt. Diese Privacy-Theorie besagt: So kontaktfreudig die Italiener auch sind, sobald es an die eigenen vier Wände geht, geben sie sich zugeknöpft. La casa, so heißen Haus und Wohnung gleichermaßen, ist ein heiliger Ort und – im Gegensatz zur Piazza – der Familie, den engsten Freunden sowie als äußerst vertrauenswürdig überprüften Postboten und Fischhändlern vorbehalten. Niemals würde man einen entfernteren Bekannten so mir nichts dir nichts in die casa lassen. Da trifft man sich lieber unten in der Bar. Da das Telefon aber so etwas wie Ohr und Mund der casa ist, gelten die Privacy-Regeln auch hier. Das pronto dient folglich als eine Art Türspäher: Da wollen wir doch erst einmal sehen oder vielmehr hören, mit wem wir es zu tun haben.
Nachdem mein Anrufer also herausgefunden hat, dass tatsächlich il signor Uuulrik am Apparat ist, macht er sich an eine weitschweifige Erklärung, wer er selbst eigentlich sei. Er stellt sich als Angelo Neri vor – ich halte das gleich für einen Tarnnamen – und behauptet, er habe einen meiner Freunde, einen gewissen Karl, auf einer Wanderung im Umland von Rom getroffen. Sie hätten zusammen in einem Weiler namens Calcata ein Bier getrunken und seien ins Gespräch über die Etrusker gekommen. Dabei habe er diesem Signor Karl einiges über seine Entdeckungen erzählt und Signor Karl habe gemeint, das könne mich interessieren, den neuen Korrespondenten einer deutschen Tageszeitung in Rom. Daraufhin habe Signor Karl meine Telefonnummer weitergegeben, und deshalb rufe er, der Etrusker-Experte, jetzt bei mir an.
Nun ist Karl tatsächlich einer meiner ältesten Freunde. Ich kenne ihn noch aus unserer Studienzeit in München. Wir teilen seit jeher eine diffuse Italienschwärmerei und haben uns darin stets gegenseitig bestärkt. Unvergessen sind mir die italienischen Abende bei Karl, wenn in seiner WG die selbstgemachten Nudeln zum Trocknen über Stuhllehnen, Bettgestellen und Wäscheständern hingen. In seiner Studentenbude klebten keine Pin-up-Girls und auch nicht Marx und Lenin an der Wand, obwohl Karl bekennender Kommunist war, sondern Fotos von Salina, einer bildhübschen Insel vor Sizilien mit zwei spitzen Vulkankegeln. Karl hat es viel früher geschafft als ich, nach Italien zu ziehen. Er lebte zunächst als freischaffender Philosoph in Orvieto und begann irgendwann, deutsche und amerikanische Touristen durch Italien zu führen. Obwohl er so sein Hobby zum Beruf machte, verlor er nie die Begeisterung für das Land und fuhr fort, in jeder freien Minute auf Entdeckungstour zu gehen. So ist er wohl auch auf meinen Anrufer gestoßen.
»Weshalb genau rufen Sie mich an?«, frage ich nun.
»Es geht um eine Sache mit den Etruskern. Allerdings würde es zu weit führen, das am Telefon zu erörtern«, flüstert die Männerstimme. »Man weiß ja nie, wer alles mithört. Am besten wir verabreden uns irgendwo in Rom.«
Ich überlege nur kurz. Einerseits habe ich in diesen Tagen überhaupt keine Zeit, schließlich ist noch nicht einmal Punkt eins – die Sache mit dem Strom – auf meiner 30-teiligen Liste abgehakt. Andererseits entwickelt man als Journalist ein Gespür für interessante Geschichten. Und diese Geschichte könnte zumindest interessant werden. Also sage ich:
»Na gut, wo treffen wir uns?«
Der Mann erwidert: »Kennen Sie die Villa Giulia?«
Ich weiß, dass es sich um eine frühere Sommerresidenz der Päpste in Rom handelt, in der heute das italienische Etrusker-Museum untergebracht ist. Ich war vor 20 Jahren als Student schon einmal dort, habe aber nur noch eine vage Erinnerung daran.
»Ja«, sage ich, »ich weiß, wo das ist.«
»Sehr gut. Im Garten der Villa steht ein rekonstruierter etruskischer Tempel. Kommen Sie am übernächsten Montagabend um sieben Uhr dorthin.«
Noch ehe ich antworten kann, hat der Mann aufgelegt. Doch meine Neugierde ist geweckt. Ich platziere meinen neuen römischen Terminkalender mitten auf einen Stapel mit Kisten im künftigen Arbeitszimmer und trage meine erste römische Verabredung ein.
»Signor Uuulrik«, ruft Filippo in diesem Moment von unten herauf. »Wir können uns jetzt um Ihren Strom kümmern.«
Hastig – wie ein Verdurstender im Angesicht einer Oase – stolpere ich die vielen flachen Steinstufen des Treppenhauses hinunter.
Der Hausmeister hat bereits sein Telefonbuch hervorgeholt und die Nummer eines großen italienischen Energieversorgers herausgesucht. »Rufen Sie mal da an«, fordert er mich auf.
Wir gehen in den Innenhof des Palazzo und ich setze mich auf eine Steinbank zu Füßen einer haushoch aufragenden, schattenspendenden Zeder. Hier beginnt mein erstes italienisches Telefon-Behörden-Abenteuer. Ich wähle die Nummer. Eine Computerstimme antwortet, diese Nummer sei überholt, und nennt eine andere. Als ich sie eintippe, meldet sich wieder eine roboterhafte, aber freundlich klingende Frauenstimme. Die Nummer sei ferienbedingt derzeit nicht besetzt. In dringenden Fällen solle ich bitte folgende Nummer wählen. Ich gerate erneut an eine Automatenstimme … doch diesmal habe ich mehr Erfolg.
Angestrengt lausche ich der italienischen Ansage: »Wenn Sie an unseren Energieangeboten interessiert sind, drücken Sie die Taste eins. Wenn Sie einen Gasoder Lichtanschluss benötigen oder beides, drücken Sie die Taste zwei. Wenn Sie einen Antrag auf Freischaltung eines bereits bestehenden Gas- oder Lichtanschlusses oder beides stellen wollen, drücken Sie …«
So geht es munter weiter, in rasender Geschwindigkeit und mit einem Behördenvokabular, dem ich nur mit Mühe folgen kann.
Zwar habe ich bei früheren Sprachaufenthalten in Rom und auf vielen Italien-Reisen ein passables Italienisch gelernt. Ich kann eine normale Unterhaltung führen, Zeitung lesen und die Fernsehnachrichten verfolgen – also all das, was ich als frischgebackener Italien-Korrespondent meiner Zeitung fürs Erste brauche. Die – selbst für Italiener – bis zur Unverständlichkeit verfeinerte Behördensprache des Landes bringt mich aber, zumal am Telefon, rasch an meine Grenzen.
Mir schwirrt der Kopf, als endlich die erlösende Auskunft kommt: »Falls Sie sonstige Auskünfte brauchen, drücken Sie die Taste null.« Ich drücke die Taste null. Es tutet – ein Mal lang, zwei Mal lang, dann knackt es, und ich fliege aus der Leitung. »Tut, tut, tut, tut«, das Besetztzeichen. Ich wähle noch einmal die Zentralnummer und drücke gleich zu Beginn der Computeransage die Taste null. Aber das hilft mir gar nichts. Unbarmherzig rattert die Stimme die einzelnen Möglichkeiten herunter.
Filippo, der die ganze Zeit mit seinem Besen in der Hand dabeisteht, fragt mich, ob alles in Ordnung sei. Antonia beugt sich hoch oben vom Balkon herab und schreit: »Stefan, klappt es jetzt mit dem Strom?« Sie wolle die Bohrmaschine anstecken, um die Dübellöcher für unsere Bilder zu bohren.
»Ja, ja, es scheint zu klappen«, brülle ich zurück und drücke diesmal die Taste zwei.
Die alte, freundliche Computerstimme meldet sich mit einer neuen Information zurück. »Sie haben den Service für einen Gas- oder Lichtanschluss oder für beides gewählt. Leider sind derzeit alle unsere Beratungsplätze besetzt. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.«
Ich erwäge kurzzeitig, das Handy gegen den Zedernstamm zu schmettern.
Filippo grinst mich halb spöttisch, halb mitleidig an. Er kennt das alles seit Jahrzehnten, schließlich ist er in Italien groß geworden. »Vuole un bicchierino di grappa, dottore?«, fragt er mich. »Möchten Sie ein Gläschen Grappa?« Ich bitte ihn, doch endlich den dottore wegzulassen, und sage ansonsten weder ja noch nein.
»Federica«, schreit Filippo Richtung Hausmeisterwohnung. »Il dottore vuole una grappa.«
Verwundert kommt Federica mit einer dünnen, langen Flasche und zwei Gläsern heraus. »Es ist noch früh«, sagt sie und hat damit zweifellos recht.
Filippo und ich stoßen auf Rom an und stürzen unsere Gläschen hinab. Danach ist mir noch heißer. Ich denke wieder an den Starnberger See und das flauschige Grün der Roseninsel. Meine beiden Kinder planschen mit mir vergnügt im seichten Wasser. Wir haben Ferien, und alles ist gut.
Offenbar leide ich bereits an Halluzinationen. Nichts ist gut. Es geht gegen Mittag unseres dritten Tages in Rom, und noch immer ist Punkt eins meiner Liste nicht abgearbeitet. Filippo meint mal wieder, für ihn sei es nun Zeit, den Schalter zu schließen. Federica habe bereits Pasta aufgesetzt. Wir würden es am Spätnachmittag noch einmal probieren.
Vier Stunden danach trappele ich wieder die Steinstufen in den Innenhof hinunter. Filippo grüßt mich von einer Leiter herab. Er ist gerade dabei, die Ligusterbüsche zu kappen und dürre Wedel aus den Stechpalmen zu schneiden. »Jetzt, wo der ganze Palazzo im Urlaub ist, habe ich endlich einmal Zeit für solche Dinge«, sagt er.