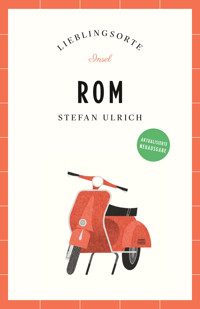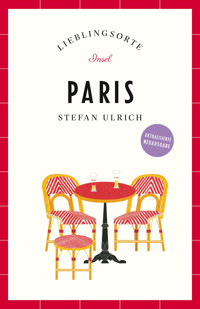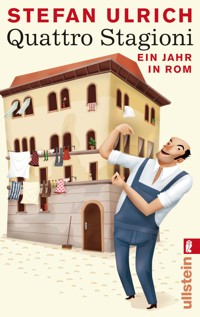12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nach vier Jahren in Bella Italia müssen Stefan Ulrich und seine Familie ihr geliebtes Rom verlassen und samt Meerschweinchen nach Frankreich umziehen. Müssen? Paris, die Stadt der Liebe, das ist doch ein Traum - schmachten die Freunde in Deutschland. Savoir vivre! Doch die Ulrichs fremdeln erst einmal an der Seine. Meer und Berge sind weit, beim Einzug platzt gleich ein Wasserrohr, das Schulfranzösisch erweist sich als peinlich unzureichend, und die französischen Nachbarn sind keine Italiener. Sie reagieren verschnupft, als sie Prosecco statt Champagner vorgesetzt bekommen. Die Ulrichs aber sind wild entschlossen, ihre neue Heimat lieben zu lernen. Sie erkunden Stadt, Land und die Seele der Franzosen und erleben bald, warum Gott tatsächlich in Frankreich lebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Nachdem Familie Ulrich vier aufregende Jahre in Rom verbracht hat, heißt es im Sommer 2009: Umzug nach Paris – die Stadt der Liebe und des Savoir-vivre soll die nächste Station des Auslandskorrespondenten der Süddeutschen Zeitung sein. Doch während seine Frau vom Wechsel an die Seine sehr angetan ist, hegt Stefan Ulrich gewisse Zweifel. Zum einen hat er Italien und das Dolce Vita in sein Herz geschlossen, zum anderen sind seine Sprachkenntnisse seit dem Grundkurs am Gymnasium etwas eingerostet. Und so gestalten sich die ersten Wochen und Monate in der neuen Stadt mal überraschend kompliziert, mal heiter-katastrophal. Von der Wohnungssuche mit astronomischen Mietpreisen über Hausmeister und Handwerker, die sich als Künstler verstehen, bis hin zum Versuch, Nicolas Sarkozy dazu zu bewegen, ein Interview zu geben, bleibt vor allem eine Erkenntnis: Die Franzosen sind ein merkwürdiges Volk, aber trotzdem merkwürdig liebenswert.
Der Autor
Stefan Ulrich, Jahrgang 1963, ist Paris-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Über seine Zeit als Rom-Korrespondent hat er zwei überaus erfolgreiche Bücher geschrieben, Quattro Stagioni und Arrivederci, Roma!, beide im Ullstein Taschenbuch erschienen.
Von Stefan Ulrich sind in unserem Hause bereits erschienen:Quattro Stagioni – Ein Jahr in RomArrivederci, Roma! – Ein Jahr in Italien
Besuchen Sie uns im Internet: www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
ISBN 978-3-8437-0439-7
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2013Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, BerlinTitelillustration: © Isabel Klett
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
eBook: LVD GmbH, Berlin
Für Annette, Franziska und Julius
Eins
Letzte Sonnenstrahlen blitzen zwischen den bewaldeten Hügeln hervor. Doch der Abendnebel steigt bereits aus den Schluchten. Er kriecht den Hang hoch, nistet sich zwischen den Natursteinhäusern mit ihren Schieferdächern ein, wabert um meine Füße und jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ich verfluche die Ledersohlen meiner Schuhe und den leichten, in fröhlichem Mausgrau gehaltenen Anzug, den ich für diesen Termin angelegt habe. Jeans und Bergstiefel wären passender gewesen.
Steil steigt der Pfad zwischen Rebgärten empor, in denen herbstliche Weinstöcke stehen. Stumm und duldsam. In Reih und Glied. Wie Soldaten. Hier, im Land der Flüsse Marne und Aisne, haben im Ersten Weltkrieg Deutsche und Franzosen erbittert um jeden Hügel gerungen. Die Böden sind mit Wut und Blut getränkt. Und doch bringen sie einen Tropfen hervor, der in der ganzen Welt für Freundschaft und Feierfreude steht: Champagner.
Etwa eine Million Euro ist ein Hektar des gelobten Schaumweinlandes heute wert. In Gegenden außerhalb des streng begrenzten Anbaugebietes bringt der Hektar höchstens 10 000 Euro ein. Die kleinen Rebenhänge nordwestlich von Reims, durch die ich gerade stapfe, tragen die Champagnersorten Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Doch ihre Trauben dürfen nicht zu Champagner werden. Denn sie reifen knapp jenseits der Appellation. Das erbost die Weinbauern des gottverlassenen Weilers, der nun vor mir auftaucht. Sie wollen hinein ins Champagnerland, wie viele andere Dörfer der Region. Doch die Champagner-Winzer achten eifersüchtig darauf, dass das Anbaugebiet nicht zu groß wird und ihr sündteurer Schaumwein nicht verwässert. Seit Jahren tobt daher ein Rebenkrieg in der Champagne. Deshalb bin ich ja hier.
Schlotternd streife ich zwischen den einfachen Häusern umher, auf der Suche nach der Mairie, dem Rathaus, in dem mich zwei der Champagner-Rebellen treffen wollen. Ich halte nach einem flaggengeschmückten Empire-Schlösschen Ausschau, in dem französische Ortsvorsteher normalerweise residieren. Vergeblich. Ich klopfe an Türen. Ohne Antwort. Vierzig Menschen leben in diesem abgelegenen Dorf, habe ich vorher in meinem Hotel in Reims im Internet nachgelesen. Heute Abend scheinen sie alle ausgeflogen zu sein. Die Nacht sinkt herein. Die Kälte wird schärfer. Kein Licht leuchtet mir. Ich habe Hunger. Ein Gläschen Champagner würde meine Laune heben. Aber hier kann ich allenfalls aus einer rostigen Regentonne trinken. Müde und frierend setze ich mich auf eine Holzkiste. »Hallo! Ist da wer?«, rufe ich. Die Mauern geben nicht einmal ein Echo zurück. Ich schaue nach oben, zu den Sternen. Doch die verhüllt der Nebel. Ein Leben wie Gott in Frankreich hab’ ich mir anders vorgestellt.
Zu allem Überfluss ziehen vor meinem inneren Auge allerlei Gestalten auf. Es sind Kollegen aus der Zentrale meiner Zeitung in München. »Typisch Ulrich«, höre ich sie lästern. »Während wir in unserem schnöden Hochhaus zwischen Bahngleisen und Autobahn an der Zeitung für morgen schuften, während sich andere Korrespondenten durch den arabischen Frühling oder den Herbst des Euro kämpfen, sitzt der Ulrich in einem idyllischen Winzerstädtchen und recherchiert über Schaumwein!« Die Kollegen reden sich – in meiner Phantasie – in Rage. Sie malen sich aus, wie ich erst vier Jahre lang la dolce vita in Italien genossen habe, um mich nun, vier weitere Jahre, dem savoir vivre in Frankreich hinzugeben. »Paris! Amour! Juliette Binoche! Champagner!«, höre ich sie hämen. »Es reicht. Schickt den Ulrich in die Produktion – oder nach Nordkorea!«
Natürlich wären diese Reaktionen maßlos ungerecht. Sie könnten nur von Leuten stammen, die Juliette Binoche bloß aus dem Kino kennen und die nichts von der knallharten Recherche ahnen, die mich seit Tagen durchs Champagnerland mit seinen feuchten alten Kellern voller tückischer Hefepilze treibt. Habe ich mich dabei geschont? Nein, das habe ich nicht. Ich habe für diesen Artikel über den Schaumweinkrieg alles riskiert, sogar meine Leber.
Ich höre die Einwände: »Und gestern? Der Termin in dem Städtchen Avize bei der Union Champagne, der größten Kooperative der Champagner-Winzer? War das etwa harte Arbeit?«
Zugegeben, das Treffen verlief eher erquicklich. Zur Begrüßung entkorkten drei charmante Damen der Union Champagne diverse Schaumweinflaschen, damit ich, Amateur, der ich war, einen Blanc de Blancs von einem Blanc de Noirs zu unterscheiden lernte. Zum Mittagessen kredenzten mir drei Herren der Geschäftsführung verschiedene zu Fisch, Geflügel und Dessert passende Champagner. Zum Abschluss holten sie eine besonders dicke, grünbauchige Flasche mit handgeschriebenem Etikett aus dem Keller. Sie stammte aus einer Zeit, als mein Großvater im Sandkasten spielte, und öffnete sich mit einem trockenen »Plop«.
Natürlich war dieser Termin an der Champagnerfront nicht wirklich unangenehm, auch wenn es mir ein Höchstmaß an Konzentration abverlangte, all die Feinheiten über das Terroir, die Rebsorten, EU-Richtlinien und Vermarktungsstrategien zu erfassen – und das nach mehreren Gläsern. Dafür ist der Termin heute umso ernüchternder. Meine Gesprächspartner sind Kälte, Nebel, Hunger und Durst. Wenn das die Kollegen ahnten!
Dann sehe ich doch noch ein Licht am oberen Dorfrand aufscheinen. Vor einem niedrigen Haus hängen die Trikolore Frankreichs und das Sternenbanner der Europäischen Union. Zwei ältere Männer in groben Pullovern öffnen. Sie führen mich in einen kahlen, von Neonlicht erleuchteten Raum. An der Wand hängt, als einziger Schmuck, das Bild des streng dreinblickenden Staatspräsidenten. Gut, dass ich den Anzug angelegt habe! Die beiden Männer – der Bürgermeister und einer seiner Freunde – bitten mich, am schlichten Holztisch Platz zu nehmen. Dann reden sie sich in Wut. Eine Unverschämtheit sei das mit den Grenzen des Champagnergebietes, die gerade neu bestimmt würden. Da würden Gemeinden aufgenommen, die das gar nicht beantragt hätten. Ihr Dorf dagegen, das vor vielen Jahrzehnten bereits einmal Trauben an Champagnerhäuser geliefert und sich so viel Mühe mit seinem Antrag gegeben habe, müsse draußen bleiben. »Man will uns ausschließen«, ruft der Bürgermeister und knallt seine schwielige Faust auf den Tisch.
»Ein abgekartetes Spiel«, poltert sein Freund.
»Geradezu Rassismus«, tobt der Bürgermeister. Sein Dorf habe genauso gute Böden und das gleiche Mikroklima wie die besten Champagnerlagen. Dennoch werde es nun geschnitten, nur weil es – der Willkür der Historie wegen – nicht mehr in der Verwaltungsregion Champagne, sondern in der Picardie liege. Doch das lasse man sich nicht bieten. Man habe mit anderen übergangenen Gemeinden einen Verein gegründet und werde kämpfen.
Es herrscht wieder Krieg in der Champagne, auch wenn diesmal nicht mit Kugeln, sondern mit Trauben geschossen wird. Natürlich gehe es ihnen nicht um all das Geld, das ein neuer Hektar Champagnerland bringe, versichern die beiden Rebellen ihrem verschreckten Besucher, also mir. »Wir kämpfen vielmehr um die Ehre unseres Dorfes.« Notfalls werde man sich mit Reims, Paris und Brüssel zugleich anlegen. Vercingetorix ist tot und Asterix nur eine nette Erfindung. Doch der Widerstandsgeist kleiner gallischer Dörfer bleibt so quicklebendig wie Champagner.
Zum Abschied schenkt mir der Freund des Bürgermeisters noch eine schwere grüne Flasche mit Kronenkorken und ohne Etikett. Sie enthält die Essenz seiner Äcker, ein sprudelndes Getränk, das er Champagner nennt, auch wenn er das nicht darf. »Probieren Sie und sagen Sie, ob das Champagner ist«, fordert er mich auf und lässt seine Augen unter den buschigen Brauen blitzen.
»Ich kann leider nicht, denn ich muss noch Auto fahren«, sage ich.
Die beiden Rebellen nicken stumm und denken sich wohl: »Die spinnen doch, die Germanen.«
Die Heimfahrt gestaltet sich auch ohne Champagner schwierig. Antonia, meine Ehefrau, lehnt Navigationsgeräte aus grundsätzlichen Erwägungen heraus ab. Zum einen, weil ihr als Nachfahrin schwäbischer Hausfrauen kostspielige Aufwendungen zuwider sind. Man will schließlich nicht wie die Griechen enden. Zum anderen, weil sie als Tochter eines zivilisationsskeptischen Diplomingenieurs neumodischer Technik misstraut. Wenn sie selbst schon keine Landkarten lesen könne, vermöge das ein kleiner Plastikkasten erst recht nicht, hatte Antonia behauptet. Ein Navigator komme ihr daher nicht an Bord. Mein Einwand, ich müsse mich bei meinen Dienstfahrten nun oft alleine im mir noch fremden Frankreich zurechtfinden, fruchtete zunächst nichts. Dann kam mir der Zufall in Gestalt der Zeitung Le Monde zu Hilfe. Das Blatt bot Neuabonnenten ein Navigationsgerät als Prämie an. Und da ich als Frankreich-Korrespondent schlecht ohne Le Monde auskommen kann, landete doch noch ein Navigator in unserem alten, silbergrauen Passat. Antonia besteht allerdings darauf, den Ton abzuschalten, wenn sie im Auto sitzt. »Denn ich kann diese Stimme nicht ertragen.« Außerdem behauptet sie, das Gerät, das meine Kinder aus unerfindlichen Gründen »Froni« tauften, führe ohnehin nur auf den Holzweg. Leider hat Antonia damit immer mal wieder recht.
An diesem Abend geleitet mich Froni allerdings zunächst anstandslos aus dem Dorf hinaus und auf die Landstraße. Die Fahrt geht durch die menschenleeren Gefilde der France profonde, des tief ländlichen Frankreichs. Äcker wechseln sich mit Laubwäldern ab. Ein Wildschwein taucht am Wegrand im Scheinwerferlicht auf. Dann befiehlt Froni: »Nach 250 Metern rechts abbiegen!« Obwohl Französinnen normalerweise viel Wert auf Manieren legen, kommt nie ein »Bitte« aus dem Lautsprecher. Und obwohl Französinnen geistreiche Streitgespräche lieben, lässt sie sich nie auf Diskussionen ein.
Mein Bruder, der in Bayern lebt, kann sich dagegen mit seiner Navigatorin unterhalten. »Du bläde Henna«, schreit er, wenn sie ihn auf Abwege führt.
Die Navigatorin antwortet dann etwas spitz, aber höflich: »Ich kann Sie leider nicht verstehen.«
Solche Subtilitäten sind meiner Froni fremd. »Jetzt rechts abbiegen!«, herrscht sie mich an. Natürlich folge ich ihr, schließlich kenne ich mich im wilden Grenzland zwischen Champagne und Picardie nicht aus. Ich lande auf einem geteerten Waldweg, der sich immer wieder verzweigt und schließlich zu einem schlammigen Pfad verengt. »Wenden«, schnauzt Froni. Dann behauptet sie, sie habe keinen Satellitenempfang mehr.
Daher beschließe ich, die Navigation persönlich zu übernehmen. Bei der Rückfahrt verirre ich mich im Geflecht der Waldwege. Es ist spät geworden. Kein Wildschwein ist mehr unterwegs. Froni hüllt sich in Schweigen. Ich stecke fest. Allein im tiefen Frankreich. In Dunkelheit und Kälte. Wenn das die Kollegen wüssten.
Während ich nervös gegen Fronis Gehäuse klopfe und im Schummerlicht der Innenbeleuchtung des Wagens vergeblich eine Landkarte zu Rate ziehe, baut sich eine Frage vor mir auf, groß und grundsätzlich:
Wie konnte es so weit kommen?
Noch vor wenigen Monaten war ich, ohne es immer zu wissen, der glücklichste Mensch der Welt. Ich lebte mit Antonia und unseren Kindern Bernadette und Nicolas in Italien, in Rom, also dort, wo ich immer leben wollte, seit ich als kleiner Junge erstmals mit meinen Eltern über die Alpen gefahren bin. In Rom gab es eigentlich alles, was ich mir wünschte: italienische und deutsche Freunde, einen meist azurblauen Himmel, Spaghetti allo scoglio auf einer Terrasse am Meer, Pinien und Zypressen vor antiken Ruinen und barocken Kuppeln, Berge zum Wandern und sogar Skifahren, einen Cappuccino auf der Piazza Santa Maria in Trastevere, Joggingwege im Park der Villa Doria Pamphili, einen Palazzo mit allerlei sympathisch-skurrilen Gestalten, in dem wir wohnten, und das rötlich-warme Licht, das all dem eine romantische Grundfärbung verleiht.
Zugegeben, ich bin jetzt nicht objektiv. Wie sollte ich es auch sein, da ich doch immer noch, oder wieder, verliebt in Italien bin. Warum ich das Land dann verlassen habe? Das ist eine andere Geschichte. Arrivederci, Roma!
Zwei
Jedenfalls stecke ich nun hier an diesem trüben Septemberabend in Nordfrankreich in der Sch… – pardon, im Schlamassel, statt in der lauen römischen Abendluft mit dem Hausmeister Filippo vor unserem Palazzo zu stehen und bei einer Tasse caffè oder einem bianco, einem Gläschen Weißwein, den Tag ausklingen zu lassen. Dabei hatte ich mich zuletzt auf den Abschied von Rom und den Neuanfang in Paris so gefreut. Als mich der Chefredakteur vor etlichen Monaten am Telefon fragte, ob ich mir vorstellen könnte, als Korrespondent nach Frankreich zu gehen, sagte ich nassforsch »Ja«; und Antonia, Bernadette und Nicolas taten das auch. Antonia war glücklich, an ihre zwei Studiensemester an der Sorbonne anknüpfen und ihre alte Liebe Frankreich auffrischen zu können. Die zwölf Jahre alte Bernadette schwärmte vom Eiffelturm und von der Pariser Mode. Nicolas, inzwischen neun Jahre alt, freute sich schlichtweg auf den Umzug, aufs Kistenpacken, den Riesenlaster, den Einzug in sein neues Zimmer. Auch hoffte er insgeheim, am französischen Atlantik endlich die ganz großen Fische zu fangen. Mich selbst lockte es, ein mir noch wenig bekanntes Land richtig gut kennenzulernen, um es dann den Lesern meiner Zeitung zu beschreiben. Ich war neugierig auf Frankreich, diesen charmanten Koloss aus Geschichte, Kultur und Lebensart. So träumten wir alle unsere kleinen Träume – und die Geschichte nahm ihren Lauf.
Anders als Antonia bin ich keiner, der gern unvorbereitet ins kalte Wasser springt. So trafen in unserer römischen Wohnung alsbald schwere Kisten voller Bücher ein. »Kulturschock Frankreich«, »Spaziergänge in Paris« oder »La France que j’aime« (»Das Frankreich, das ich liebe«), lauteten die Titel. Natürlich machte sich meine Familie über mich lustig.
»Du musst natürlich wieder einmal alles zuerst theoretisch angehen«, seufzte Antonia.
»Wo sollen wir denn diese unzähligen Bücher hintun?«, stöhnte Bernadette.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!