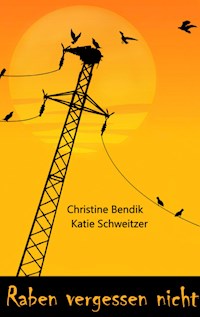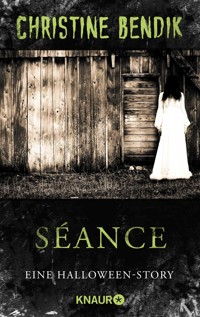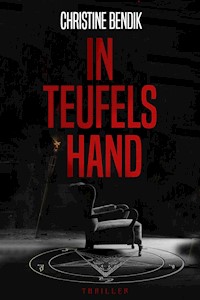
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Tod ist ihr Geschäft. Doch bei der Leiche, die Bestatterin Natalja in ihrem Hinterhof findet, handelt es sich um Mord. Die Hinweise auf eine Verbindung zwischen dem Ermordeten und ihrer als vermisst geltenden Schwester verdichten sich. In Natalja keimt die Hoffnung, dass Dana lebt und sie nimmt die Suche wieder auf. Ihre Nachforschungen führen sie zu einer Satans-Sekte, die in der Stadt ihr Unwesen treibt. Als sie sich der Gruppe nähert, gerät ihr Leben in höchste Gefahr. In Teufels Hand – ein Thriller mit Tiefgang "Ich weigerte mich, um Dana zu trauern, und hatte das Gefühl, sie schritte wie mein Schatten neben mir durch mein Leben."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christine Bendik
In Teufels Hand
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Impressum neobooks
Inhaltsverzeichnis
Christine Bendik schreibt Thriller und Kurzgeschichten. Ihr Buch „In Teufels Hand“ erschien 2014 als Originalausgabe unter dem Titel „Belzebub“ im Emons Verlag.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Über das Buch
Der Tod ist ihr Geschäft. Doch bei der Leiche, die Bestatterin Natalja in ihrem Hinterhof findet, handelt es sich um Mord. Die Hinweise auf eine Verbindung zwischen dem Ermordeten und ihrer als vermisst geltenden Schwester verdichten sich. In Natalja keimt die Hoffnung, dass Dana lebt und sie nimmt die Suche wieder auf.
Ihre Nachforschungen führen sie zu einer Satans-Sekte, die in der Stadt ihr Unwesen treibt. Als sie sich der Gruppe nähert, gerät ihr Leben in höchste Gefahr.
In Teufels Hand – ein Thriller mit Tiefgang
„Ich weigerte mich, um Dana zu trauern, und hatte das Gefühl, sie schritte wie mein Schatten neben mir durch mein Leben.“
Herausgeber Christine Bendik
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: © Shutterstock
Umschlag Schrift: http://www.schriftarten-fonts.de
Umschlaggestaltung: Christine Bendik
Lektorat: Christina Hornung, Aschaffenburg
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel „Belzebub“ im Emons Verlag
http://c-bendik.de
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbe-sondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
In Teufels Hand
Am Boden flackerten Kerzen, in der Form eines Pentagramms. Das Kind in ihrem Arm, trat Melda vor den mit Blütenranken geschmückten Altar. Nur das Beste für Luzifer, dachte sie stolz, und ihre kleine Maria gehörte nun ihm.
»Das Lamm des Teufels«, skandierten die Jünger, die den Altar umrundeten. Mit ehrfürchtigen Gesichtern verbeugten sie sich vor dem Säugling, wie bei gewöhnlichen Messen vor der mit Tinte von Tintenfischen gebackenen Hostie.
Luzifers tiefe Stimme erklang. »Amen. Satanas in Ewigkeit.«
Der Fluchtreflex ereilte Melda – nur einen Herzschlag lang. So klar war ihr Verstand selten. Tat sie das Richtige? Das hier wirkte verdammt ernst auf sie.
Nimm dein Kind und lauf.
Luzifer entzündete das trockene Johanniskraut in der Opferschale. Er legte den Rosenkranz verkehrt herum an, mit dem silbernen Kreuz im Nacken.
»Ad eum qui laetificat meum. Ad eum qui regit tenebrarum.« Vor ihn, der mir Freude bringt. Zu ihm, der die Erde regiert.
Das Feuer glomm hell auf. Ein vager, fremder Geruch mischte sich in den des Krautes, hornartig, schwoll an und verging, wie ein Aufbäumen. Es blieb die holzige Note.
Ein Bett aus schwarzen Rosen empfing das Kind. Zu spät für Maria. Eine Sekunde zu lang gezögert. Lob und Ruhm sei dir, Satan.
Die Apostel knieten nieder, die Kapuzen fielen. Rote Haarschöpfe kamen zum Vorschein.
Amen. In aeternam.
Kapitel 1
Natalja
Zwischen Traum und Erwachen kamen mir Bilder von meinem Kreta-Urlaub mit meiner Schwester Dana, als mein Blick auf die Rückenlehne meines Vordermannes fiel. Sonnenstrahlen tanzten darauf, und ihre rotgoldene Farbe erinnerte an Danas prachtvollen Lockenschopf.
Mir fielen die Augen noch einmal zu. Ich sah mich auf meiner gelben Luftmatratze am Strand liegen, hatte dreckige Füße und Sandkörner zwischen den Zähnen. Wind frischte auf, meine Zunge schmeckte das Salz des Meeres, und ein warmer Sprühregen traf meine Wange, der für eine willkommene Abkühlung sorgte. Dana war schwimmen gegangen und ich vermisste sie schon eine Weile. Ob sie den schwarzäugigen Don Juan von der Strandbar, von dem sie so schwärmte, wiedergetroffen und die Zeit vergessen hatte?
Wohlig schmatzend tastete ich nach Dana rechts neben mir. Statt des Saumes ihres geblümten Sommerkleides spürte ich Hosenbeine zwischen meinen Fingern.
Ich hörte ein Niesen und ein neuer Sprühregen benetzte meine Wange.
Abrupt erwachte ich, als der Blechvogel die Wolkendecke durchstieß und polternd sein Fahrgestell entfaltete. Ich sortierte meine Gedanken: Urlaub, Kreta, Flugzeug. Dieser Flug kam zwar aus Kreta, aber neben mir fand ich nicht Dana, die ich seit dem gemeinsamen Urlaub so sehr vermisste, sondern eine Person Marke Sky du Mont. Seine Augen waren braun, mit einem Schuss goldenen Gelbs wie Safran. Ich hatte das Gefühl, den Mann schon mal irgendwo gesehen zu haben.
Ein Blick in die Fensterreihe gegenüber zeigte vertraute Gesichter: Das Ehepaar Lehmann von Travel-Vital, den begnadeten jungen Tänzer aus dem Rolli-Tanzverein und das schwarzhaarige Mädchen, das bei den paralympischen Winterspielen eine Medaille abgesahnt hatte.
Ich wagte einen zweiten Blick in das Gesicht des Fremden.
»Salut«, stammelte ich, die ich, seit ich meinen Ehemann Carlos kannte, hin und wieder ins Spanische verfiel. Der Typ an meiner Seite schnarrte ein halbherziges »´Tschuldigung«. Ich musterte ihn aus den Augenwinkeln, feiner Anzug, goldenes Halskettchen.
Naserümpfend erklärte ich: »Kein Problem, Herr ...«
Er murmelte einen ausländischen Namen, dessen Klang im nächsten Niesanfall unterging. Die Feuchtigkeit traf mich zwischen den Augenbrauen, und mein Sitznachbar fummelte mir gleich darauf unbeholfen mit einem Taschentuch im Gesicht herum. Spontan dachte ich an den verkalkten Handbrausekopf in meiner Dusche, stellte fest, wie schlecht er vergleichsweise funktionierte, und schwor mir, beim nächsten Mal erster Klasse zu fliegen, wo die Sitzplätze bazillenfeindlichere Abstände hatten. Beim Stichwort Bazillen dachte ich außerdem an meinen hypochondrisch veranlagten Freund Marc.
Draußen regnete es auch, Bindfäden, toller Frühling. Ich griff nach der Tageszeitung in dem Netz am Vordersitz.
Frankfurt. Wasserleiche von Spaziergängern in Höhe Untermainkai entdeckt. Großer Gott. Hoffentlich nicht ... Kundschaft konnte ich immer brauchen, doch in Ausnahmefällen gönnte ich der Konkurrenz einen Auftrag. Eine Wasserleiche, das hieß: schwammiges Gesicht, aufgequollene Fingerbeeren, gruselig und immer noch gewöhnungsbedürftig. Meine Mitarbeiter hatten sich nicht gemeldet, also ging ich davon aus, dass die Leiche anderswo lagerte und nicht in meinem Institut.
Aus dem Lautsprecher drang die Stimme des Flugkapitäns: »Meine Damen und Herren, Flughafen Frankfurt. Condor bedankt sich für die angenehme Gesellschaft.«
Es blieb mir nichts anderes übrig, als zunächst auf meinem Platz zu verharren, Spiele der Geduld, die ich zwangsläufig täglich spielte. Ein bunter Menschenwurm drängte zur Gangway, internationale Geschäftsleute, Engländer, Deutsche, Urlauber in Hawaiihemden und kurzen Hosen, ein viel zu junger Mann für den dunklen Nadelstreifenanzug und die teure Seidenkrawatte.
Eine Frau mit rotem Haar, die mir ihre Rückansicht präsentierte. Dennoch traf mich fast der Schlag: Die lockige Pracht war schulterlang, ein Wirbel am Hinterkopf, eine einzelne schwarze Strähne, links. Es könnte wahrhaftig sie sein! Wenn ich das Haar dieser Frau betrachtete, konnte ich seinen Duft fast riechen. Wie hatte Paps, Gott hab ihn selig, Dana und mich stets genannt? Rotfuchs und: Goldköpfchen, das war ich. Die Jüngste, Claudia, tendierte zu straßenköterblond, einer Farbe, mit der Paps´ Einfallsreichtum sich erschöpfte.
Du Mont und der junge Flugbegleiter hoben mich aus dem Sitz, noch ehe meine Betreuer sich kümmern konnten, und brachten mich draußen zu meinem Rollstuhl. Bei dieser Aktion betrachtete ich, mit einem Gemisch aus Bewunderung und Verachtung, den in Gold gefassten Opal in Beerengröße an du Monts Ringfinger. Solche Schmuckstücke an Männerhänden konnte ich auf den Tod nicht leiden. Das erinnerte mich an ... Eine Szene aus dem Frankfurter Rotlicht-Millieu stand plötzlich vor meinem inneren Auge.
»Kann ich sonst noch was für Sie tun?«, erkundigte sich der Fremde, indessen er sein feines Sakko glattstrich. Ich dachte nur an Flucht vor weiteren möglichen Niesattacken, nickte dem Mann flüchtig zu und umklammerte die Rollstuhlreifen. Über glitzerndes Linoleum rollte ich in die klimatisierte Flughafenhalle und sah nur kurz zurück. Ein letztes Mal traf mein Blick auf den Nieser, als der die Richtung Gepäckausgabe einschlug. Plötzlich wirkte der Mann wie getrieben auf mich, sah sich andauernd um, so, als verfolge ihn jemand. Ich stellte grimmig fest, dass meine oft ausschweifende Phantasie durch die Ruhe im Urlaub nicht gedämpft, sondern eher noch angeregt worden war.
Carlos hatte angeboten, mich abzuholen. Ich hatte dankend abgelehnt, weil er sich just die letzte Schulstunde hätte freinehmen müssen, und die Fahrt mit dem Sammelbus, der mich bequem in die Frankfurter Innenstadt brachte, im Reisepreis inbegriffen war.
Vor der Heimreise gönnte ich mir eine Zigarette, obwohl ich das Rauchen aufgegeben hatte. Fünf Minuten Zigarettenlänge blieben, sie wiederzufinden unter all den Menschen und einen Blick auf ihr Gesicht zu erhaschen. Doch sie war wie vom Erdboden verschluckt. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass mir gewiss mal wieder eine Enttäuschung erspart geblieben war.
Den Hausflur mit der strapazierfähigen Laufstraße fand ich dunkel vor. Vom Haupteingang her nutzten ihn nicht nur meine Mitarbeiter Pit Halmich und Mona Ebbsen, sondern auch die werte Kundschaft, um in die Geschäftsräume des flachen, unterkellerten Anbaus linkerhand zu gelangen – zumindest die Lebendigen taten das. Die Anlieferung der Toten erfolgte über die Rampe im Hinterhof.
Aus dem Vogelzimmer im Obergeschoss drang das erregte Kreischen meiner Blaustirnamazone Papageno, kurz Geno genannt. Er erkannte mein Erscheinen an den Fahrgeräuschen meiner Rollstuhlreifen auf dem Parkett. Ansonsten war es ruhig, Pit und Mona hatten bestimmt schon das Wochenende eingeläutet. Wie stets hing ein süßlicher Geruch in den Winkeln und Ecken, dem man erfahrungsgemäß nur mit der Sprühflasche beikam. Die Fahrt mit dem Treppenlift in den ersten Stock dauerte eine gefühlte Ewigkeit. Ein zweiter Rollstuhl, für dessen Besitz ich einen harten Kampf mit der Krankenkasse ausgefochten hatte, erwartete mich direkt neben der Treppe. Mit der Leichtigkeit meiner mehrjährigen Übung glitt ich in seinen ledernen Sitz. Seit dem Brand meines Elternhauses und meinem dabei erlittenen bösen Sturz versagten mir meine Beine den Dienst.
Carlos hatte bereits Feierabend und empfing mich im Wohnzimmer, mit überkreuzten Beinen am Vertiko lehnend, das Telefon am Ohr. Ich maß seine hohe, schlanke Gestalt, den kastanienfarbenen Schopf, die lebhaften Augen in der Farbe von Zartbitterschokolade, die den Blick von der leicht groben Nase ablenkten. Knapp sieben Jahre kannten wir uns, zwei waren wir verheiratet – und ich war verliebt wie am ersten Tag. Ich hatte mächtig Sehnsucht, in seine starken Arme zu sinken.
»Nicht hier. Nicht jetzt«, flüsterte mein Gatte bei meinem Anblick in den Hörer. »Ich rufe zurück.«
»Geheimnisse?«, fragte ich lächelnd, als ich näherfuhr. »Frau Gesswein«, erklärte er, mit einem Nicken auf den Apparat. Gesswein war eine Kundin, deren Ehemann wir vor zwei Wochen beerdigt hatten. Sie habe die Rechnung verschlampt und bitte um eine neue. Ich solle mir keinen Kopf machen, er kümmere sich darum.
Dann breitete er die Arme aus. »Endlich, Querida. Du bist da. Wie war dein Flug?«
Ich sagte: »Gesswein also. Da läuft doch nichts, zwischen euch beiden?« Die Gesswein war über achtzig.
»Komm mal her.« Carlos beugte sich zu mir herab und bedeckte mein Gesicht mit Küssen. Ich roch sein Rasierwasser, herb und vertraut, doch etwas war anders. Sein Lächeln täuschte mich nicht über den fremden Ausdruck in seinen Augen hinweg. Hatte er wirklich mit meiner Kundin telefoniert? Seine Hand strich fest und in gleichmäßigen Zügen über meinen Rücken und ich genoss den Druck. Gleichzeitig spürte ich eine Distanz zwischen uns, die mir zu denken gab. Was ging in Carlos vor, missfiel es ihm, dass ich mir ab und an eine Auszeit gönnte?
»Ich bin müde. Gibt's Kaffee?«, murmelte ich.
Er half mir auf das Sofa mit den blauen Häkelkissen, wickelte meine Beine in ein dünnes Baumwollplaid und ging in die Küche, um Kaffee zu kochen.
Ich sah ihm nach, und, um meine Enttäuschung zu verbergen, griff ich nach der FAZ auf dem Glastisch. Die fette Schlagzeile warf eine Frage auf: Rituelle Tötung?
Darunter ein Foto vom Mainufer, vom Fundort der Leiche. Ein katholischer Pfarrer aus Griesheim. Den Artikel, verfasst von meinem besten Freund Marc, wollte ich mir nach dem Kaffee vornehmen.
Ich löste ein Stückchen Zucker in der dampfenden Tasse und kam mir vor wie auf Besuch. Carlos und ich aßen schweigend Kreppel, die unsere Perle Georgina mir zuliebe auch außerhalb der Saison buk. Die Buntbarsche glotzten mit gespitzten Mäulern vom Aquarium in der Anbauwand zu uns herüber. Ich beneidete sie. Ihr Lebensinhalt bestand aus drei Komponenten: Fressen, fressen und – die zweitschönste Sache der Welt. Nicht dass ich Hunger gehabt hätte. Doch Carlos' Begrüßung nach einer Woche Getrenntseins war merkwürdig frostig ausgefallen.
Vom Flur her hörte ich Genos Rufe.
»Wenigstens freut sich der Vogel«, murmelte ich.
»Es tut mir leid«, lenkte Carlos ein und rückte näher. »Ich bin ein Idiot.“ Ich nickte. Dem war nichts hinzuzufügen.
„Gab es Ärger in der Schule?“, erkundigte ich mich und strich ihm über die Wange. Seit wann fiel es ihm schwer, darüber zu reden? Es war eher mein Beruf, den wir selten zum Thema hatten. Carlos konnte Leichengespräche nicht ertragen, und ich schätzte mich glücklich, dass er, wenn schon keinen der Paketdienstboten oder Lieferanten, so doch wenigstens meine zwei Angestellten persönlich kannte.
Er winkte ab, nahm meine Hand in seine. Seine Zunge begann, den Puderzucker von meiner Oberlippe zu lecken. Mit der freien Hand fuhr ich unter sein Hemd, langsam, zärtlich, während ich hörte, wie sich einen Stock tiefer ein Schlüssel in der Haustür drehte. Ich vernahm die Stimmen meiner Mitarbeiter und das Rasseln der fahrbaren Trage auf den Fliesen. Kundschaft?
Sanft schmiegte ich mein Gesicht in Carlos' Achselhöhlen, ließ mich mit dem Strom meiner Gefühle treiben. Er knöpfte mir die Bluse auf und drückte mich mit sanfter Gewalt in die Horizontale. Seine Hände fuhren tiefer, um meine tauben Beine zu spreizen.
»Pequeña!« Kleine.
»Querido!« Lieber.
»Te quiero.« Ich liebe dich. Er lächelte abwesend, griff in mein Haar, fügte an: »Roja.«
Dann kippte er zur Seite.
Ich war schlagartig entzaubert. Das Kosewort war mir neu, meinte er mich – oder wer zum Teufel war »Roja«? Es bedeutete so etwas wie »Rote«.
Kapitel 2
Melda
Wie hatte es nur so weit kommen können? Tu's jetzt, befahl eine innere Stimme. Menschen verschoben lästige Dinge gern auf den rechten Moment, der dann doch nie eintraf. Der rechte Moment war hier und jetzt. Räum endlich auf.
Melda ließ den Blick über das Chaos gleiten, und sie empfand wieder diese lähmende Hilflosigkeit. War es Mamas Stimme? Melda sah die Bilder, wie sie durch das elterliche Wohnzimmer wirbelte, mit dem Staublappen in den Kinderhänden, wie sie das Essen richtete, die Terracotta-Fliesen schrubbte und die Kloschüssel bürstete, und es doch nie recht machte.
Einen kleinen Kratzer und ein kaltes Gefühl auf Meldas Haut hinterlassend, sprang die Katze aus ihrem Arm. Melda folgte ihr mit den Blicken hinüber zur Fensterbank. Selbst auf dem Sims türmten sich leere Dosen und Teller mit alter Bratensoße, deren sich die Katzenzunge annahm. Sie mussten dort seit Wochen dümpeln. Zum Spülbecken war ja auch kein Durchkommen.
Hinter ihr kicherte Jorgas auf.
»Wie du guckst.«
»Wie gucke ich denn?«
»Na, so«, meinte er und zog Grimassen.
»Bengel«, tadelte sie. Sie mochte das Bürschchen, doch von Zeit zu Zeit bedurfte es eines erzieherischen Dämpfers, damit er ihr nicht auf der Nase herumtanzte.
Noch bevor ihr die passende Reaktion einfiel, schnurrte das Handy. Eine SMS, von Luzifer. Lass uns reden. Gewohnte Zeit, neunzehn Uhr?
Seufzend versenkte sie das Handy in der Hosentasche. Über Luzifer wollte sie jetzt nicht nachdenken. Zuerst die Brücke finden. The bridge. The bridge over troubled water. Sie nannte den schmalen Durchgang zu Bad, Küche und dem zum Kinderzimmer umfunktionierten Büro die Brücke, die sich durch Schluchten aus Unrat wandt.
Ein wenig schämte sie sich vor dem Jungen. Sie sollte ein Vorbild sein. Stattdessen bot sie ihm Dreck und Flöhe, seit dem Tag, als ihre kleine Maria für immer aus ihrem Leben verschwunden und Jorgas ihr fast zeitgleich zugelaufen war wie eine mutterlose Katze. Knapp ein Jahr war seither vergangen. Ein Jahr, das Jorgas und Melda zur untrennbaren Einheit verschweißt, ein Jahr, das Melda den Jungen lieben gelehrt hatte wie ihr eigenes Fleisch und Blut. Auch wenn er sich manchmal bockig zeigte: Er liebte Melda von Herzen, war ihre Gedanken, ihre Gefühle, ihr engster Vertrauter. Am liebsten saß er im Schneidersitz, dort auf dem Bierkasten zwischen Klamottenstapeln, und gerade bohrte er höchst ausführlich in seiner Nase. Dabei wackelte die Nickelbrille auf seinem Nasenbein, die Melda für einen Euro plus Versand bei E-Bay ersteigert hatte, weil das Geld für den Optiker hinten und vorn nicht reichte.
»Jorgas hat Hunger«, verkündete der Racker. Eingehend betrachtete er das Produkt seiner Fingerübungen, bevor er es in den Mund steckte.
Melda seufzte.
»Scheint mir auch so.«
»Gibt's Schoki?«
»Wart's ab.« Sie strebte auf die Brücke zu. Schokolade war eine gute Idee, die Süßigkeit hob sofort die Laune. Mit etwas Glück fand sich im Kühlschrank noch eine Tafel Trauben-Nuss vom letzten Einkauf.
Linkerhand wucherten Zeitschriften, Kissen, ein String-Tanga, auf der anderen Seite der Brücke verschüttetes Katzenfutter, Katzenkot, Lebendiges: Kugelkäfer, die sich im Futter tummelten, eine surrende Schmeißfliege. Zwickte Melda die Augen zusammen, so verschwamm das Ganze zu einer breiigen Masse, ein Konglomerat schmutziger, erdiger Farben. Wie bei Hochwasser, dachte sie, wenn der Main über die Ufer trat und Schlamm und Sand anspülte.
Wenn Mama das sähe! »Saustall«, würde sie sagen. »Aus dir wird nie was Vernünftiges werden.«
Melda fiel ein, was der Main letzte Woche noch so alles preisgegeben hatte, und für eine kleine Sekunde schimmerte dort zwischen dem Unrat ein bleiches Gesicht, worüber die Maden krochen. Es war das Gesicht von Pfarrer Kunze.
Sie war geübt im Verdrängen von Schmerz und Gefühl, sie wandte den Blick von dem grässlichen Bild. Bestimmt war er selbst schuld an seinem Tod, der Pfaffe.
Im Vorbeigehen fand sie eine Plastiktüte. Mit spitzen Fingern sammelte sie ein Toastbrot mit Käfern hinein. Der Gestank, irgendwo zwischen Schimmel und Tod, trieb ihr Tränen in die Augen, sodass sie beschloss, öfter durchzulüften. Herr Großkurt, der Vermieter, hatte sich zu einem Gespräch angekündigt. In dieses Durcheinander konnte sie ihn unmöglich bitten, sonst würden sie nicht über Mieterhöhung, sondern gleich über Kündigung reden. Melda musste die Müllsäcke holen: ein seelischer Kraftakt.
In ihrer Tasche vibrierte das Handy, doch sie konzentrierte sich auf die Müllsacksuche. Der sanfte Summton steigerte sich zum Klingeln.
Jorgas rief: »Hast du was mit den Ohren, Mel?«
»Sei lieber still, Freundchen«, zischte sie. »Hörst du? Sonst esse ich die Schoki allein auf.«
»Wenn es wieder Luzifer ist ...«
»Was dann?«
»Kann ihn nicht leiden.« Es war erschreckend, wie klar Jorgas oft Meldas Gedanken aussprach. In letzter Zeit hielt sie nicht mehr so große Stücke auf den Hohepriester, das hieß, die Gefühle für diesen Mann wechselten. Noch gab es Zeiten, in denen sie Zärtlichkeit fühlte.
Sie machte noch einen Schritt und blieb Jorgas die Antwort schuldig. Was wollte Luzifer? Wollte er ein privates Treffen, oder hatte er ihr etwas Wichtiges, Gruppeninternes mitzuteilen?
Unterwegs klaubte sie die Grauwollene auf, die ihr leise maunzend um die Beine strich.
»Schscht, Katze. Kriegst gleich dein Fresschen.«
Nach Meldas Trennung von Dimmi hatte Luzifer angefangen, ihr wieder Avancen zu machen. Wollte sie das? Sie sah ihn mit anderen Augen. Seit Walpurgis, letztes Jahr.
»Schoki«, bettelte Jorgas, und jetzt surrte auch noch das Festnetzgerät.
Melda zog den Kopf zwischen die Schulterblätter, spürte den schnelleren Herzschlag, und wie sie die Finger tiefer in das Katzenfell krallte. Luzifer spielte gern die beleidigte Leberwurst, wenn man ihn ignorierte. Sie zog das Handy aus der Hosentasche, noch bevor sie die nötigen Müllsäcke aus dem Hochschrank gleich neben der Tür holte und dann seitlich die Kühlschranktür wegen der Schokolade öffnete. Sekundenlang starrte sie das Display an wie einen Feind.
Kapitel 3
Natalja
»Bürgerhospital Frankfurt, Innere Abteilung, Schwester Claudia am Apparat.«
»Na sag mal«, grummelte ich. »Der Papst ist einfacher zu erreichen.« Ich hatte mich schier verzehrt vor lauter Sehnsucht nach der Mausestimme. Es war sieben Uhr durch, Claudia hatte gerade Pause. Ich ahnte, dass sie schon mal das ein oder andere Glimmstängelchen rauchte, vor dem Haupteingang der Klinik. Beim Stichwort Zigarette griff ich automatisch in die Tüte mit der Ersatzbefriedigung: Gummibärchen.
»Hi Allia. Nice, dich zu hören, das Flugzeug ist also noch heil.«
Haha, das Flugzeug! Piepmäuschenpiep. Es klang erfrischend unbekümmert. Ich konnte das Herzgesicht meiner kleinen Schwester vor mir sehen, die dunklen Rotweinlippen, die stets ein wenig fiebrig wirkten, während mein Blick über den offenen Aktenschrank gegenüber streifte.
»Was gibt es denn«, fragte sie, »mitten in der Nacht?«
»Alles und nichts«, erwiderte ich. Am Telefon besprach ich nicht gern meine Sorgen und Nöte, ich wollte ein persönliches Treffen und konnte warten, weil ich Claudias Rat schätzte. Obwohl sie die Jüngere war, musste ich ihr in Bezug auf Männer deutlich mehr Erfahrung zubilligen.
»Und wie geht es mir so, nach dem Urlaub? Und Mama? Ihr habt bestimmt geredet.«
Da war sie wieder: die Schwesternsprache. Wie geht es mir. Damit meinte sie mich. Und mir ging es beschissen. Nicht, weil mir der intensive Geruch der Tigerlilien auf meinem Schreibtisch Kopfschmerzen bereitete, sondern wegen Carlos.
»Mama«, fuhr ich fort, »richtet dir übrigens Grüße aus. Sie will zu uns ... na ja, so um den ersten Mai herum ...« Geno gurrte zustimmend. Ganz in Gedanken hatte ich das Kerlchen auf meiner Schulter ins Büro getragen, das sonst für es tabu war.
»Ach?«, fiepte Claudia. »Wieso vermiete ich nicht einfach mein Gästezimmer?«
Ich zuckte mit den Schultern, als könne sie es sehen. Die Süßigkeit brannte in meinem Rachen. Über Claudias Minderwertigkeitsideen mir gegenüber hatten wir schon öfter gerätselt und waren auf keinen grünen Zweig gekommen. Es ging wohl um so subtile Geschichten wie die Verteilung liebevoller Blicke, kleiner Streicheleinheiten mit einem zärtlichen Über-den-Schopf-fahren oder das Geschenk eines mütterlich liebenden Lächelns. Es ging um das Leuchten in stolzen Mutteraugen. Claudia fand, dass sie weit schlechter dabei wegkam als ich.
»Du hältst doch eh nichts vom Laufen, oder?«, sagte ich zu meiner Verteidigung. Ich hörte sie noch schimpfen, wie viele Kilometer sie täglich in der Klinik ableistete, und dass sie es verdient hätte, sich am Wochenende auf die Couch vor den Fernseher zu fläzen. »Und Mama will unbedingt in den Hessenpark und dann im Taunus spazieren gehen«, fügte ich an. Außerdem drehte Mama an ihrem Hochzeitstag allein in ihren vier Wänden in Friedrichsdorf-Burgholzhausen durch, seit Paps verstorben war. Alles erinnerte an ihn, auch wenn sie selbst nur noch den ersten Stock bewohnte, den sie nach dem Brand neu hatte hochziehen lassen.
An dieser Stelle hielt ich es für angebracht, das Thema zu wechseln. »Und du, Maus? Was hast du so gemacht die Tage? Was habt ihr gemacht, du und Mika?« Ich lachte auf. Das reizte auch den Grünen auf meiner Schulter zum Lachen. »Es ist doch noch Mika?« Eine berechtigte Frage. Claudia wechselte die Partner wie die Frisuren.
»Mika? Wieso Mika? Seit gestern heißt mein Schatz Tom.«
»Na bitte.«
»Erwischt«, lachte sie. »Du hast falsch gedacht. Mika ist aber so was von aktuell. Du, das könnte was Ernstes werden!«
Ich staunte Bauklötze.
»Ist nicht wahr?«
»Wir sind jetzt offiziell verlobt.«
»Claudi, Claudi. Ich muss mich sehr wundern. Du wirst doch am Ende nicht sesshaft?«
Sie seufzte. »Abwarten. Er ist wunderbar. Engt mich nicht ein.«
»Kunststück. Bei deinem Freiheitsdrang.«
»Und was treibt mein Lieblingsschwager so?« Nun, der Begriff des Lieblingsschwagers relativierte sich, wenn man bedachte, dass es nur diesen einen gab. Ich spürte, wie sich meine Schultermuskeln spannten und mein Lächeln irgendwie bitter wurde. Der gestrige Abend stand schlagartig vor mir. Der Abend und Roja.
»Treffen?«, lenkte ich ab. »Um Zwölf im Café Mozart?« Das nostalgische Cafè in einer Parallelstraße der Frankfurter Zeil bot eine leckere Kuchenauswahl und duftende Crépes und war für mich und mein Handicap in einer verlängerten Mittagspause ein passender Abstecher.
»Nice idea«, meinte Claudia. »Vielleicht ein andermal. Ich treffe Mika um zwölf, schlafen muss ich auch irgendwann. Bin total gerädert, in der Klinik ist zurzeit die Hölle los.«
»Die Hölle?«
»Ansonsten ist die Omi in Zimmer achtzehn ja echt eine Süße. Faselt viel von ihrem Sohn in Florida und so, Disneyland, Mickey Maus. Ganz unterhaltsam.«
»Aber?«
»Hat ein Darmproblem. Und immer die Finger in der Windel.«
»Claudi, ich bewundere dich ...«
»Ich könnte dir Storys erzählen ...«
Oh ja, das könnte sie. Und sie erzählte reichlich, während unserer Telefonate. Von Machos, die die einzige Krankenschwester auf der Station als persönliches Eigentum betrachteten, oder von Opas, die nachts aus der Klinik türmten, um auf Weltreise zu gehen oder sich wenigstens einen entspannenden Kurztrip in die Eros-Center der Frankfurter Kaiserstraße zu genehmigen. Ich hatte stets ein offenes Ohr. Irgendwo brauchte jeder seine seelische Müllhalde.
Im Hintergrund hörte ich ein Geräusch, als ob Bestecke klapperten.
»Stichwort Hölle«, fuhr Claudia fort. »Dazu fällt mir glatt die Wasserleiche ein.«
»Du meinst den Pfarrer? Wie hieß er gleich?«
»Keine Namen, bitte. Du hattest den doch nicht auf dem Tisch?«
Die Frage konnte sie sich selbst beantworten. Mein Institut im Herzen Frankfurts war eine viel zu unbedeutende Klitsche für solch brisante Fälle. Mit Sicherheit hatten Heilmanns Bestattungen im Westend den Zuschlag gekriegt.
Ein Gummibärchen starb den Sekundentod.
»Er war mein Patient«, fuhr Claudia fort.
»Mit Darmproblem?«
»Nö. Nierenspende. An seine seltsame Schwester.«
»Seltsam?«
»Die Wortbedeutung ist: unkonventionell, fremdartig.«
»Herzlichen Dank, Frau Lehrerin.«
»Unkonventionell, genau. Sie erinnerte mich an Dana. Aber das Wunderliche scheint in deren Familie zu liegen. Wer wird denn schon freiwillig Pfaffe?«
Da lag mal wieder ein wunder Nerv von ihr blank. Über Religionen und Sekten, den Herrgott und sein Fußvolk, hatten wir nächtelang diskutiert. Claudia war schließlich aus der Kirche ausgetreten. Ich bewunderte ihre Konsequenz. So wirklich war ich selbst von den jeweiligen Vereinen nicht überzeugt, doch ich redete mir ein, dass es sich für eine Bestatterin besser machte, wenn sie sich in puncto kirchliche Zeremonien auskannte. So blieb ich halbherzig der katholischen Kirche, auch mit meinen jährlichen Spenden für das Glockengeläut, erhalten.
»Erklärst du mir den Zusammenhang?«, bat ich Claudia. »Ich meine: Nierenspende mit Hölle.« Geno plusterte sein Köpfchen auf. Ich durfte ihn kraulen.
»Die Hölle, das sind die Polizisten. Schleichen seit Tagen auf meiner Station herum und gehen mir mit ihren Fragen gehörig auf den Zeiger.«
»Verstehe. War es Suizid bei dem Pfarrer?«
»Kommst du, in die Acht?«, hörte ich die Stimme einer anderen Schwester.
»Riecht eher nach Mord«, erwiderte Claudia auf meine Frage.
»Woher weißt du das?«
»Was ein junger Polizist schon mal so plappert. Nicht jeder kennt so was wie Schweigepflicht.«
Ich nickte und schmunzelte.
»Was ist denn jetzt?« Die Stimme im Hintergrund drängelte.
»Na dann«, sagte Claudia. »Very nice, dich zu hören. Ach, und von wegen Pfaffen und anderen Teufeln: Pass gut auf dich auf, Schwesterherz, wenn du nachts allein durch die Straßen wandelst.«
»Was heißt das nun wieder?« Und seit wann wandelte ich?
»Liest du keine Zeitung?«, meinte sie, ungerührt der Drängerin.
»Ach so, das.« Sie sprach von der Teufelssekte, die seit Jahren mitten unter uns lebte, und die Tage im Frankfurter Stadtwald bei einer Orgie erwischt worden waren, wo sie wie losgelassene Teenies ihren Messwein tranken und eine Wasserpfeife schmauchten. Harmlos und irgendwie süß.»Wärst denen eh ein viel zu zäher Brocken«, frotzelte Claudia.
»Wie meinst du das?«
»Die neuen Apostel, so munkelt man, opfern bei ihren Messen zur Not auch Tiere.«
»Zur ... Not? Du meinst ...« Das glaubte sie nicht im Ernst. Menschenopfer? Wir lebten doch nicht im Mittelalter.
»Keine Sorge«, sagte ich noch. »Mein Rollstuhl ist schneller, als der Teufel erlaubt.«
Claudia stimmte in mein Lachen ein. Ich fürchtete mich nicht vor den Teufelsanbetern. In Wahrheit waren sie Laschis mit kleinem Selbstwertgefühl. In diesen Gruppen ging es doch viel weniger um Satan als um Macht und Geld, es ging um die Hierarchie in den eigenen Reihen.
Claudia und ich verabredeten uns für Dienstag. Am Montag fand ich reichlich Gelegenheit, den Koffer zu leeren, die Wäsche zu waschen und mit dem Staublappen durch die Wohnung zu fahren. Die Fenster starrten vor Dreck, der Osterputz war fällig, doch das mochte Georgina, meine Hilfe, erledigen.
Carlos belegte noch das Bad. Um halb acht würde er aufbrechen ins Goethe-Gymnasium. Mona war in diesen Augenblicken schon auf dem Weg zu einem Kunden. Ich hingegen wollte hinunterfahren ins Institut, Pit begrüßen und die aktuellen Vorgänge besprechen. Im selben Moment stand der vierzigjährige Bommersheimer aber schon vor meinem Schreibtisch, mit seinem schiefen Schulbubengrinsen und dem kurzgeschorenen Haar. Bestatter war so ungefähr das Letzte, woran seine schlaksige Erscheinung und das Gesicht mit der schmalen Goldrandbrille erinnerten. Eher hätte man ihn in die Schublade Grundschullehrer gesteckt, doch wer einmal einen Arbeitsbericht von ihm gelesen hatte, zweifelte auch an dieser Variante: Pit schrieb, wie ihm der Bommersheimer Schnabel gewachsen war.
Beschdaddungsundernehme.
»Gude, Allia.« Er trat ein, zur selben Zeit wie Georgina, die sich des vollen Abfallkorbs annahm. Sie hatte wohl wieder schlecht geschlafen, unter ihren Augen schimmerten bläuliche Ränder.
»Was ist los, Pitti? Schaust ja, als wär einer gestorben.« Grinsend kniff ich ihn in die Seite. Er musterte mich.
»Du hast kei Ahnung, odder?«
Ich stellte fest, dass Mona sich noch im Haus aufhielt, denn sie steckte den Kopf zur Tür herein. Irgendwie schaute sie genauso belämmert drein wie Pit.
»Es ist einer gestorben«, erklärte Pit und tauschte einen Blick mit Mona, danach verschwand ihr Kopf wieder, und auch meine Perle verließ den Raum, den Papierkorb unter dem Arm.
Ich nickte. »Weiß ich doch. Der Herzinfarkt.«
Erst überlegte ich, niemand hatte mich über einen Neuzugang informiert, und das ging gar nicht. Aber dann musste ich lachen, als ich den verwirrten Ausdruck in dem Lausbubengesicht sah.
„Noch kei frische Luft geschnappt, heut?« Pitti schnaufte. »Das tote Professorsche ... wie drück isch es vorsischdisch aus ...«
»Professor? Nun mach es nicht so spannend, mein Blutdruck ... schon viel zu hoch heute Morgen ...« Demonstrativ deutete ich auf den Aktenstapel, der auf mich wartete.
»Er heißt Dimitrios Galanis, einundfuffzisch Jahr alt«, erklärte Pit mit leicht hilflosem Ausdruck. »Isch hab den Perso gefunne, in seiner Hosentasch. Und eine Rechnung von Amazon.«
»In welchem Raum?«
Pit zuckte mit den Schultern und deutete Richtung Tür. Draußen hörte ich Mona werkeln. Allmählich wurde ich sauer. Vorsorglich wendete ich meinen Rollstuhl.
»Will mich mal einer aufklären ... Wer ist denn jetzt der Tote? Frankfurter?«
Ein Nicken.
»Und was ist an dem ... Professor so besonders, außer, dass er klammheimlich durch meine Hintertür ...?«
Pit deponierte eine Plastiktüte auf dem Schreibtisch. Seine hellen Augen fixierten mich.
» Der Galanis is unvollständisch, gewissermaßen.«
Sofort kamen mir Bilder. Nikotinkrüppel hatten wir hin und wieder mal auf dem Tisch. Ich fummelte in der Tüte herum. Pit hörte nicht auf, mich anzusehen, indessen meine Finger auf etwas Kaltes, Rundes stießen. Ich spähte in die Tüte, fand einen Opalring. Irgendwie wurde mir mulmig bei dem Anblick. Das Teil sah fast aus wie …Der Ring sank in die Tüte zurück.
»Okay. Unvollständig. Was heißt das?“
Ich stand bereits in den Startlöchern, die Hände an den Rädern. Am besten war, ich sah selbst nach dem Rechten.
»Der Professor is rasiert.«
Ich hüstelte. Als wäre Galanis der Erste mit epilierter Brust oder einer Rasur im Schambereich! Pit war altmodisch in diesen Belangen, da hielt sie seinen Freund Jochen für deutlich aufgeschlossener.
„Galanis fehlt ein Stück Skalp, Briefmarkengröße.«
Nichts hielt mich mehr im Büro. Pit schloss auf.
»Warte mal!«, rief er, doch ich war schneller. Raum drei war wie die zwei anderen gut gekühlt, dennoch roch ich die Leiche. Man sagte, mit der Zeit gewöhne man sich. Meine Nase reagierte schon auf die feinsten Nuancen. Ich hatte meinen Beruf von der Pike auf erlernt, Familienbetrieb, war gewissermaßen zwischen Särgen aufgewachsen und hatte mit meinen Freunden darin Verstecken gespielt. Und dennoch war ich stets froh, die Verstorbenen bald Erde, Feuer oder Wasser überantworten zu dürfen, die Fenster zu öffnen und den Tod aus dem Haus zu jagen. Es hatte etwas von Tabula rasa.
»Das ist Frau Markwart«, stellte ich irritiert fest, als ich das Laken vom Kopf der Leiche in unserem Raum für Neuankömmlinge zog.
Doch wieder deutete Pit Richtung Tür. »Isch hab wohl gestern Abend vergesse, das Tor abzuschließe.«
Herrgott, musste man ihm denn heute jeden Wurm aus der Nase ziehen?
»Pitti, du sprichst in Rätseln. Im Hof – das ist nicht dein Ernst, oder?«
»Besser, du informierst den Horst Stein.«
Ich schwankte, ob ich wirklich zuerst den Gerichtsmediziner anrufen sollte oder doch die Polizei, als ich vor dem Toten stand.
Er lehnte sitzend mit dem Rücken an der Häuserwand. Unter halb offenen Lidern hervor sah er durch mich hindurch. Er hatte braune Augen. Braun mit einem Schuss goldenen Gelbs wie Safran.
Kapitel 4
Melda
Die Frau gegenüber blickte sie traurig an. Melda streckte die Hand nach ihr aus, doch die traf nur auf die Kälte des Flurspiegels. Luzifers dritter Versuch hatte schließlich gefruchtet, sie hatten miteinander telefoniert und ein Date vereinbart – unter Jorgas‘ finsteren Blicken. Luzifer behauptete, er sei immer noch verrückt nach ihr, sie aber konnte diese Liebe nicht fühlen und sehnte sich nach einem anderen. Eine Weile hatte sie überlegt, einen Spaziergang zu machen, hinauszugehen aus ihren vier Wänden, und sie hatte sich den feinen Seidenschal mit den Bommeln umgelegt, weil sie sich im Schatten so leicht verkühlte. Aber ihren Gedanken nachhängen, das konnte sie ebenso gut im Beisein Jorgas‘ und der Katze. Sie mochte sowieso keine Menschen, mit Ausnahme einiger Apostelbrüder und -schwestern. Die Momente, die sie mit der Außenwelt verbanden, ließen sich an einer Hand abzählen: Da waren die Gruppentreffen, alle paar Wochen ein Kinobesuch, und samstags der Einkauf bei Edeka.
Die freie Ecke der Couch, auf die Melda seitlich blickte, lud sie zu einem Schläfchen ein, gleich nach dem Essen. Ob sauber oder nicht, dies war ihr Zuhause, ihre Trutzburg, und in drei Jahren, dachte Melda, ging die Zeilsheimer Mansarde komplett in ihren Besitz über, sobald die letzte Rate fällig wurde. Die letzte Rate würde sie aber nicht begleichen können, wenn Luzifer finanziell nicht bald einsprang. Sie mussten reden. Immerhin schuldete er ihr noch eine größere Summe. Als Krankenschwester und spätere Hebammen-Schülerin war Meldas Gehalt nicht gerade üppig ausgefallen, doch auch die Ersparnisse aus der Zeit der Telefonsex-Stunden wurden langsam knapp. Luzifer zuliebe hatte sie die Hebammen-Schule abgebrochen. Er fand es damals eine gute Idee, wenn sein Mädchen den Kameraden ein Zeichen setzte, und sich mit vollem Einsatz der Gruppe widmete.